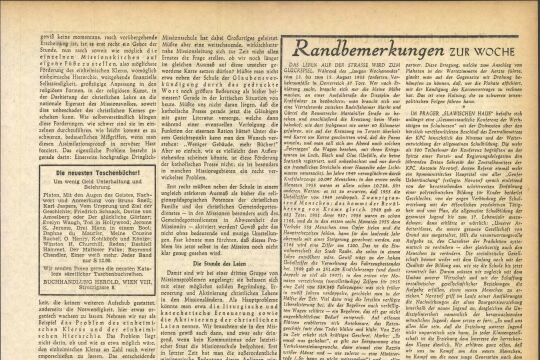Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randbemerkungen zur woche
EINEN STUNDENLOHN dem Diözesanlonds für Familienhilte zu spenden, sind auch in diesem Jahre wieder alle Katholiken der Wiener Diözese aufgerufen. Einen Blick auf die bisherigen Leistungen dieses Fonds: Der erste Vorschlag dazu stammt aus dem Jahre 1950. In der darauffolgenden Fastenzett rief Kardinal Innitzer zum erstenmal zum Fastenopler auf: einen Stundenlohn für den Diözesanlonds. Etwa 150.000 S flössen ein. Im nächsten Jahr waren es schon 250.000 S. Eine Ruine in der Hasengasse im 10. Bezirk wurde gekauft. Der staatliche Wiederaufbaufonds schoß die Baukosten vor. Nun steht das Projekt vor seiner Fertigstellung. Weitere Ruinen und Baugrundstücke wurden erworben. Das zweite Bauprojekt wird zum größten Teil vom Wohn- und Siedlungs-londs finanziert werden. Aber die Tätigkeit des Diözesanlonds für Familienhille war damit noch nicht erschöpft. Die freien Beträge wurden jungen Familien zinsenlos als Darlehen zur Vertagung gestellt (meist in der Höhe um 10.000 S) und damit die Möglichkeit geschalten, daß sie sich auch anderweitig Wohnungen beschaffen konnten. Die Rückzahlungen erfolgten in der Regel sehr pünktlich, so daß bald auch neuen Antragstellern geholfen werden konnte. Die Wohnungen, die geschalten wurden und noch geschaffen werden, durften keine Notlösungen werden, keine Kleinst- und Kleinwohnungen. Es sind famtllentreundliche Wohnungen, mit mindestens zwei bis zweieinhalb Zimmern... Sie werden durchweg als Eigentumswohnungen vergeben. Ein kleiner Beitrag also zur Linderung der Wohnungsnot. Der einzige Schönheitsfehler: die Tatsache, daß es aus finanziellen Gründen noch nicht möglich ist, an die Planung eigener Siedlungen zu gehen — wie dies in Frankreich schon geschehen Ist. Das neugeschaffene Stedlungsaml der Bischolskonferenz, daß auch dfe Mittel des Katholikentages fruchtbar gemacht hat, wäre als Koordinationsorgan wohl in der Lage, auch größere Aulgaben zu bewältigen.
DAS ANSTEIGEN DER VERBRECHENSZIFFERN fn Oesterreich nimmt bedenkliche Ausmaße an. Bei einzelnen, besonders ver-abscheuenswürdigen Verbrechen wurde bereits von berulener Seite dem allgemeinen Wunsche nach einer dem Gewicht solcher Taten entsprechenden Sühne erhoben. Jedenfalls müßte nun wenigstens jenes Maß von Abwehr- und Abschreckungsmitteln mehr ausgeschöplt werden, welches das geltende Stratrecht an die Hand gibt. Vor der Aenderung bestehender Gesetze müßte man es also zunächst mit deren strafferer Anwendung versuchen. Hierüber sind nun In letzter Zeit Nachrichten bekanntgeworden, die aut eine so milde Praxis deuten, wie sie in Zeiten eines nicht so krassen Notstandes sicherlich ihre Berechtigung haben mögen. Zur Ahndung einer „schweren Körperbeschädigung“ schreibt das Gesetz eine schwere Kerkerstrafe von mindestens sechs Monaten vor. Im Jahre 1949 wurden von 884 Delikten dieser Art nur 35 mit der Mindest- (oder einer höheren) Strale geahndet. Die Mehrzahl der Uebeltäter wurde zu ein bis zwei Monaten Kerker verurteilt, 150 von ihnen kamen noch glimpflicher davon. Aehnlich milde wurden Betrug, Erpressung und Verleumdung bestralt. Zweifellos Ist die Tendenz zur Strafmilde ein ebenso anerkennenswertes wie vertretungswürdiges Prinzip in Zeiten, in denen nicht ein so krankhaftes Ueberborden verbrecherischer Instinkte festgestellt werden muß. Die im allgemeinen sehr strengen Bestimmungen des österreichischen Stralgesetzbuches legen dies auch nahe. Aber ist nidit eine Dauerübung gelinder Straten und das vorherige Wissen um eine solche Milde geeignet, von jenen Elementen, um die es sich hier handelt, geradezu ins Kalkül gezogen zu werden? Diese Milderungen, die hier angewendet werden, sollten doch wohl „außerordentliche“ bleiben und als solche werden sie ohne Zweifel ihre Berechtigung und Bedeutung behalten.
DIE ENTWICKLUNG DES „BILINGUISMUS“ ist eine der nutzvollsten kulturellen Auswirkungen des sich leider recht langsam durchsetzenden Europagedankens. Es handelt sich um die Schallung einer sprachlichen Verständigungsbasis zwischen den einander geistig näher rückenden europäischen Nationen, aul dem Wege, daß immer je zwei Nationen die Sprache der anderen an ihren Schulen bevorzugt lehren. Die übrigen Länder können sich dann in gleicher fortschreitender Weise der einen oder anderen solchen Nation Ihrerseits koordinieren. Sie würden dadurch Indirekt auch von den anderen, diesem System angeschlossenen Sprachen profitieren. Um wirksam zu werden, müßte jeweils der Unterricht In der zweiten Sprache schon in den Volksschulen erfolgen — wie dies in Holland bereits der Fall ist. Als nützlich hat sich hierbei zunächst die Schallung von „Patenstädten“ erwiesen, wie sie zwischen Großbritannien und Frankreich bereits in Uebung steht. Diese Zweisprachigkeit scheint auch geeignet, heikle Schulprobleme innerhalb eines Staatskörpers zu lösen. Die stets geistvollen und konstruktiven Auslührungen des „Dossier de la Semaine“ des „Centre d'lniormations Cathollques“, denen wir hier folgen, weisen nämlich auf die Möglichkeit hin, auf diesem Wege die schwierige
Elsässer Schulfrage zu normalisieren. Bekanntlich wird an den Schulen dieses de facto überwiegend deutschsprechenden französischen Landesteiles gegenwärtig das Deutsche nicht gelehrt. Es wäre also nun die Möglichkeit gegeben, diese Frage auf das europäische Niveau zu heben, indem für dieses Gebiet nicht, wie sonst beabsichtigt, das Englische, sondern das Deutsche als zweite Unterrichtssprache verwendet würde. Man sieht wie zeitgemäß das Bestreben ist, in gemischtsprachigen Landesteilen, den Unterricht mehrsprachig zu gestalten. Aus der österreichischen Perspektive ist dazu zu sagen, daß eine solche Regelung für Südkärnten schon seit langem besteht. Dort wird von bestimmter Seite aus der gleichen Mentalität dagegen Protest erhoben, die sich im alten Oesterreich so unheilvoll ausgewirkt hat: die dazu geführt hatte, daß die deutschlernenden Slawen vor den das Slawische ablehnenden Deutschen natürlicherweise die Vorhand gewannen, eine Auffassung, die das Deutschtum der Monarchie geschädigt und ihm einen guten Teil seines legitimen Einfluß-gebietes geraubt hat.
.DIE ROTE GUILLOTINE' — so der schreckliche, aber bezeichnende Beiname für Frau Hilde Benjamin, Vizepräsidentin des Obersten Gerichtes der „Deutschen Demokratischen Republik' — bekommt große Arbeit, der deutsche Slansky-Prozeß läuft an. In jeder Diktatur finden sich alsbald Funktionäre, welche das Gesetz erst zu ihren Gunsten auslegen und schließlich „den neuen Erfordernissen“ anpassen. In Deutschland waren es Thierack und Freisler, In Rußland vor allem der damalige Generalstaatsanwalt und jetzige stellvertretende Außenminister Wyschinskij und im Osten Deutschlands hat sich sogar eine Frau, eben Hilde Benjamin, zu dieser Rolle bereit-gefunden. Sie erklärt heute, gestützt auf Moskauer Richtlinien, was Recht ist; ihre dunkle, eintönige und geschäftsmäßige Stimme spricht die Verdammungsurteile gegen alle, auf die nur ein Schatten von Abweichung fällt. Die jetzt 50jährige Vizepräsidentin des Obersten Gerichtes der DDR Ist in Wahrheit Herrscherin über die gesamte Gerichtsbarkeit. Der Präsident Schumann und der Justizminister Fechner sind nur bedeutungslose Randfiguren. Ihrem außerordentlich scharfsinnigem Gehirn entsprangen die Aenderungen bestehender Gesetze, sie steht der Kommission vor, die eine Neufassung des Straf- und bürgerlichen Rechtes für die Sowjetzone vorbereitet. Und — sie präsidiert den politischen Prozessen, ihr Vorsitz bürgt für Parteilichkeit. Am 7. April wtrd sie den bisher größten Triumph ihrer Laufbahn leiern können: sie wird den ehemaligen Außenminister Dertinger richten, sie verantwortet den deutschen Slansky-Prozeß. Der eisigen Intellektuellen war seit je alles zuwider, was nach paktieren mit „Klassengegnern“ aussah, sie kennt nur die Doktrin, sie beherrscht das Spiel des Schauprozesses und sie ist lest überzeugt, daß nur auf diese blutige und barbarische Art der .Soziallsmus“ siegen wird. Die Benjamin war schon vor 1933 Kommunistin. Als die Gestapo ihren Mann, einen Armenarzt aus dem Wedding, ins KZ steckte, ging sie zur sowjetischen Handelsdelegation in Berlin, blieb folglich ungeschoren und — lernte Linientreue. Vielleicht ist ihre Rechtstechnik das ärgste Symbol für die Unfreiheit hinter dem Eisernen Vorhang, das wir auf deutschen Boden kennen.
DURCH DIE MOSKAUER ANTIJÜDISCHE KAMPAGNE ist die israelische KP, nach ihren Anfangsbuchstaben ,Maqi“ genannt, in eine Krise geraten, die an Groteske alles übertrifft, was der an manche Groteske auf der politischen Bühne gewöhnte Zeitgenosse noch erleben kann. Die „Maqi“ schöpft ihren Anhang vornehmlich aus den Reihen judenleind-licher, antizionistischer Araber, die noch vor wenigen Jahren in des arabisch-nationalistische Horn bliesen und zu dem engsten Kreis um Amin el Husseini, den Großmulti von Jerusalem, gehörten. Die israelische KP bietet diesen Elementen die einzige Möglichkeit, im jüdischen Staat ihre Wühlarbeit — keineswegs zugunsten der Sowjets allein — sozusagen auf legaler Weise zu entfalten. Selbstverständlich haben diese Gelegenheitskommunisten die neue Moskauer Parole mit einer dankerfüllten Reverenz prompt aufgenommen, während ihre jüdischen Genossen logischerweise nur sehr zögernd In die antisemitische Bahn einschlugen. Die politische Karriere des ßdischen KP-Führers Mikunis scheint sich nun Ihrem Ende zu nähern. Denn seine arabischen Kollegen von der „Maqi'-Exekutive wollen dem bolschewistischen Beispiel folgen und die israelische KP judenreln machen. Mikunis' Hilferufe finden nun auch In Moskau kein Gehör mehr, denn wer als Jude In Israel lebt, ist — durch die rote Brille gesehen — ein Zlonist, ergo ein Volksfeind. In Israel selbst finden Mikunis' Versuche, sich aus der Schlinge zu befreien, recht wenig Anklang. Es nimmt nicht wunder, wenn Ihm jetzt das Leben im jüdischen Staat — abgesehen von den Liebenswürdigkeiten seiner arabischen Prrtetireunde — zur Hölle gemacht wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!