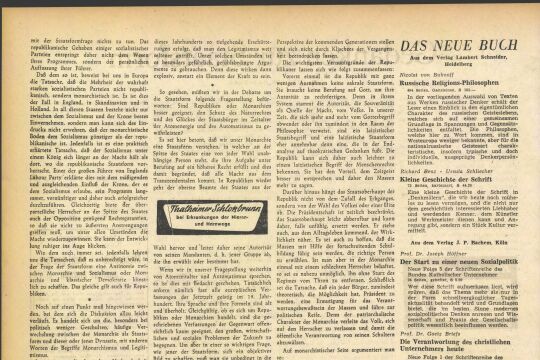Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randbemerkungen ZUR WOCHE
„EIN HAUCH AUS DEM GRABE DER ERSTEN REPUBLIK.“ wehte in der vergangenen Woche durch Wandelgänge und Sitzungssaal des Hohen Hauses. Auf sozialistischen Antrag stand die „Le x S t ar h ember g“ zur Debatte. Vergessen waren anscheinend mit einem Schlag die vielen harten Probleme und offenen Fragen der österreichischen Gegenwart 1952. Durch sechs Stunden spielte man Österreich, 1927 bis 1934. Ein unites Spiel — und dabei voll Tücken und Gefahren. Mit Genugtuung sei aber gleich festgehalten: die österreichische Volksvertretung hatte einen guten Tag. Trotz des stacheligen Themas, das doch so leicht zum Aufputschen echter und eingebildeter Leidenschaften verführen kann, blieb der Nationälrat verschönt von jenen unqualifizierten Szenen, die — wir mußten sie leider auch in jüngster Vergangenheit erleben — in der ersten Republik zum Untergang der Demokratie mindestens ebensoviel beigetragen hatten wie jener Mann, dessen Name jetzt wieder und immer wieder genannt wurde. Der sozialistische Klubobmann vertrat den Schritt seiner Fraktion. Sehr subjektiv, aber ruhig. Merkwürdig nur, daß verschiedene der Zitate Dr. Pittermanns aus dem Starhemberg-Buch man auch von einem Verteidiger desselben zu hören bekommen könnte… Der Redner des Tages aber hieß ohne Zweifel Professor Dr. Gschnitzer. Der Innsbrucker Gelehrte und Tiroler Abgeordnete hatte erst vor wenigen Wochen in der Debatte über das Familienrecht eine Probe oratorischer Meisterschaft gegeben, nun meldete er sich, wieder zu Wort. Und abermals war seine Rede ein Ereignis. Die klare, sachliche Beweisführung des Juristen verband sich mit persönlich ebenso liebenswürdigem wie kultiviertem Auftreten und einer im Hause der Volksvertretung leider selten gehörten gepflegten Sprache. Unschwer wurden die Dinge in ihre richtige Ordnung gebracht. Alts der causa Starhemberg wurde eine Frage des Rechtsstaates, von dem unüberlegten Ausflug in eine böse Vergangenheit kehrte man in die Gegenwart zurück; zu ihren Aufgaben und ihren Gefahren. — Bis zum 5. März soll der Justizausschuß, dem der Antrag überwiesen wurde, dem Plenum berichten. Ihm, den verantwortlichen Männern aller Parteien sowie dem gesamten österreichischen Volk galten die beschwörenden Worte des Sprechers der ersten Regierungspartei: „Schiffbrüchige sind wir auf einem schwankenden Boot in der wilden See, kein Ufer eines Staatsvertrages in Sicht, und, wie Sie ja wissen, vier Elefanten dazu im Boot. Sollen wir da anfangen, die Streitigkeiten auszutragen, die von früher her datieren, als wir noch geglaubt haben, an Bord eines sicheren Schiffes zu fahren? Sollen wir uns wirklich die Ruder um die Köpfe schlagen, statt nach Leibeskräften zu rudern?“ Man sollte sie als Mahnspruch über die Bänke des Nationalrates setzen. Und dies nicht nur, wenn die Lex Starhemberg“ zur Debatte steht…
DIE MARSHALL-HILFE FÜR ÖSTERREICH ist bekanntlich für das „Marshall- Plan-Jahr“ 1951/52 von früher 190 Millionen Dollar auf 120 Millionen Dollar reduziert worden, von denen etwa ein Zehntel nicht wie bisher als Geschenk, sondern als verzinsliches Darlehen gegeben werden sollen. Diese Kürzungen sind zum Teil in der Steigerung der amerikanischen Zuwendungen für die Rüstung Westeuropas, zum Teil in der amerikanischen Annahme begründet, daß nunmehr der Wiederaufbau Europas und die Gutmačhung der Kriegsschäden einen Stand erreicht haben, von dem aus sich dieser Kontinent bei Anspannung aller eigenen Kräfte selbst weiterhelfen könne. Eine Aufklärung fehlt noch. Von informierter Seite wird nämlich unwidersprochen behauptet, daß die Marshall-Plan-Verwal- tung mit der tatsächlichen Verwendung der Hilfsgelder für Österreich nicht durchaus zufrieden ist. Nach Ansicht maßgebender USA-Kreise ist der Zweck, den die USA- Regierung vor Augen hatte: die möglichste Förderung der Produktivität und des allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesses, keineswegs immer erreicht worden. Es wurden auch Klagen laut, während der Zeit der von den amerikanischen Steuerzahlern geleisteten Hilfe seien namhafte Deviseneingänge nicht für Inlandszwecke, sondern zu Kapitalsanlagen im Ausland, sogar in Übersee, verwendet worden. „Der österreichische Volkswirt“ veröffentlicht nun die Mitteilung: „Der am 7. November 1951 von der OEEC erstattete und für Österreich sehr unerfreuliche Bericht kann die Bereitschaft der amerikanischen Stellen, Österreich entgegenzukommen, nur im negativen Sinne beeinflußt haben.“ Angesichts der für österreichische Verhältnisse gigantischen Summen — es handelt sich bei den amerikanischen Zuwendungen um insgesamt etwa 900 Millionen Dollar oder billig gerechnet 18 Milliarden Schilling — hat die Öffentlichkeit ein erhebliches und berechtigtes Interesse, zu erfahren, wie im einzelnen diese Beträge verwendet wurden — und im besonderen: welche Einwände die Amerikaner gegen diese ihre Verwendung erhoben haben. Mag eine solche Publikation vorgesehen sein oder nicht, der Gegenstand ist gewichtig und so ernst, daß ein Stillschweigen nicht am Platz wäre.
•
DIE MONARCHISCHE STAATSFORM findet in Deutschland in der letzten Zeit wieder Interesse. Zumindestens spricht man über sie, wenn auch nur rein akademisch. Anlaß dazu war zunächst die vor einigen Monaten geäußerte Ansicht Winston Churchills, der Untergang der Hohenzollern- monarchie sei ein Unglück für Deutschland gewesen. Als ein wenig abgewogenes Wort eines Abgeordneten im Bonner Bundestag seinem Sprecher den Vorwurf monarchistischer Propaganda eintrug meldete sich die deutsche Presse. Es ist für den Nachbar nicht uninteressant, dieser Aussprache jenseits des Zauns ein wenig zu folgen. Die stürmische „Monarchiedebatte“ im Bundestag bewog das bekannte evangelische Wochenblatt „Christ und Welt“ zu der grundsätzlichen Feststellung:
„Wir krebsen seit 1918, unserem Staat eine anerkannte Form zu geben Es ist uns bisher, wie jeder weiß, nicht gelungen. Auch wer die Lösung nicht in der Errichtung einer Monarchie sieht, sollte bei den Erwägungen über eine dem deutschen Volk gemäße Staatsform die Erfahrungen, die wir und andere Staaten mit Monarchien machten und machen, durchaus heranziehen. Es steht dann jedem frei, die Monarchie nach reiflichem Überlegen überhaupt oder als für unser Volk ungeeignet abzulehnen. Aber es geht nicht an. jeden Verfechter der Monarchie und vollends jeden Bürger, der eine monarchische Staatsform in seine Überlegungen einbezieht, als Totengräber unseres Volkes hinzustellen.“
In der in Hamburg erscheinenden „W eit“ ließ der bayrische Kronprinz Rupprecht die bayrischen Königstreuen wissen, daß er ihre Bestrebungen billige. „Ihre beharrlichen und selbstlosen Bemühungen beweisen, daß weite Kreise des Volkes nach den Katastrophen und Prüfungen der vergangenen Jahrzehnte gerade vom Königtum die wahre Ordnung, überparteiliche Staatsführung und echte Demokratie erwarten “ Größeres Aufsehen aber noch erregte ein mit vollem Namen gezeichneter Leserbrief, den der in Berlin erscheinende und der SPD nahtstehende „Tagesspiege l“ abdruckte:
„Die Ereignisse der letzten Zeit zeigen unmißverständlich, daß weite Kreise des deutschen Volkes wieder eine Monarchie wünschen. Die Gründe sind vielfach, teils Erinnerungen an die ,gute alte Zeit’, die sozialen Spannungen, die trotz Demokratie und Republik ständig wachsen, die nationale Hilflosigkeit und in Verbindung damit der Wunsch, ein wirkliches Bollwerk gegen Neofaschismus und Bolschewismus zu haben. Es wächst die Sehnsucht nach einem ruhenden Pol. nach einer Spitze im Staate die aus der Tradition heraus die Gewähr für eine saubere und sparsame Verwaltung bietet, die aber auch Autorität genug hat, einem wirklich königlichen Wollen Nachdruck zu verleihen. Eine soziale Monarchie würde ihre Anhänger bis weit in die Reihen der Sozialdemokraten hinein haben.“
Neben den Prostimmen fehlen natürlich auch nicht ablehnende Stellungnahmen. Für sie ist ein Artikel der Stuttgarter „D eut- schen Zeitung und Wirtschafts- Zeitung“ bezeichnend:
„Dem Lauf der Geschichte zuwider verband sich die preußisch-deutsche Monarchie auf Gedeih und Verderb mit den bestimmenden Schichten einer versinkenden Epoche und zahlte dafür mit dem Preis des Untergangs. Im Strudel der Niederlage von 1918 zerbarst sie und hätte nur dann gerettet werden können, wenn die Politik des letzten Kaisen von tieferen und weiteren staatsmännischen Impulsen getragen worden wäre, als es ihm vergönnt war, zu besitzen. Es ist den Deutschen von heute gar nichts nütze, wehmütig darüber zu räsonieren, wieviel schöner es gewesen wäre, wenn es anders hätte kommen können, und wieviel glücklicher das Heute und Morgen sein könnte, wenn man ein bloß vorgestelltes besseres Gestern als das wirkliche in die Zukunft projizieren könnte. Das sind alles Hirngespinste. Die Urteile der Geschichte sind unwiderruflich.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!