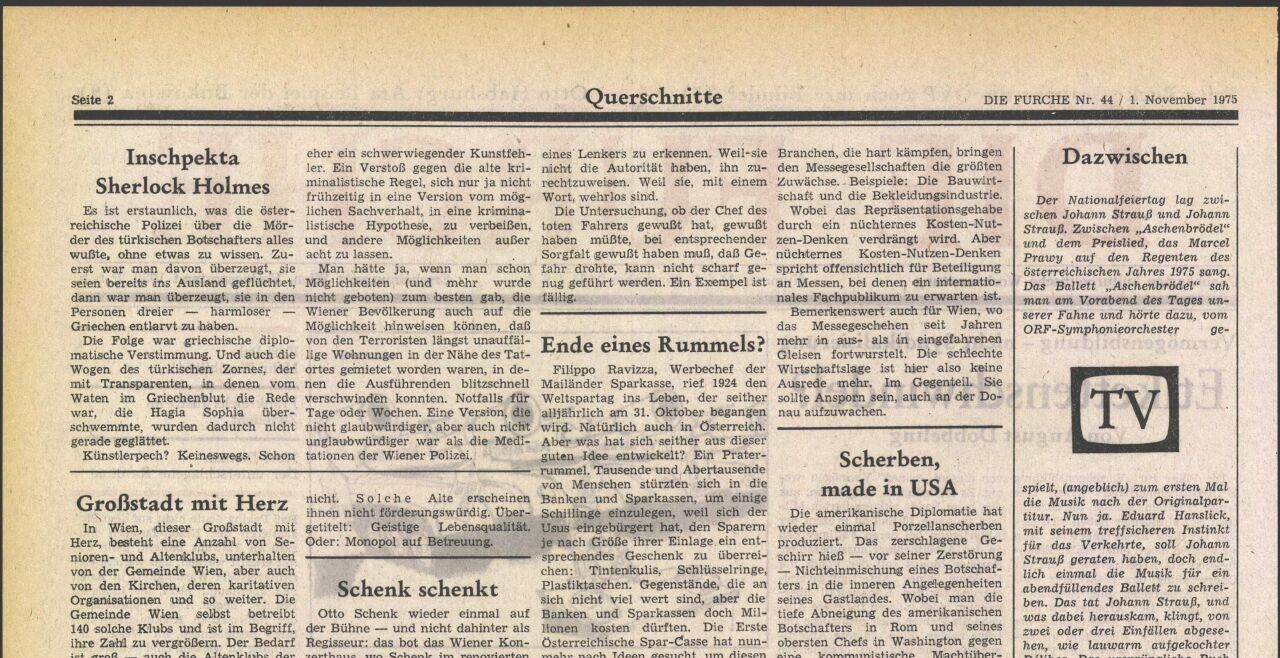
In einem niederösterreichischen Ort war der Staatsfeiertag ein Trauertag. Der private Trauertag und der staatliche Feiertag hatten gemeinsam, daß sie nicht zuletzt an versäumte Lektionen erinnern.
Denn das Busunglück im niederösterreichischen Waldviertel, dem sechs Kinder und ein alkoholisierter Autobusfahrer zum Opfer fielen, war unnötig. Es beweist, daß das schwere Autobusunglück, ' das vor Monaten nicht Kinder, sondern Rentner dahingerafft hat, keineswegs zu jener allgegenwärtigen Wachsamkeit geführt hat, die das einzige Mittel gegen solche Katastrophen ist.
Wir sprechen nicht von der Wachsamkeit der Autobuspassagiere, sondern von der Wachsamkeit ihrer Chefs. Und von der Wachsamkeit aller anderen. Man hat den Schultransport mit Autobussen auf eine breitere Basis gestellt. Man muß nun auch die Überwachung jener Fahrer, die Kinder transportieren, besonders intensivieren und verschärfen.
Nicht, weil Kinder bessere Menschen, sondern deshalb, weil sie nicht in der Lage sind, die automobilistische Unzurechnungsfähigkeit eines Lenkers zu erkennen. Weil-sie nicht die Autorität haben, ihn zurechtzuweisen. Weil sie, mit einem Wort, wehrlos sind.
Die Untersuchung, ob der Chef des toten Fahrers gewußt hat, gewußt haben müßte, bei entsprechender Sorgfalt gewußt haben muß, daß Gefahr drohte, kann nicht scharf genug geführt werden. Ein Exempel ist fällig.
Ende eines Rummels?
Filippo Ravizza, Werbechef der Mailänder Sparkasse, rief 1924 den Weltspartag ins Leben, der seither alljährlich am 31. Oktober begangen wird. Natürlich auch in Österreich. Aber was hat sich seither aus dieser guten Idee entwickelt? Ein Prater-rummel. Tausende und Abertausende von Menschen stürzten sich in die Banken und Sparkassen, um einige Schillinge einzulegen, weil sich der Usus eingebürgert hat, den Sparern je nach Größe ihrer Einlage ein entsprechendes Geschenk zu überreichen: Tintenkulis, Schlüsselringe, Plastiktaschen. Gegenstände, die an sich nicht viel wert sind, aber die Banken und Sparkassen doch Millionen kosten dürften. Die Erste österreichische Spar-Casse hat nunmehr nach Ideen gesucht, um diesen Jahrmarktrummel abzuschaffen. Nach Ideen, die ein sinnvolles Sparen fördern. An Stelle von Schlüsselanhängern, Maßbändern und Telephonregistern hat sie bunte Premiensparbücher für Kinder und Jugendliche geschaffen, die jetzt aus Anlaß des Weltspartages zur Ausgabe kommen. Sie wurden von den besten Illustratoren Österreichs gezeichnet. Und jedes Kind, jeder Jugendliche wird ein solches Sparbuch gern zur Hand nehmen. Außerdem legt die Erste österreichische Spar-Casse für jedes eröffnete Prämiensparbuch zehn Schilling auf ein Sonderkonto. Aus diesen Geldmitteln sollen nach den Wünschen der Kinder und Jugendlichen Sportgeräte für Wiener Schulen angeschafft werden.
So werden die bunten Bücher die Kinder veranlassen, mit mehr Vergnügen zu sparen. Denn wenn die heutigen Kinder einmal erwachsen sein werden, dann werden sie mit vielen Dingen wesentlich sparsamer umgehen müssen als es die heutigen Erwachsenen tun. So wird mit dieser Aktion die pädagogische Aufgabe von Eltern und Lehrern sinnvoll unterstützt. Und ein erster Schritt zur Abschaffung dieses Jahrmarktrummels ist endlich getan.
Lektüre
Nicht nur die Österreicher, auch die Jugoslawen lesen zu wenig. Der Unterschied liegt nur darin, daß die Österreicher überhaupt zu wenig lesen, die Jugoslawen zu wenig kommunistische Literatur. Alles andere konsumieren sie in staunenswerten Massen, Romane vor allem, oder, wie ja anderswo auch, Unterhaltungsund Kitschzeitschriften, dazu Striphefte und Illustrierte in den sprichwörtlichen rauhen Mengen. Die Parteipresse vegetiert demgegenüber am Rande des Existenzminimums. Die „Borba“, einst das führende Organ, erscheint in einer Auflage von knapp 14.000 Exemplaren, und nur noch 230.000 Genossen von den 1,2 Millionen Mitgliedern des „Bundes der Kommunisten Jugoslawiens“ zeigen mehr oder weniger zwangsweise Interesse für das Zentralorgan ihrer Partei, den Belgrader „Kommunist“.
Wohin führt diese Entwicklung? In Österreich, das ist nicht schwer zu erraten, zum Schwachsinn. Aber in Jugoslawien —?
Messezeit
Die Stadt München — verkörpert durch ihre Messe- und Ausstellungs-gesellschaft — stellte in Wien ihre Messepläne für das nächste Jahr vor. Natürlich werden wir von ihr notorisch überflügelt, aber das soll uns nicht verdrießen. Interessant aber erscheint uns ein Satz, der zwischen Gastgewerbe-Fachausstellung und „Inhorgenta“, zwischen Handwerksund Ernährungsmesse fiel.
Es ist der Satz von der besonderen Messewiliigkeit vieler Wirtschaftszweige gerade in Zeiten nachlassender oder stagnierender Auftragslage.
Branchen, die hart kämpfen, bringen den Messegesellschaften die größten Zuwächse. Beispiele: Die Bauwirtschaft und die Bekleidungsindustrie.
Wobei das Repräsentationsgehabe durch ein nüchternes Kosten-Nutzen-Denken verdrängt wird. Aber nüchternes Kosten-Nutzen-Denken spricht offensichtlich für Beteiligung an Messen, bei denen ein internationales Fachpublikum zu erwarten ist.
Bemerkenswert auch für Wien, wo das Messegeschehen seit Jahren mehr in aus- als in eingefahrenen Gleisen fortwurstelt. Die schlechte Wirtschaftslage ist hier also keine Ausrede mehr. Im Gegenteil. Sie sollte Ansporn sein, auch an der Donau aufzuwachen.
Scherben, made in USA
Die amerikanische Diplomatie hat wieder einmal Porzellanscherben produziert. Das zerschlagene Geschirr hieß — vor seiner Zerstörung — Nichteinmischung eines Botschafters in die inneren Angelegenheiten seines Gastlandes. Wobei man die tiefe Abneigung des amerikanischen Botschafters in Rom und seines obersten Chefs in Washington gegen eine kommunistische Machtübernahme oder auch nur Regierungsbeteiligung in Italien durchaus verstehen kann. Aber seine — in einem Interview mit der italienischen Zeitschrift Epoca gefallene — Äußerung, schon eine kommunistische Regie-rungsbeteiligung in einem NATO-Land schaffe einen grundsätzlichen Widerspruch mit der Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis, alarmiert auch jene, die auf die demokratische Verläßlichkeit der italienischen Kommunisten nicht gerade Häuser bauen möchten.
Aber hat Botschafter Volpe mit seinem diplomatischen Schuß vor den kommunistischen Bug etwa den Vormarsch der Kommunisten gestoppt, glaubt er, irgendeine Wahl beeinflussen zu können? Vielleicht kann er es. Aber sicher nur, über zusätzliches antiamerikanisches Ressentiment, 'zugunsten der Kommunisten. We,nn sich jemand über diesen unklugen, undiplomatischen und unkorrekten Kraftakt freuen darf, dann sie, die Kommunisten.
Um so schlimmer, wenn die Äußerungen des Botschafters tatsächlich „Wort für Wort“ mit dem stellvertretenden US-Außenminister abgesprochen waren. Um so schlimmer, wenn dies demnach auch für jene Stelle gilt, wo Volpe erklärte, die USA könnten „die Errichtung eines Regierungssystems nicht begünstigen, das der Tradition der westlichen Demokratie fremd ist.“
Alle potentiellen kommunistischen Wähler Italiens verstehen unter „nicht begünstigen“ nämlich CIA, verstehen amerikanisch gelenkten Putsch von rechts, verstehen gewaltsamen Eingriff in die italienische Innenpolitik.
Wenn die USA die Entstehung eines Bürgerkriegskliimas in Italien beschleunigen wallten, dann, ja dann, hat der Botschafter zweckmäßig gehandelt.
Keine Empfehlung
Einer der führenden Kommunisten Großbritanniens, der Gewerkschaftsfunktionär Arthur Scargill, ist verärgert. Verärgert duch Kommunisten, und zwar durch bulgarische. In Bulgarien, und das kommt davon, hat Mr. Scargill seinen Urlaub verbracht. „Wenn das Kommunismus ist“, sagte er nachher, „dann können die im Osten ihn'behalten.“ Die Touristen seien in halbfertigen Hotelzimmern untergebracht worden, hätten für serviertes Gemüse das Neunfache des Marktpreises zahlen müssen und zu wenige Lebensmittelgutscheine (das gibt es dort!) hätten sie zugeteilt erhalten. „Auf diese Weise“, fuhr Scargill fort, „werden sie mehr Kapitalisten erziehen, als ich hier im Westen je gesehen habe.“
Und noch eins: Im Restaurant habe man vom Personal nur mit Mühe Wechselgeld, die Herausgabe nämlich auf den Rechnungsbetrag, erhalten können. Also bitte, um das zu erleben, hätte der für sozialistische Askese offenbar ungeeignete Brite gar nicht so weit fahren müssen.
In was für einer Traumwelt lebt er?
Dazwischen
Der Nationalfeiertag lag zwischen Johann Strauß und Johann Strauß. Zwischen „Aschenbrödel“ und dem Preislied, das Marcel Prawy ,auf den Regenten des österreichischen Jahres 1975 sang. Das Ballett „Aschenbrödel“ sah man am Vorabend des Tages unserer Fahne und hörte dazu, vom ORF-Symphonieorchester gespielt, (angeblich) zum. ersten Mal die Musik nach der Originalpar-titur. Nun ja. Eduard Hanslick, mit seinem treffsicheren Instinkt für das Verkehrte, soll Johann Strauß geraten haben, doch endlich einmal die Musik für ein abendfüllendes Ballett zu schreiben. Das tat Johann Strauß, und was dabei herauskam, klingt, von zwei oder drei Einfallen abgesehen, wie lauwarm aufgekochter Delibes. Das ursprüngliche Buch muß, wie so oft bei Johann Strauß, schauderhaft gewesen sein und wurde denn auch von E.,A. Ekker nach einer Idee von Herbert Kollmann zum „Rosaroten Prinzen“ umgeschrieben; die Handlung findet nunmehr zur Zeit des Wiener Kongresses statt, Aschenbrödel ist Ladenmädchen bei einem marchand de modes (und nicht in einem „salon des modes“, wie der Neoautor glaubt; französisch sollte man halt können). In der Koproduktion des Magyarischen TV mit dem ORF und zahlreichen östlichen Anstalten, die man uns in FS 1 zeigte, tanzte das Ballett der Ungarischen Staatsoper, das, wie so vieles bei unseren alten Weggefahrten und Freunden im Nachbarland, schon bessere Tage gesehen hat: Für die Hauptrollen hatte man sich Lilly Scheuermann und Michael Birkmeyer vom Wiener Staatsopernballett geholt, und sie waren, hochgezüchtet, elegant und überlegen, eine Augenweide. Es geht doch nichts über westliche Dekadenz! Man sah von innen und außen herrliches Barock aus Eszterhäza bei Fertöd, aus Wien und aus der Wachau, man sah die von den Produzenten für barock gehaltene Kaasgrabenkir-che und man sah schließlich den geistvollsten Mann seiner Zeit, den „rosaroten Prinzen“, den Fürsten de Ligne nämlich, als senilen Trottel dargestellt. Denn, daß Fürsten von Geburts wegen dumm zu sein haben, das weiß, zum Ruhme der heute allenthalben herrschenden Neuen Klasse, nicht nur der kommunistische kleine Moritz, das lernt man anstelle eines reduzierten Geschichtsunterrichts ja auch bei uns in der Schule.
Am Nationalfeiertag das Land der Österreicher mit der Seele suchend, gelangt der Wiener, sofern Manifestationen abhold, fast unfehlbar in den stillen Bereich des Oberen Belvedere, wo es heuer ein erstes restauriertes Stückchen der geretteten Beethoven-Fresken Klimts zu bestaunen gab. (Als die FURCHE vor Jahren ein Detail dieser Kostbarkeit reproduzierte, bestellte eine Dame das Blatt ab. Von wegen Pornographie. Die Rührende hatte Zeit ihres Lebens noch kein Kunstwerk gesehen.) Auch die soeben eröffnete Musiksammlung der Nationalbibliothek lockte, mit dem Nachlaß Kaiser Leopolds I., der unschätzbaren Stiftung van Hobokens, den jüngstens aufgenommenen Manuskripten von Egon Wellesz und einer im Studio mitzuerlebenden Unterrichtsstunde Prof. Robert Schollums.
Und der Tag kam zum guten Ende mit „Johann Strauß“ von und mit Marcel Prawy. „Prawy loben“, so stand einst in dieser Rubrik zu lesen, „hieße Arien in die Oper tragen.“ Dem ist auch heute nichts hinzuzufügen.



































































































