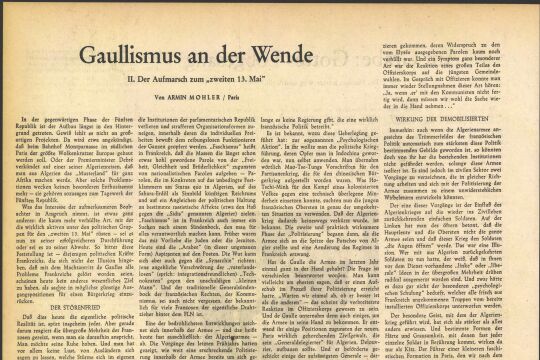Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Randbemerkungen zur woche
NUN IST DIE ARENA ABGESTECKT, in der die österreichischen Parteien zum Kampf um die Stimmen der Wähler entreten werden: am 22. Februar 1953 wählt Österreich eine neue Volksvertretung. Wird aber das Schauspiel des Wahlkampfes, der vor diesem neuen politischen Lostag vor den Augen desselben Wählers ausgetragen wird, wirklich einem edlen Wettstreit gleichen oder vielmehr Ähnlichkeit mit dem haben, was die wilden Männer auf dem Wiener Heumarkt den „freien Stil“ nennen? Nur unverbesserliche Optimisten wagen nach den Erfahrungen der letzten österreichischen Wahlgänge weder einmal zu hoffen. Noch dazu, wo soeben in der großen Demokratie des Westens, den Vereinigten Staaten, ein Wahlkampf beendet wurde, der von den gleichen „fouls“ nicht frei war, die dem Österreicher bei der Austragung seiner innerpolitischen Meinungsverschiedenheiten so sehr mißfallen. Wenn es in Amerika möglich war, sowohl Eisenhower faschistischer Neigungen zu verdächtigen und Stevenson mangelnde Immunität gegenüber kommunistischen Aspirationen nachzusagen, dann laß fahren dahin, laß fahren — die Hoffnung nämlich, daß die österreichische „Linke“ und die österreichische „Rechte“ auf solche schartige Waffen aus dem Arsenal der Vergangenheit endqjiltig verzichten werden. Und trotzdem: ganz taub ist man nicht in den politischen Generalstäben gegenüber der einmütigen Abneigung der großen Mehrheit aller Österreicher gegenüber blindwütiger Parteienleidenschaft und bedenkenloser Diffamierungskampagnen. Als nach den Nationalratswahlen 1949 eine Jungakademikerzeit- :chrift von einem „Pyrrhussieg der Plakatkrieger“ schrieb, brachte ihr dies wenig Wohlwollen von parteipolitischer Seite ein. Allein in der Zwischenzeit reifte die Einsicht und die jüngsten Äußerungen von maßgebenden Männern verschiedener Parteien für einen fairen Wahlkampf sind bekannt. Richtige Erkenntnisse! Nur dürfen sie nicht in den nächsten Wochen und Monaten im Trubel des Gefechts wieder untergehen. M
ES STEHT NICHT GUT um den Kulturstaat Österreich, wenn schon international bekannte Wissenschaftler und Künstler mit „gewerkschaftlichen Maßnahmen“ drohen müssen, falls ihre Forderungen auf Sicherung der Existenz von Wissenschaft und Kunst nicht erfüllt werden. Der Notring der wissenschaftlichen Verbünde mußte — wieder einmal — eine lange Liste von Beschwerden vorlegen, von Maßnahmen, die versprochen und nicht erfüllt worden sind, und von Selbsthilfeaktionen, die man verhinderte. Er berichtete von den 1,25 Millionen, die er für Drucksubventionen und Beiträge zur Finanzierung von Einladungen ausländischer Gelehrter ausgeben konnte. Aber von dieser Summe stammten nicht einmal vierzig Prozent von der öffentlichen Hand, der Rest war zusammengebettelt. „Vom Betteln kann aber die Kultur nicht existieren!“ betonte Professor Marinelli. „Wenn ich meinem Sohn die Straßenbahn zahle, wenn ihm jemand anderer eine Opernkarte schenkt, dann handle ich so, wie der Finanzminister gegenüber der Kultur!“ Und als man sich selbst helfen wollte, als man die Jugend aufrufen wollte, an einem Tag der Wissenschaft und Kunst für die Erhaltung der Kultur zu sammeln und eine Landesregierung diesen Vorschlag schon aufgriff, wurde er verboten, weil man die Jugend nicht zu sehr belasten dürfe. Oder als man beim Kauf eines Buches oder bei der Ausfüllung eines Totoscheins durch eigene Klebemarken geringfügige Summen für die Kultur abzweigen wollte, die in ihrer Gesamtheit genügt hätten, zahlreiche wissenschaftliche Werke drucken zu lassen, da wurde dieser Vorschlag wieder abgelehnt. Sieht man die Wissenschaft als Ware an, die keinen materiellen Gewinn bringt? Wo wäre heute die deutsche oder die amerikanische chemische Industrie, wenn ihr nicht die Grundlagenforschung die Basis zum Arbeiten geben würde? Gewiß, Forschen kostet Geld, aber vom Ausland die dort vielleicht von österreichischen Forschem gemachten Erfindungen kaufen müssen, kostet noch bedeutend mehr. Und Kulturexport, der sich nur auf die Ausfuhr von fähigen Nachwuchskräften und bereits international bekannten Wissenschaftlern beschränkt, ist erst recht ein Verlustgeschäft. Aber wie dem abhelfen, wo Österreich doch so arm ist? Ein Zwanzig-Milliarden-Budget bietet immer noch die Möglichkeiten, die 300 Millionen VMterzubringen, die die Kultur insgesamt für sich fordert und mit denen sie wenigstens ein notdürftiges Ausreichen finden würde. Aber diese 1,5 Prozent müssen von Anfang an in das Budget eingebaut werden, unter den Posten, die als unabweisbar berücksichtigt werden müssen. Die Kultur darf nicht unter „ferner liefen“ abgespeist werden, denn sonst tritt ein, was Professor Kerschaftl in der letzten „Univer- sitätszeitung“ prophezeite, daß Österreich zu einem Volk der Heurigensänger und Gladiatoren wird, das Nobelpreise nur mehr im Fasselrutschen oder in Damenfreistilringkämpfen anstrebt.
DER WILDE MANN an Stelle des gemäßigten, kompromißbereiten, einsichtsvollen: so sah es das Ausland, so sahen es auch viele deutsche Katholiken, als vor kurzem Fette den Vorsitz des Deutschen Gewerkschaftsbundes an Walter Freitag, den früheren „Boß“ der unruhigen und kampfeslustigen Metallarbeitergewerkschaft, abgeben mußte. Nun melden sich aber auch aus der deutschen katholischen Arbeiterbewegung Stimmen, die ein etwas anderes Bild des neuen Mannes an verantwortlicher Stelle zeichnen. Zwar wisse Walter Freitag genau, was er will. Aber sein Eigensinn und seine Standfestigkeit hätten ihre Grenze in der praktischen Einsicht in das, was getan werden kann. Er sei ein Mann der praktischen Arbeit, nicht ein Mann doktrinärer Ideologie. „Wenn der Arbeiter im Lande durch gewerkschaftliche Maßnahmen mehr Nachteile als Vorteile davonträgt, oder wenn er nicht mehr klar die Richtung des gewerkschaftlichen Kampfes kennt, dann ist es Zeit, diese Maßnahmen und ihr Ziel zu überprüfen“, hat er einmal gesagt. Und aus diesem Grund habe er die Politik Fettes abgelehnt, nicht weil sie ihm zu gemäßigt erschien, Wie wird der heute 63jährige, der seit 1906 Mitglied der SPD ist, zu den christlichen Gewerkschaftern stehen? Man weiß, daß ihn seit der Zeit, da er selbst Bezirksleiter des Ennepe-Ruhr-Kreises der IG Metall war, mit dem früheren dortigen Bezirksleiter des Christlichen Metallarbeiterverbandes Wilhelm Alef eine herzliche Freundschaft verbindet. Und auf die Frage eines Journalisten, was er am liebsten rauche, antwortete er: „Zigarren, aber keine selbstgekauften, sondern die, die mir mein Freund Fächer (Führer der christlichen Gewerkschaften. D. Red.) schenkt.“ Nun, da- mit kann man keine Gewerkschaftspolitik machen. Aber immerhin, als ihn seine SPD- Freunde auf den wachsenden Einfluß christlicher Gewerkschafter aufmerksam machten, meinte er: „Bei denen weiß ich wenigstens, woran ich bin; bei den meisten ändern weiß ich das nicht.“ Leute, die ihn zu kennen glauben, sagen, daß er genau wisse, welche Belastung er sich gesundheitlich Zutrauen dürfe. Die nicht geringe Zahl der der Gewerkschaftsidee aufgeschlossenen deutschen Katholiken hofft, daß er, der für sich keinen Arzt haben will, auch in seinem neuen Amt seine und des DGB Grenzen kennt und achtet und daß es nach seiner Amtszeit keines Arztes bedarf, der die Einheitsgewerkschaft wieder zusammenflicken müßte.
KOMMT DER „DE GAULLE GRIECHENLANDS“ an die Macht? Die griechischen Neuwahlen am 16. November werden Antwort auf diese Frage geben. Der erste Griff, am 9. September 1951, war dem ehemaligen Feldmarschall Papagos mißlungen. Die Wahlen brachten ihm zwar 114 von v258 Sitzen und 35,5 Prozent aller Stimmen ein, aber die alten Parteien seiner Gegfier Venizelos und Plastiras erwiesen sich als so widerstandfähig, daß sie, und nicht der Marschall, die Regierung bilden konnten, wenn auch nur mit einer Mehrheit von drei bis sechs Stimmen. Der Marschall hat, wie sein französischer Parallelfall De Gaulle, jede Koalition abgelehnt. Er will seiner Griechischen Sammlungsbewegung die absolute Mehrheit erkämpfen. Er tritt in die zweite Runde unter verbesserten Bedingungen ein. Er hat das Mehrheitswahlrecht durchgesetzt und gute Verbindungen zu interessierten amerikanischen Kreisen, die darauf hinarbeiten dürften, daß die Dollarhilfe, die von 225 auf 180 Millionen gekürzt worden ist, einem Regierungschef Papagos annähernd ungekürzt gewährt würde. Freilich könnte ihm die Freundschaft des amerikanischen Botschafters in manchen Kreisen schaden. Auch bleibt sein Verhältnis zum Hof gespannt. Der König hat starke Zurückhaltung gegen den Marschall geübt und sich seinerseits kräftig den Amerikanern genähert, die bei der letzten Wahl auf den Marschall gesetzt hatten. Damals war eine Königskrise nicht ausgeschlossen, wenn der Marschall gesiegt hätte. Jetzt haben sich die Gemüter etwas abgekühlt. Die Liberalen von Venizelos und die Fortschrittspartei des Generals Plastiras sind nun auch für Neuwahlen, denn sie hoffen, daß nach der Revision der 10.000 Kriegsgerichtsurteile gegen Linksgerichtete die zehn Mandate, die im September 1951 den getarnten Kommunisten zufielen, diesmal ihnen gehören würden. Die Lage gleicht etwa jener von 1936, als Metaxas ans Ruder kam. Die elf Jahre Krieg und Bürgerkrieg haben ihre traurigen Spuren tief eingegraben. Das ist die Situation, in der zu jeder Zeit der Ruf nach dem „starken Mann“ laut wurde und laut wird
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!