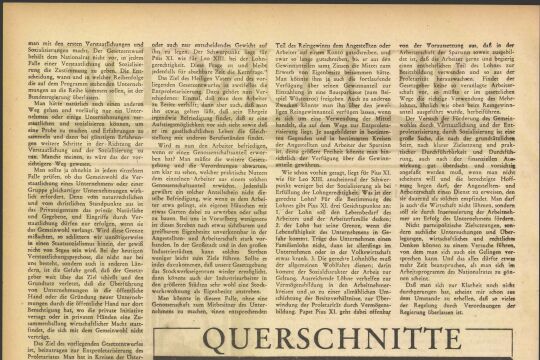SYMPATHISCH muß diese auf dem Reißbrett entworfene Militär- und Bürokratenstadt schon damals nicht gewesen sein, als Kaiser Joseph II. sie um die Festung herum anlegen ließ. Sie erhielt 1784 den Namen seiner vor kurzem verewigten Mutter: Maria Theresia. Man behauptet, sie sei als militärischer Hauptstützpunkt einer nach Norden gerichteten Verteidigungslinie geplant gewesen. Aber sie hat diese Funktion nie erfüllt. 1866 wurde die Festung zum letztenmal mobilisiert. Versprengte preußische Patrouillen umritten sie — aus der Richtung Königgrätz kommend. Ein Ausfall der Besatzung stieß ins Leere. Der Waffenstillstand war bereits geschlossen worden. Die Festung war schon im 19. Jahrhundert zum Selbstzweck geworden: zu einer Idee der Ordnung an sich, zur Verkörperung des Reglements. Und schon damals verbanden die Bürger der Monarchie mit dem Namen Theresienstadt nicht nur den Begriff von Garnisonslangeweile, sondern auch den der Haft und Strafe. Einer der ersten politischen Häftlinge in diesen Mauern war der griechische Fürst Ypsilanti — ein Empörer gegen die „legitime Obrigkeit" des Biedermeiers, die nach dem Willen der Heiligen Allianz für ihn in Istanbul saß.
MERKWÜRDIG: man spürt selbst heute noch diese unterste historische Schicht von Theresienstadt, so verschollen sie für die Generation dieser Tage sein mag. Das „k. u. k." — sonst so gern als Kaisergelb und Ringstraßenabglanz gefeiert — hier hat es sich in seinen unsympathischesten Zügen verewigt. Und doch sind die Kaffeehäuser auf dem liuealgezogenen Hauptplatz mit den rührenden staubiggrünen Anlagenbeeten zeitunberührt geblieben. Ob die derzeit dort garni- sonierten Leutnants noch Zeit haben, durch die großen Glasfenster mit promenierenden Damen zu kokettieren, ist zweifelhaft. Daß die heutigen Obristen keine „Neue Freie Presse" und keine „Muskete“ mehr zum schwarzen Kaffee vorgelegt bekommen, steht fest. Aber irgend etwas davon ist als ein Hauch — gemischt aus Pfeifentabak, Lederschweiß, Dienstmädchenparfüm, ärarischer Aktentinte und Würstelsaft — zwischen den Mauern haften geblieben. Man kann es sich einfach nicht gleich beim ersten Eindruck vorstellen, was hier zwischen 1941 und 1945 geschehen ist, vor allem, wenn man die Stadt von früher her kannte. (Sie war ja auch in der guten „Ersten Republik" von Prag unverändert Garnison und im Festungsbereich Militärgefängnis gewesen.) Und dieselben, höflich das Deutsche radebrechenden Einwohner, die von der seriösen — zu einem gewissen Teil auch von der weniger seriösen Erfüllung der verschiedensten natürlichen Bedürfnisse der Soldaten lebten, waren nach 1918 dageblieben. Für sie hatte sich bis auf die Kommandosprache und die schnell zu erlernenden Uniformdistinktionen nichts geändert. Nicht einmal dann, als nach Hitlers Besetzung der CSR statt der abziehenden tschechischen nun wieder deutsche Soldaten - diesmal die Wehrmacht - kamen.
Auch sie bevölkerten die Kaffeehäuser, Gaststätten (mit augenzwinkernd aufgebesserter, markenfreier Kost), auch sie knüpften jene klassischen Kontakte an, die eben einmal das Charakteristikum der Garnisonen darstcllen.
WAS ABER DANN GESCHAH, im Spätherbst 1941, das wissen wir zwar sehr genau aus den Dokumenten. Wir können es uns erzählen lassen, von denen, die überlebten. An der Stadt selbst scheinen die vier Jahre, da sie als Getto fungierte, spurlos vorübergegangen zu sein. Man muß seine Phantasie anstrengen, um sich das alles bildhaft vorzustellen: die von Menschen buchstäblich überquellenden Häuser, die auf der Straße zusammenbrechenden Hungergestalten, die Transporte der Leichen entweder zum Hauptkrematorium oder zum „Ersatzkrematorium" in einer Ziegelei. Man muß an sie denken, an die vielen kultivierten, schöngeistigen, ironischen Persönlichkeiten der guten jüdischen Gesellschaft des alten Prag, die hier nicht im Kaffeehaus saßen und über den friedlichen Platz schlenderten, sondern fast ohne Medikamente unter den entsetzlichsten hygienischen Bedingungen auf faulem Stroh in den Kasernenschlafsälen langsam dahinsiechten. Man muß sich die Bilder vors Auge halten, die hier gemalt wurden, von zehn- und elfjährigen und noch jüngeren Kindern mit Farbstiften in Schulhefte gezeichnet: Särge, Flammen, Stacheldraht, verzerrte Leichen, (hn jüdischen Museum zu Prag kann man sie hinter Glas und Rahmen besichtigen.) Und das alles muß man hineinversetzen in diese kleine „kaka- nische“ Garnison des Kaiser Joseph . .. Man kann es nicht. Vielleicht soll man es auch gar nicht. Die Prager Regierung von heute hat dafür gesorgt, daß die ,1941 durch die deutschen SS- Behörden über Nacht ausgesiedelten Tschechen, die den Gettoinsassen Platz machen mußten, wieder zurückkehrten. Neue, kleine Siedlungsstraßen sind entstanden. Man spricht und schreibt nicht mehr allzuviel von der spezifisch-jüdischen Tragödie, die sich in Theresienstadt selbst, der sogenannten „Großen Festung“, vollzog. Die jüdische Kultusgemeinde will aus eigenen Mitteln wenigstens eines der Massenquartiere von damals als ein makabres Museum einrichten. Die nach Zehntausenden Zählenden, die hier starben, waren ja keine politischen Märtyrer im strengen Sinn des Wortes. Es waren die Alten, die Schwachen, die Kinder, die hierher gebracht wurden, ohne Rücksicht auf Gesinnung und Herkommen. Wer arbeitsfähig war, wanderte ohnedies im Transport weiter nach Polen und in die Vernichtungslager. Nur die, für die sich die Beförderungskosten nicht mehr lohnten, ließ man hier zugrunde gehen. Man kann ihre Namen lesen, wenn man nach Prag kommt. In der Pinkas-Synagoge hinter dem uralten jüdischen Friedhof stehen sie in winzig kleiner Schrift an den hohen, weißen Wänden. Nach Herkunftsort und Alphabet geordnet, mit Geburts- und Sterbedatum …
DIE ASCHE DER 30.000 auf dem „National-Friedhof“, der sich vor der Kleinen Festung hinzieht, ist die von antifaschistischen Kämpfern, politischen Gefangenen keineswegs nur jüdischer Herkunft. (Aus dem Getto wurden die Überreste von 886 Menschen hierher transportiert.) Sie wurden entweder in der Festung selbst hingerichtet oder einfach umgebracht, oder sie gingen bei den Arbeitskommandos in den Schächten und Steinbrüchen der Umgebung zugrunde. Oft ruhen hundert Menschen unter einer einzigen Steinplatte. Man konnte die Reste der Krematorien nur sehr müh-
sam identifizieren. Die SS-Komman- dantur ging später dazu über, die mit bürokratischer Pünktlichkeit aus dem Krematorium angelieferten Pappschachteln mit der Asche einfach in den Fluß zu schütten oder in die Gegend zu streuen. Es waren zu viele, und man hatte Dringenderes zu tun. Gerade, daß man noch die Abgänge registrierte.
DIE „KLEINE FESTUNG“ war das eigentliche Konzentrationslager. Unmittelbar nach der Besetzung Böhmens und Mährens durch die Truppen Hitlers im März 1939 ging hier die Hakenkreuzflagge hoch. Wenige Monate später waren die Polizeigefängnisse in Prag und anderen Städten des sogenannten „Protektorats“ so überfüllt, daß man einen Sammelpunkt für die sogenannten Schutzhäftlinge suchen mußte. Die Festung Theresienstadt bot sich als ideal an. Nach Zehntausen- den zählten die Menschen, die hier durchgingen, nach Zehntausenden die, die hier den Tod fanden. Viele sagten, daß sie sogar den Abtransport in ein deutsches KZ oder Zuchthaus als „Erlösung" empfanden. Deutsche Aufschriften sind hier überall stehengeblieben. Schon am Tor steht das aus anderen Lagern bekannte, grausighöhnische „Arbeit macht frei“. Am Ter begann bereits der Leidensweg der Häftlinge. In der Wachtstube und beim „Empfang“ gab es die ersten Prügel und Beschimpfungen, die sich zuweilen zu einem Inferno steigerten, das der eine oder andere nicht überlebte. Wir stehen vor den Verwaltungsbaracken. Ein älterer Mann hält die Führung für eine Gruppe von Betriebsarbeitern. Er spricht sie mit „Genossen" an. Das ist hier so üblich. Die meisten von ihnen werden wohl auch Parteimitglieder sein. Sie hören stumm zu. Manchen von ihnen ist eine echte innere Erschütterung anzumerken. Eine Vergangenheit wird in ihnen wieder lebendig, die man unter der Misere des Alltags fast vergessen hatte. Aber die Regierung will nicht, daß man vergißt, daß man am Ende gar irgend etwas Besseres in der Welt von gestern findet, weder in der Protektoratszeit noch in den Jahren der bürgerlichen „Ersten Republik“ von Masaryk und Benesch. Die ausführliche Führungsschrift, die jeder in der Hand trägt, unterläßt nicht, auf die Mitschuld der ehemals herrschen-
den Bourgeoisie an der Preisgabe der CSSR hinzuweisen. Die Gesichter werden grau und undurchdringlich, wenn der Erklärer davon spricht…
JETZT ERZÄHLT ER VON ROJKO: Er schildert die unwidergeblichen Bestialitäten dieses Schergen mit tonloser Stimme, berichtet von seinen sadistischen Quälereien in der Art eines amtlichen Protokolls. Dann fügt er hinzu, daß dieser selbe Rojko heute in Österreich lebt. (Unser Besuch’ war im Juli vor dessen Verhaftung.) Daß .die CSSR vergeblich seine Auslieferung verlangt habe. Und dann setzt der Führer mit bedauerndem Achselzucken den Schlußpunkt. „Aber er hat jetzt schon wieder Arbeit und Stellung. Er ist Mesner in einer katholischen Kirche" Ein Raunen geht durch die Zuhörer. „Die Kirche“ Niemand ist imstande, die Verdrehung der Tatsachen zu bemerken: Daß Rojko, bevor er SS-Mann wurde, irgendwann einmal als Mesner tätig war, scheint erwiesen. Daß ihn irgendeine kirchliche Instanz heute in einer solchen Funktion beschäftigt, ist natürlich eine Verleumdung. Sollte man selbst an dieser Stätte an die alte Praxis denken: „Es bleibt immer etwas hängen!“?
Wir sehen die Massenzellen mit den Holzpritschen, die niederdrückende Trostlosigkeit der grauen Gewölbe, „In dieser Zelle da hat mäh nach 1943 den ehemaligen Kommandanten Jöckl untergebracht“, berichtet der Führer weiter. „Man hat ihn in Deutschland gefangen und ihm hier den öffentlichen Prozeß gemacht. Er wurde gehängt.“ Dann erzählt er von einem anderen SS-Mann, der ein sachliches Lob erhält. Ein gewisser Hohmann, der den Häftlingen als Lagerverwalter half, wo er konnte, der den Kranken Zusatzlebensmittel zusteckte. Auch er stand als Angeklagter und später als Zeuge vor einem tschechischen Gericht. „Er wurde freigesprochen und erhielt die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Er hat noch in der Pro-
duktion gearbeitet und hat heute eine Rente.“ Einige der Zuhörer nicken. Vielleicht sind ehemalige Häftlinge unter ihnen. „Wer auch immer hier herkam, über den Hohmann hat keiner ein böses Wort gesagt.“
„SEINEN EIGENEN TOD“ starb hier Gavrilo Princip, der Attentäter von Sarajewo. Zusammen mit seinen Gefährten Gabrinovic und Grabesch wurde er den Weltkrieg über hier gefangengehalten. Sie starben im letzten
Kriegsjahr an der Schwindsucht. So düster und hart die Zelle, vor der jetzt tschechische und jugoslawische Ehrentafeln prangen, gewesen sein mag: die Häftlinge dieser verschollenen Zeit hatten wahrscheinlich doch noch das Gefühl, Individuen, einzelne Menschen zu sein. Was aber empfanden die, die den immer wieder verwendeten Kollektivsarg aus verfaultem Holz sahen, der nur zum Transport ins Krematorium diente? Die Menschen, die man in den Wassergräben untertauchte und dort vergurgeln ließ, die man mit Kalkmassen im Steinbruch einfach zuschüttete und lebendig begrub? Von all dem ist die Rede. Kaum einmal hebt der Führer die Stimme. Immer schwerer legt es sich einem um die Brust wie ein eiserner Ring. Die Füße schleppen sich kaum weiter, von Zelle zu Zelle. Einmal stocken wir: Unter all den vielen deutschen Aufschriften sehen wir plötzlich tschechische Plakate: „Spart mit Brennmaterial“, „Spart mit Wasser“. Zwei Aufforderungen, mitten in einer Massenzelle und über einem verfallenen, verrosteten Bunkerofen angebracht. Für wen waren diese Anordnungen bestimmt? Die SS kommandierte hier nur deutsch? Sollten es Überreste jener Jahre nach 1945 sein, von denen hier niemand spricht oder schreibt: als nach Tausenden und Zehntausenden zählende Sudetendeutsche oder auch zurückflutende Soldaten der Wehrmacht — keineswegs nur Schergen der SS — in die kaum verlassenen Häftlingsunterkünfte eingeliefert wurden? Es gibt Dokumente auch über das, was sie hier erleiden mußten. Aber die Frage bleibt unausgesprochen. Neues Grauen wird lebendig: die Hinrichtungsstätte, der berüchtigte „IV. Hof“, ein Exerzierfeld des Sadismus, belebt sich mit den Elendsgestalten, mit einem einzigen Heer ununterscheidbarer Gestalten. Die Menschen vor 1945 und die nach 1945, -sie werden einander ähnlicher gewesen sein, als es manche wahrhaben wollen.
Wir hören Zahlen, immer wieder Zahlen: Man kann das addierte, das multiplizierte Grauen gar nicht mehr verarbeiten. Und man wird die Frage nicht los: Hättest du selbst nicht auch um ein Haar unter denen sein können, die hier elend zugrunde gingen? Wie viele von ihnen haben nur das getan, was praktisch alle taten, wie viele hatten irgendeinen persönlichen Feind, einen Neider vielleicht nur.
NOCH EINMAL GEHEN WIR, nach dem Ende der mehr als zweistündigen Führung, an den Zellenbaracken, die einst für die weiblichen Häftlinge dienten, diesen winzigen Hundekottern vorbei, über den Friedhof, zu Fuß der Stadt zu. Autobus parkt an diesem gewöhnlichen Nachmittag neben Autobus. Aus Böhmen, aber auch aus der deutschen Sowjetzone: Immer neue Menschen steigen aus, gehen durch das Lager und kehren gesenkten Hauptes wieder. Drüben am Horizont zeichnen sich die bizarren und temperamentvoll gerundeten Kegel des böhmischen Mittelgebirges ab. Über den Industriegebieten um Lobositz und Leitmeritz steigt Rauch auf, grauer und schweflig-gelber.
Seine Schwaden ziehen niedrig über das Land. Theresienstadt versinkt im Rücken. Die Berge vor Augen aber liegen im Dunst und Zwielicht. Man sähe so gerne mehr von der Zukunft: Man möchte erfahren, ob dieses Theresienstadt nun wirklich nie mehr eine Stätte der Marter und des massenfachen Todes sein wird, ob die namenlosen Opfer nach 1945 wahrhaft die letzten waren. Die böhmische Landschaft, die böhmische Geschichte gibt nur eine düster-sphinxhafte Antwort.
WENN es nur an den einzelnen Menschen, an jedem allein läge …