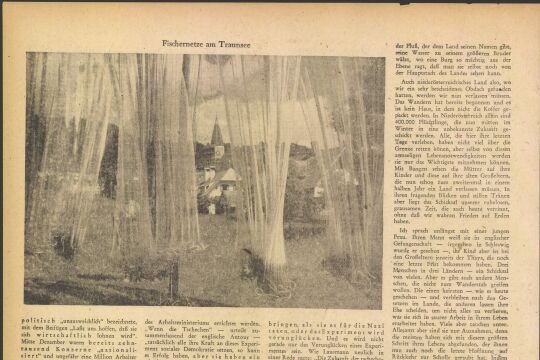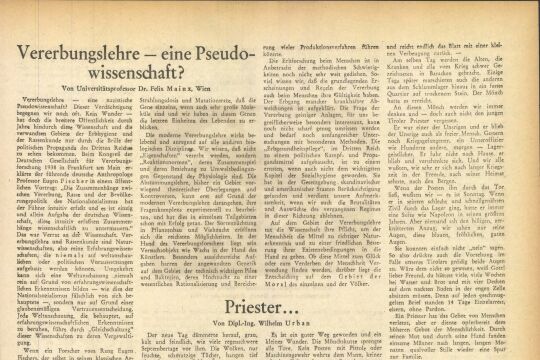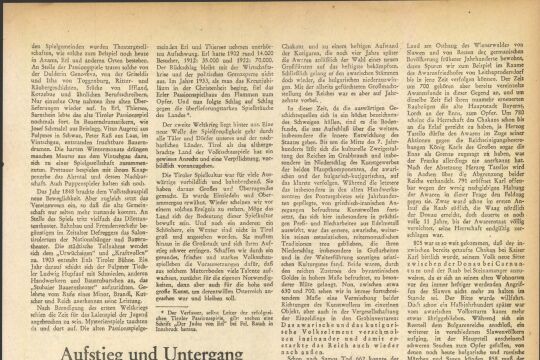Die Schlacht bei Solferino war geschlagen. Vergeblich hatte Benedek am rechten Flügel dreimal die Piemontesen geworfen und das Feld behauptet. Die französische Garde hatte im Zentrum die Spia d’Italia erstürmt, und das österreichische Heer ging zurück, ein Schlachtfeld voll Toter und Verwundeter den Siegern überlassend, die dieser Woge des Elends nur ihre spärlichen Ambulanzen entgegensetzen konnten. Aus dem Anblick dieser Leiden hat Henri Dunant den Ruf zur Gründung des „Roten Kreuzes" vernommen. Jeder folgende Krieg brachte eine Vergrößerung des Schauplatzes, eine Vervielfachung der Kämpferzahlen und damit der Opfer: 1866 — 1870 — 1914. Die Aufgaben des Roten Kreuzes wuchsen ins Unermeßliche, aber immer fanden sich Hände, bereit, das Leid zu lindern, das andere Hände zugefügt hatten.
Eine verhängnisvolle neue Ära begann vor dreizehn Jahren mit einem heute halbvergessenen Kolonialfeldzug zweiter Ordnung: dem Abessinienkonflikt. Denn er war der erste „totale Krieg“, mit all der bewußten Grausamkeit dieses später berüchtigt gewordenen Begriffs. Der junge Schweizer Arzt Dr. Marcel Junod wurde, als dieser Krieg vor dem Ausbruch stand, ganz unvermutet zum Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes auf abessinischer Seite bestellt, und mit seinen dortigen Erlebnissen beginnt sein erschütterndes Buch „Kämpfer beidseits der Front“ (Europa-Verlag, Zürich), das mit einem Besuch im atombombenzerstörten Hiroshima endet. Vorerst Abessinien: ..Abiet- abiet“, erzählt Junod — „Hab Erbarmen, hab Erbarmen —, es ist wie ein herzzerreißendes Lied, das lauter wird und wieder verklingt. Wie idi auf die schmale Stelle hinauskomme, die den Gipfel des Hügels vom Zufluchtsort des Kaisers trennt, wird der Schrei lauter. Überall unter den Bäumen liegen Menschen. Zu Tausenden liegen sie da. Ich trete näher, erschüttert. An ihren Füßen, an ihren abgezehrten Gliedern sehe ich grauenhafte blutige Brandwunden. Das Leben entflieht schon aus ihren von Yperit verseuchten Leibern." Nicht nur durch Bomben, durch eigene Zerstäuber lassen die feindlichen Flieger dieses Gift abregnen. Am 6. Dezember 1935 geht die erste Stadt unter den Brandbomben von Fliegern in Flammen auf: es ist „nur" das kolonial gebaute Dessie, aber von da an beginnt eine Reihe des Schreckens: das spanische Guernica
Warschau — Rotterdam — Coventry — Aachen und Berlin — sie endet in Hiroshima. Der neue Kriegsgeist manifestiert sich in den Worten, mit denen Marschall Badogilio nach seinem Einzug in Addis- Abeba den Schweizer Arzt empfängt: „Sehen Sie — das Rote Kreuz hätte besser getan, sich nicht in diese Geschichte einzumischen.“
Kaum ist der Vorhang über diesem traurigen Kapitel gefallen, steht Spanien in den Flammen eines furchtbaren Bürgerkrieges. Wieder wird der bereits bewährte Dr. Junod von Genf aus auf den Kriegsschauplatz entsendet, der ein ganzes Land ergreift und zerreißt. Denn es ist ein Krieg ohne Fronten, in jeder Stadt, jedem Haus, jeder Familie gibt es Feinde, die einander mit dem ganzen Fanatismus politischer Gegensätzlichkeit hassen und verfolgen. Es ist schwer — ja fast unmöglich, diese Kämpfer aus Leidenschaft zur Menschlichkeit zu bewegen. Jeder zögert, Miilde zu üben, denn „um seinen Parteigänger in Malaga zu retten, müßte er ja beinahe seinen Feinden in Barcelona verzeihen“. Mit allen Kräften versucht Junod, zu helfen, vor allem den Geiselaustausch zu organisieren. Die beiden Fronten sind nur hundert Kilometer voneinander entfernt. Aber zu den Verhandlungen, die diese Aktion erfordert, muß der neutrale Helfer einen Umweg von fünfzehnhundert Kilometern machen — rund um die Pyrenäen herum. Dr. Junod führt die „Rote-Kreuz-Karte“ ein, das einzige Stück Papier, das von einer Front zur anderen durchdringen kann. „Fünf Millionen solcher Karten werden während des ganzen Bürgerkrieges verzweifelten Angehörigen Nachricht und damit Trost bringen."
Der zweite Weltkrieg bricht aus. Noch ist das „Abkommen über die Gesetze und Ge bräuche des Krieges" vom Jahre 1907 theoretisch in Kraft und damit auch seine nachstehenden Bestimmungen:
Artikel 25: Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude, mit welchen Mitteln es auch sei, anzugreifen oder zu beschießen.
Artikel 46 (betreffend besetzte Gebiete): Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum sowie die religiösen Überzeugungen und gottesdienstlichen Handlungen sollen geachtet werden ...
Feierlich war ja einst der Grundsatz verkündet worden: „Die Kriegführenden haben kein unbegrenztes Recht in bezug auf die Mittel, dem Feind zu schaden."
Wir wissen es, wie diese Bestimmungen im zweiten Weltkriege mißachtet wurden! Die Aufgabe des Internationalen Roten Kreuzes ist nun wahrhaftig erdrückend. Europa gerät in Flammen und seine Hilfsmittel sind: drei Sekretäre, fünf Stenotypistinnen und ein Bankguthaben von 120.000 Schweizer Franken. Aber die Liebe kann wirklich Berge versetzen. Kaum ist die Feuerwalze der deutschen Invasion über Polen hinweggegangen, fährt Dr. Junod „durch die Ruinen des Landes, durch die grauenhafte Not dieser zerstörten Dörfer, dieser umherirrenden Familien, dieser verwahrloster Kinder, dieser wie Tiere zusammengepferchten Männer.“ „Ach, diese Polen“, sagt ihm Generalgouverneur Frank in Krakau, „sie wollen nichts verstehen. Wenn sie vernünftig wären, würden wir ihnen ein gutes kleines Polen mit 14 Millionen Einwohnern einrichten und ihm unseren Schutz angedeihen lassen. Aber sie wollen nichts tun — nicht einmal sich selbst regieren ..." In Warschau „ist die Luft verpestet von einem abscheulichen Fäulnisgeruch. Fünfzigtausend Leichen liegen noch unter den Trümmern oder sind nur oberflächlich in den städtischen Parkanlagen verscharrt.“ Und doch gelingt es auch in diesem verwüsteten Lande, einen Nachfor- schungs- und Korrespondenzdienst aufzubauen, „der bis zum Kriegsende funktionieren wird, mit zwar unterschiedlichen, aber doch positiven Ergebnissen."
Krieg in Frankreich! Gerüchte dringen nach Deutschland, die Franzosen hätten gefangene deutsche Fallschirmspringer füsiliert. Hitler droht, er werde für jeden von ihnen zehn gefangene Franzosen erschießen lassen. Dr. Junod erlangt von den deutschen Behörden zwölf Tage Zeit, die Wahrheit oder Hinfälligkeit dieser Anschuldigung in Frankreich persönlich zu erheben. In einer atemraubenden Jagd eilt der Schweizer Arzt, durch tausende Hindernisse hindurch ins Hauptquartier Petains, besudit Gefangenenlager, befragt Soldaten und Zivilisten und kann in der Nacht des letzten Tages der Frist endlich berichten, daß die verhängnisvolle Meldung irrig war. Die Repressalie unterbleibt.
Mit dem Fortschreiten des Krieges und der Ausweitung seiner Schauplätze wachsen die Aufgaben des Roten Kreuzes in schwindelerregender Weise. Zu Bergen stauen sich in Lissabon die Pakete, die den alliierten Kriegsgefangenen in Deutschland zugedacht sind. Ins unermeßliche steigt die Not der vöm Kriege heimgesuchten Völker Europas.
Dr, Junod erkennt, daß die Lösung dieser riesenhaften, für das Rote Kreuz ganz neuartigen Probleme nur möglich ist, wenn sich diese Institution eine eigene Flotte schafft. Einige Monate spät r furchen große weiße Schiffe mit dem Zeichen des Roten Kreuzes bemalt und unter dessen Flagge den Atlantik und das Mittelmeer. Fahrzeit und Kurs jedes einzelnen dieser Dampfer ist genauestem festgelegt, die kleinste Abweichung wäre ein Verhängnis. Bis 1944 führt diese Flotte mehr als 400.000 Tonnen Lebensmittel — dreiunddreißig Millionen Pakete! — und 1300 Tonnen Medikamente den Notleidenden zu. Fünfhundert Hand- lan0’r und dreihundert Angestellte arbeiten allein in dieser Verteilungszentrale, fast keine Sendung geht verloren: „Um sie auf den belagerten, blockierten, undurchdringlichen Kotinent zu bringen, haben wir die Pforten des Meeres geöffnet.“
Im September 1941 ist die Ernährungstage in Griechenland schlechthin trostlos. Die Sterblichkeit hat sich versechsfacht: „Da und dort (in Athen) sitzen alte, aber auch junge Männer auf den Gehsteigen, mit dem Rücken gegen die Mauer, und bewegen ihre Lippen, als wollten sie eine Bitte aussprechen; doch kommt kein Ton aus ihrem Munde. Ihre H&nde strecken sich manchmal aus, doch fallen sie wieder kraftlos herab. Tagelang bleiben sie so am gleichen Ort sitzen. Eines Morgens hört der eine oder andere auf, sich zu bewegen...“ Die Hilfsaktion scheint unter einem besonders unglücklichen Stern zu stehen. Ein Hilfsdampfer wird trotz des weithin sichtbaren Roten-Kreuz-Zeichens von faschistischen Fliegern im Tiefflug versenkt, ein anderer scheitert in den Dardanellen. Trotzdem werden im Winter 1941 bis zu
800.000 Volkssuppen ausgeteilt, 450 Kantinen verpflegen 100.000 Kinder, 130 Klein- kinderbewahraastalten ernähren 74.000 Säuglinge, der Kreis der Betreuten umfaßt
1,5 Millionen Menschen — sie alle danken Leben oder Gesundheit der Hilfsbereitschaft der Welt, der nie erlahmenden Fürsorge des Internationalen Roten Kreuzes. Als die Not steigt und alle Speicher der Helfer leer sind, legen diese eine Sammlung von hundert so erschütternden Bilddokumenten den Vertretern der Kriegführenden vor, daß Berlin di Ausfahrt von 9 Roten-Kreuz-Schiffen mit einem Ladevermögen von 50.000 Tonnen aus den schwedischen Gewässern zugesteht. Von da an setzt regelmäßige und großzügig bemessene Hilfe ein: 15.000 Tonnen Getreide im Monat erlauben es, an 2,5 Millionen Griechen zweihundert Gramm im Tage zu verabreichen. Hunderttausend Kilo Milchpulver werden hunderttausend Neugeborene am Leben erhalten.
Zu den spannendsten Kapiteln des Budies zählen jene, in denen der Schweizer Arzt seine vielfältigen Interventionen zur Linderung des Loses der in japanische Hand gefallenen Gefangenen schildert. Sie führen ihn auch zu den in unwürdigster Knechtschaft gehaltenen alliierten Heerführern Percival, Starkenborgh und Wainwright.
Drei Wochen nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima liegt noch dichtes Geheimnis über dieser Stätte des Grauens. Man weiß nur, daß ein Taifun von Licht, Hitze und Wind alles vom Boden weggefegt und nur ein Feuermeer zurück- gelassen hat. Ein vervielfachtes Pompeji — nur war es nicht Lava oder Aschenregen, sondern einer auf fünf- bis sechstausend Grad erhitzten Luft zum Opfer gefallen. Für mehr als hunderttausend Verletzte, wird berichtet, fehlt den Behelfsspitälern noch das Allernötigste. Die Amerikaner statten Doktor Junod mit Medikamenten und Sanitätsmaterial aus. Am 9. September 1945 betritt er die Stätte, auf der einen Monat vorher die siebentgrößte Stadt Japans gestanden war. Zur Zeit des Abwurfes der Atombombe war sie noch fast unversehrt gewesen. Als das verhängnisvolle Geschoß fiel, wurden alle Hindernisse, Mauern, Häuser, Fabriken, Vorratslager von einem gewaltigen Windstoß weggeblasen. Alles Lebendige erstarrte in einer Haltung unaussprechlichen Schmerzes. Bäume gehen in Flammen auf, Gras brennt bis zum Erdboden ab wie dürres Stroh. Der plötzliche Auftrieb überhitzter Luft löst erst einen kurzen Regen, dann heftigen Wind aus, der die Flammen der Feuersbrunst immer weiter treibt, bis Hiroshima vernichtet ist. Wem es gelang, dem Feuerkreis zu entfliehen, der starb 20 bis 30 Tage später an der erbarmungslosen Wirkung der Gammastrahlen.
Als der Schweizer Arzt diese Stätte des Grauens betritt, zeigt der japanische Führer, selbst ein bekannter Atomforscher, auf die Überreste einer Mauer, die auf eine Länge von fünfzehn oder zwanzig Meter den Boden kaum überragt: „Hier, Gentleman, stand ein Spital", sagt er, „zweihundert Betten — acht Ärzte — zwanzig Krankenschwestern — alle sind tot...“ „Man kann nicht unablässig von Greueln berichten“, Sagt Dr. Junod von seinem Besuch bei den unzähligen Versehrten. „Man kann nicht all diese vielen tausend ausgestreckten Körper einen nadi dem anderen beschreiben, diese viele tausend aufgedunsenen Gesichter, mit Geschwüren bedeckten Rücken, eitrigen Händen ..Eine einzige Atombombe!
Matt legt das Buch mit dem tiefen Eindruck aus der Hand, ein letztes „Menetekel" an die Menschheit gelesen zu haben. Nein, es kann keine politische Doktrin, kein Staatssystem, keinen wirtschaftlichen Vorteil geben, groß genug, um zu rechtfertigen, daß die Büchse der Pandora eines „modernen" Krieges wieder geöffnet würde!