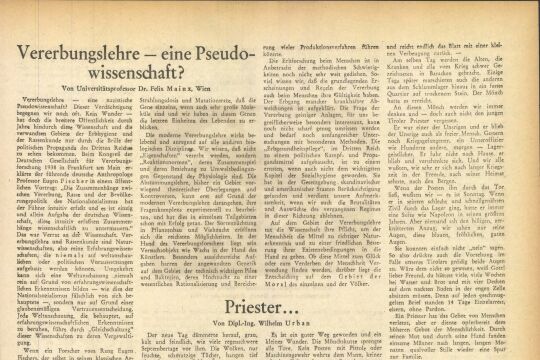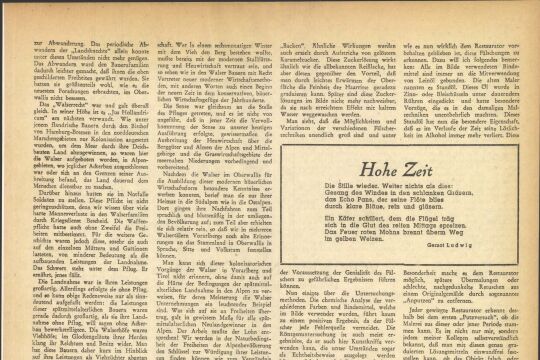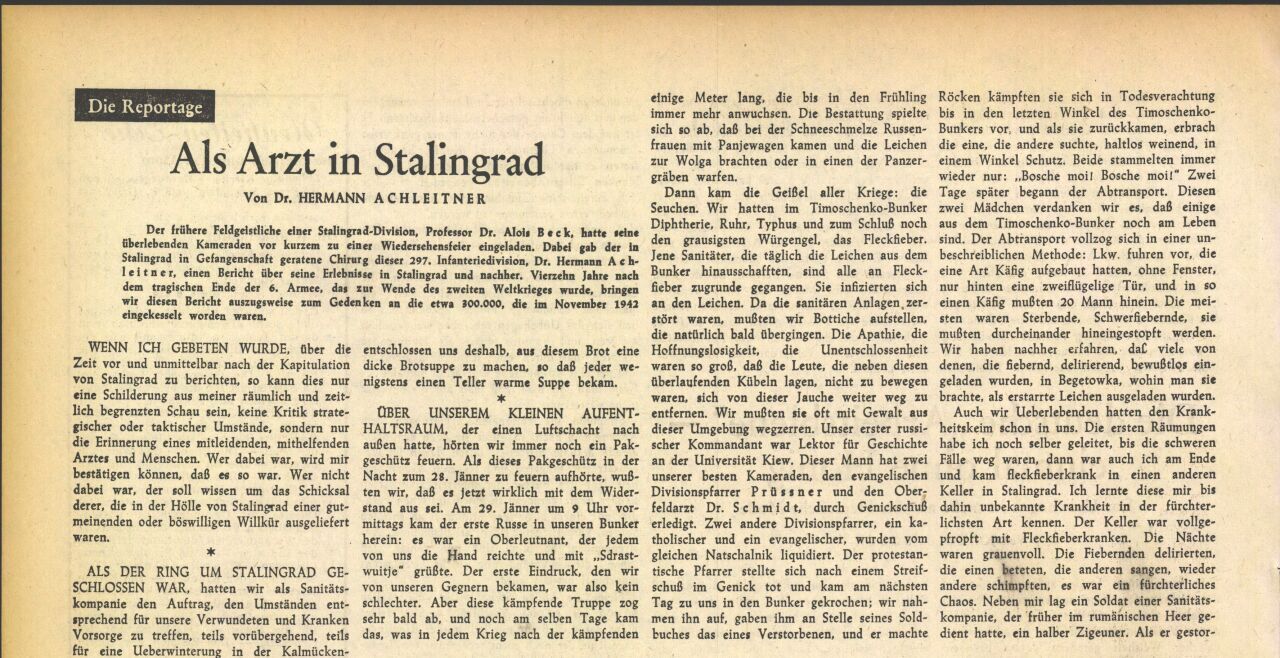
Als Arzt in Stalingrad
Der frühere Feldgeistliche einer Stalingrad-Dlvision, Professor Dr. Alois Beck, hatte seine überlebenden Kameraden vor kurzem zu einer Wiedersehensfeier eingeladen. Dabei gab der in Stalingrad in Gefangenschaft geratene Chirurg dieser 297. Infanteriedivision, Dr. Hermann Achleitner, einen Bericht über seine Erlebnisse in Stalingrad und nachher. Vierzehn Jahre nach dem tragischen Ende der 6. Armee, das zur Wende des zweiten Weltkrieges wurde, bringen wir diesen Bericht auszugsweise zum Gedenken an die etwa 300.000, die im November 1942 eingekesselt worden waren.
Der frühere Feldgeistliche einer Stalingrad-Dlvision, Professor Dr. Alois Beck, hatte seine überlebenden Kameraden vor kurzem zu einer Wiedersehensfeier eingeladen. Dabei gab der in Stalingrad in Gefangenschaft geratene Chirurg dieser 297. Infanteriedivision, Dr. Hermann Achleitner, einen Bericht über seine Erlebnisse in Stalingrad und nachher. Vierzehn Jahre nach dem tragischen Ende der 6. Armee, das zur Wende des zweiten Weltkrieges wurde, bringen wir diesen Bericht auszugsweise zum Gedenken an die etwa 300.000, die im November 1942 eingekesselt worden waren.
WENN ICH GEBETEN WURDE, über die Zeit vor und unmittelbar nach der Kapitulation von Stalingrad zu berichten, so kann dies nur eine Schilderung aus meiner räumlich und zeitlich begrenzten Schau sein, keine Kritik strategischer oder taktischer Umstände, sondern nur die Erinnerung eines mitleidenden, mithelfenden Arztes und Menschen. Wer dabei war, wird mir bestätigen können, daß es so war. Wer nicht dabei war, der soll wissen um das Schicksal derer, die in der Hölle von Stalingrad einer gutmeinenden oder böswilligen Willkür ausgeliefert waren.
ALS DER RING UM STALINGRAD GESCHLOSSEN WAR, hatten wir als Sanitätskompanie den Auftrag, den Umständen entsprechend für unsere Verwundeten und Kranken Vorsorge zu treffen, teils vorübergehend, teils für eine Ueberwinterung in der Kalmückensteppe gedacht. Wir bauten in einer Balka Erdbunker und hatten sie um Weihnachten 1942 herum zu einem fast sanatoriummäßig anmutenden Betrieb ausgestaltet. Wir bekamen noch von der Heimat Lazarettmaterial, Betten, sogar Geschirr, Teller und Eßbesteck. Wiederholt tauchten im Kessel Parolen auf, spätestens im Frühjahr werde eine Sprengung des Ringes uns die Befreiung bringen. Als dieser Ring aber immer enger wurde, mußten wir unser „Sanatorium" in der Steppe kurz vor Weihnachten verlassen und uns in eine noch kleinere Schlucht bei Petschanka zurückziehen, wieder in Erdbunker. Dort feierten wir Weihnachten mit Pferdefleisch und den geringen Gaben, die uns durch die Ju eingeflogen wurden. Kaum hatten wir mit Steppengras den Boden der Bunker ausgelegt — die Betten und die schöne sonstige Ausrüstung des Sanatoriums hatten nun schon die Russen — gab es wieder eine Verlegung, diesmal nach Werchnieschanka, in Holzbarak- ken und Blockhäuser.
AM 21. JÄNNER 1943 erhielt ich von der Division den Befehl, mit einer Gruppe Sanitäter den sogenannten „Timoschenko-Bunker“ zu übernehmen, der angeblich als Lazarett ausgebaut sei. Auch Holzpritschen, Licht und Verpflegung für die Verwundeten solle es dort noch geben. Als ich nach längerem Suchen am Steilufer des Zaritza-Flusses vor dem Eingang zum Timoschenko-Bunker stand, kamen mir die Worte von Dante in den Sinn: „Die ihr hier hineingeht, laßt alle Hoffnung fahren..." Im Stolleneingang biwakierte eine Horde, die dort Feuer gemacht hatte; der Rauch zog sich ins Innere. Auf den Befehl, das Feuer auszulöschert, bekam ich als Antwort ein Hohngelächter. Ich habe mich dann auf das Bitten verlegt, doch Rücksicht auf die Kameraden im Innern zu nehmen, und das hat die Leute doch zur Vernunft gebracht; sie haben das Feuer gelöscht. Als ich weiter eindrang, ein Gebrüll: „Hunger, gebt’s uns was zum Fressen! Wir wollen Brot!“ Ich kam mit leeren Händen. Die Besatzung dieses Bunkers war eine buntgewürfelte Gesellschaft von Kranken, Verwundeten, Drückebergern, Unwilligen. Die erste Aufgabe war, erst einmal diejenigen hinauszukomplimentieren, die nicht hineingehörten: es sollte ja ein Lazarett werden. Die nächste Sorge war das Heranschaffen der Verpflegung. Dieser sogenannte Timoschenko-Bunker war ein Stollensystem mit allen Finessen, in das Felsufer des Zaritza- Flusses hineingehauen; ein Stollen geradeaus, dann ein Viereck mit Nebenräumlichkeiten, Lichtleitung, Wasserleitung, Frischluftleitung, die nackte Felswand geteert und über dieser Teerung noch eine fast fugenlose Holzverschalung, teilweise noch so erhalten, zum Großteil aber verwüstet. Was die Russen bei ihrem Abzug nicht zerstört hatten, war dann von Rumänen restlos vernichtet worden. Es gab weder Wasser noch Licht. Die Holzverschalung wurde verheizt. Schutt und Unrathaufen machten ein Passieren der Gänge fast unmöglich. Dank dem Verständnis der Kommandantur Mitte wurde mir ein Arbeitskommando zur Verfügung gestellt, das die Schuttmassen beseitigte und uns notdürftig eine Lichtleitung legte; glücklicherweise hatten wir unser Aggregat und unsere Sammelbatterien mitgebracht. Die Verpflegung mußten wir uns selber beschaffen Es gab ein wenig Brot, eine ganz dünne Scheibe für jeden; wir entschlossen uns deshalb, aus diesem Brot eine dicke Brotsuppe zu machen, so daß jeder wenigstens einen Teller warme Suppe bekam.
OBER UNSEREM KLEINEN AUFENTHALTSRAUM, der einen Luftschacht nach außen hatte, hörten wir immer noch ein Pakgeschütz feuern. Als dieses Pakgeschütz in der Nacht zum 28. Jänner zu feuern aufhörte, wußten wir, daß es jetzt wirklich mit dem Widerstand aus sei. Am 29. Jänner um 9 Uhr vormittags kam der erste Russe in unseren Bunker herein: es war ein Oberleutnant, der jedem von uns die Hand reichte und mit „Sdrast- wuitje“ grüßte. Der erste Eindruck, den wir von unseren Gegnern bekamen, war also kein schlechter. Aber diese kämpfende Truppe zog sehr bald ab, und noch am selben Tage kam das, was in jedem Krieg nach der kämpfenden
Truppe kommt: die Hyänen. In unseren kleinen Bunker torkelte ein stockbesoffener Feldscher herein, der jedem einzelnen von uns mit der entsicherten Pistole vor dem Kopf herumfuchtelte und Schnaps verlangte. Als wir ihm sagten, daß wir keinen haben, wollte er wenigstens etwas Beute machen und nahm uns unser Aggregat weg, so daß wir ohne Licht waren. Wir hatten noch einige Hindenburg-Lichter. Später mußten wir die Kabel der elektrischen Leitung als Fackeln verwenden; sie rußten und verbreiteten nur wenig Licht. Wir haben bald wie die Schornsteinfeger ausgesehen. Unsere wichtigste Aufgabe war es nun, die seit Tagen, zum Teil seit Wochen nicht mehr erneuerten Verbände über den verschiedensten Wunden und Erfrierungen unvorstellbaren Grades zu erneuern. Es war oft so — ich bitte um Vergebung, wenn Zartfühlende ein Grausen an- fäilt — daß uns, wenn wir die Verbände ab- nahmen, Zehen und Finger im Verband blieben. Mit Schöpflöffeln holten wir aus den Socken die Läuse heraus. Wir hatten Haufen von Läusen, so hoch wie die Ameisenhaufen im Wald; in unserer kleinen Operationskammer an den Wänden Laus an Laus. Die Bettdecke, die als Abschirmung gegen den Gang in die Tür gehängt war, bewegte sich ständig, weil Laus an Laus an der Decke saß. Wir selber stopften uns in den Kragen Mullbinden, die wir immer wieder von Zeit zu Zeit mit dem Daumen aus- strichen und neuerdings hineinsteckten.
EINES TAGES sagte Oberfeldarzt Doktor Schmidt zu mir: „Achleitner, Sie kommen jetzt einmal mit mir hinaus ans Licht, an die frische Luft, sonst gehen Sie mir hier unten noch zugrunde." Ich wollte erst nicht, aber dann ging ich mit und sah vor dem Bunker die Ernte des Todes. Bestattungsmöglichkeit für die Toten gab es keine, weil der Boden beinhart gefroren war. Die Leichen wurden einfach übereinander gestapelt, und so gab es dort mehrere Leichenhaufen, etwa zwei Meter hoch und einige Meter lang, die bis in den Frühling immer mehr anwuchsen. Die Bestattung spielte sich so ab, daß bei der Schneeschmelze Russenfrauen mit Panjewagen kamen und die Leichen zur Wolga brachten oder in einen der Panzergräben warfen.
Dann kam die Geißel aller Kriege: die Seuchen. Wir hatten im Timoschenko-Bunker Diphtherie, Ruhr, Typhus und zum Schluß noch den grausigsten Würgengel, das Fleckfieber. Jene Sanitäter, die täglich die Leichen aus dem Bunker hinausschafften, sind alle an Fleckfieber zugrunde gegangen. Sie infizierten sich an den Leichen. Da die sanitären Anlagen.zerstört waren, mußten wir Bottiche aufstellen, die natürlich bald übergingen. Die Apathie, die Hoffnungslosigkeit, die Unentschlossenheit waren so groß, daß die Leute, die neben diesen überlaufenden Kübeln lagen, nicht zu bewegen waren, sich von dieser Jauche weiter weg zu entfernen. Wir mußten sie oft mit Gewalt aus dieser Umgebung wegzerren. Unser erster russischer Kommandant war Lektor für Geschichte an der Universität Kiew. Dieser Mann hat zwei unserer besten Kameraden, den evangelischen Divisionspfarrer Prüssner und den Oberfeldarzt Dr. Schmidt, durch Genickschuß erledigt. Zwei andere Divisionspfarrer, ein katholischer und ein evangelischer, wurden vom gleichen Natschalnik liquidiert. Der protestantische Pfarrer stellte sich nach einem Streifschuß im Genick tot und kam am nächsten Tag zu uns in den Bunker gekrochen; wir nahmen ihn auf, gaben ihm an Stelle seines Soldbuches das eines Verstorbenen, und er machte dann Dienst als Sanitäter bei uns. Von ihm wissen wir nur, daß der genannte Natschalnik diese Morde begangen hat. Wir hatten von allen Toten Name, Adresse, Truppenteil und Feldpostnummer festgehalten. Beim Auszug aus clem Timoschenko-Bunker wurden uns diese Listen abgenommen. Bei der täglichen Meldung über Personenstand, Abgang durch Tod, Abgang zu Arbeitskommandos, Todesursache, durften wir nicht mehr Fleckfieber anführen; wir mußten Influenza oder sonst einen milder klingenden Ausdruck vermerken. Immer mehr setzte sich als Folge der Hoffnungslosigkeit ktasser Egoismus durch, ein Kampf um das bißchen Leben, das noch in uns steckte. Wenn die Speisenträger den langen Gang mit den Essenkesseln zu den Verwundeten gingen, mußten wir diese Leute durch Konvois leiten lassen: Vorne zwei mit Prügeln, an der Seite zwei mit Prügeln und hinten zwei mit Prügeln; sonst wären die Speisenträger gar nicht bis zum Schluß des Bunkers durchgekommen. Gott ei Dank wurde dieser Russe bald abgelöst; nach dem Tod des Oberfeldarztes Dr. Schmidt hatte er mich zum Chefarzt des Timoschenko-Bunkers bestimmt; ich wußte, der nächste in der Rangliste des Genickschusses war ich. Tags darauf wurde er durch einen gutmütigen russischen Oberleutnant ersetzt, der sofort mit einigen unserer Männer loszog, um Verbandzeug heranzuschaffen, weil wir nichts mehr hatten. Und er brachte wirklich Verbandzeug und Medikamente. Unter seiner Leitung wurde eine Entlausungsanlage gebaut.
ANFANG MÄRZ BEGANN DER ABTRANSPORT aus dem Timoschenko-Bunker, nachdem mehrere Inspektionen unsere trostlose Lage gesehen hatten: ein russischer Oberstarzt, ein Majorarzt, ein Majorhygieniker. Aber die richtige Wende unseres Schicksals brachten erst zwei Feldscherinnen, die eine achtzehn, die andere zwanzig Jahre alt; mit hochgeschürzten
Röcken kämpften sie sich in Todesverachtung bis in den letzten Winkel des Timoschenko- Bunkers vor, und als sie zurückkamen, erbrach die eine, die andere suchte, haltlos weinend, in einem Winkel Schutz. Beide stammelten immer wieder nur: „Bösche moi! Bösche moi!“ Zwei Tage später begann der Abtransport. Diesen zwei Mädchen verdanken wir es, daß einige aus dem Timoschenko-Bunker noch am Leben sind. Der Abtransport vollzog sich in einer unbeschreiblichen Methode: Lkw. fuhren vor, die eine Art Käfig aufgebaut hatten, ohne Fenster, nur hinten eine zweiflügelige Tür, und in so einen Käfig mußten 20 Mann hinein. Die meisten waren Sterbende, Schwerfiebernde, sie mußten durcheinander hineingestopft werden. Wir haben nachher erfahren, daß viele von denen, die fiebernd, delirierend, bewußtlos eingeladen wurden, in Begetowka, wohin man sie brachte, als erstarrte Leichen ausgeladen wurden.
Auch wir Lieberlebenden hatten den Krankheitskeim schon in uns. Die ersten Räumungen habe ich noch selber geleitet, bis die schweren Fälle weg waren, dann war auch ich am Ende und kam fleckfieberkrank in einen anderen Keller in Stalingrad. Ich lernte diese mir bis dahin unbekannte Krankheit in der fürchterlichsten Art kennen. Der Keller war vollgepfropft mit Heckfieberkranken. Die Nächte waren grauenvoll. Die Fiebernden delirierten, die einen beteten, die anderen sangen, wieder andere schimpften, es war ein fürchterliches Chaos. Neben mir lag ein Soldat einer Sanitätskompanie, der früher im rumänischen Heer gedient hatte, ein halber Zigeuner. Als er gestorben war, fand man in seinem Mantel eingenäht zahlreiche Eheringe und viele tausend Mark, die er als Leichenschänder den Toten abgenommen hatte. Er starb neben mir, drei Tage hindurch auf rumänisch, ungarisch, deutsch fluchend, betend, singend. Dann kam ich in einen Fabrikkeller. Dort hatten die Ratten ihr Eldorado, vielleicht waren sie gerade in der Paarungszeit: die ganze Nacht hindurch ein Pfeifen, ein Pfauchen, ein Trappeln ganzer Herden von Ratten, die über uns hinwegliefen.
ENDLICH IM MAI wurden auch diese verschiedenen Teillazarette zusammengezogen, und wir kamen zum erstenmal in eine Fabrik über Tag. Die Räumlichkeiten mußten wir zum Großteil erst selber instand setzen und konnten dann allmählich einen beachtlichen ärztlichen Betrieb aufbauen. Da wir Aerzte aus verschiedensten Fachgebieten zur Verfügung hatten, gab es eine interne, eine chirurgische Abteilung, eine für Skorbut und eine andere für Tuberkulose. Behelfsmäßig versuchten wir uns verschiedene Instrumente anzufertigen, z. B. ein Mikroskop; die Skorbutabteilung arbeitete mit „Frischgemüse“, das wir hereinbekamen, indem wir jeden Tag unter russischer Führung ein Kommando ausschickten, das Brennessel und anderes Grünzeug aus den verwilderten Gärten einsammeln mußte. Bis August 1943 blieb ich in Stalingrad. Dann ging’s nach Djela- buga, wo ich zuerst ein Jahr lang als Maurer, gelegentlich auch als Kanalräumer arbeiten mußte. 1944 kam ich endlich als Lagerarzt nach Lisitschansk in den Donbas.
Wenn ich die Dinge in ihrer Furchtbarkeit geschildert habe, in ihrer ganzen Hoffnungslosigkeit, in ihrer ganzen Niederträchtigkeit, so tat ich es nicht, um anzuklagen, sondern in der Absicht, die Erinnerung daran wach zu halten; die Erinnerung deshalb wach zu halten, um, soweit es uns Kleinen möglich ist, zu verhindern, daß es wieder zu einer solchen Tragödie komme.