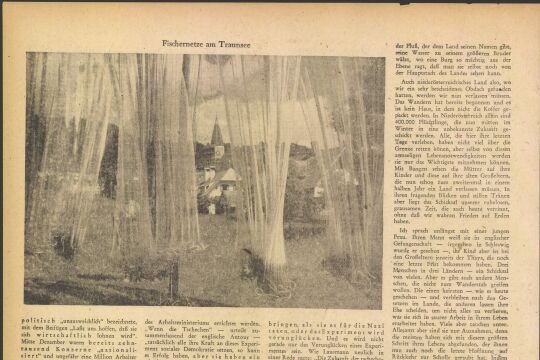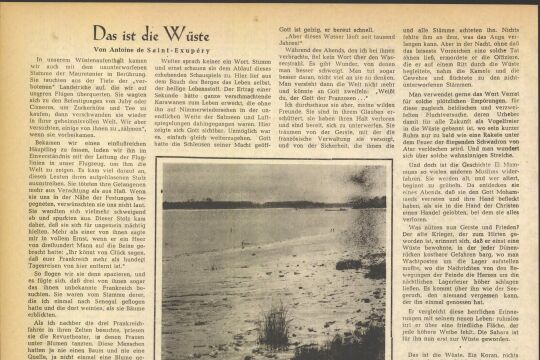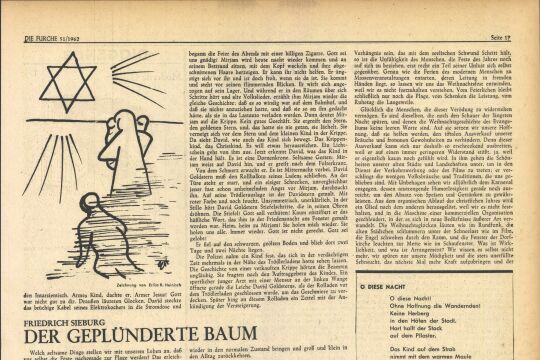Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kein Mittel gegen den Hunger
IM ZEITALTER DER ÜBERSÄTTIGUNG, der Arbeitsverkürzung, der Luxuswohnungen und Zweitautos — können wir unj eigentlich noch vorstellen, was Armul ist?
Sicher, auch bei uns gibt es noch arme Leute.
Aber ich meine nicht das Armsein, wie es uns aus abgetragenen Kleidern und mageren Gesichtem bed manch Vergessenen, Arbeitsscheuen oder Bettlern in einer europäischem Großstadt entgegensehen mag — ich meine jenes große hoffnungslose Elend, “jenes ausweglose Vegetieren, wie es in Indiens Millionenstädten herrscht.
BOMBAY IST EINE MODERNE DREIMILLIONENSTADT. Der Besucher findet tausend Möglichkeiten für Exkursionen, Ausflüge und zur Zerstreuung. Er findet „First-class Hotels” und „Niight-clubs”, viele Sport- und Vergnügungsstätten sowie breite, westliche Geschäftsstraßen mit übervollen, bunten Auslagen.
Kaum ein Besucher aber findet in die Elendsviertel, nicht weit vom Stadtkern entfernt, vielleicht einen Kilometer vom Victoria-Bahnhof, der das Zentrum Bombays bildet. Es war früher Abend, ich bummelte durch den Fruchtmarkt, auf dem zu dieser Stunde, der nachlassenden Hitze wegen, das regste Treiben herrscht, und verlor dabei etwas die Orientierung. Und so kam es, daß ich mich plötzlich in einer abgelegenen, düsteren und lichtlosen Gasse fand.
Am harten Kopfsteinpflaster legten sich schon einige obdachlose Inder zum Schlafen nieder.
In einer dunklen Ecke sah ich ein paar alte Weiber im Kreise hocken, und im leisen Unbehagen, das mich dieser Armut gegenüber immer noch befiel, beschleunigte ich meine Schritte, als ein Aufschrei — peinvoll und langgezogen, mich herum- Pähren ließ.
Ich gehe langsam zu den Frauen zurück und sehe auf ein schmutziges Lacken gebettet, eine Gebärende. Hier, mitten auf der Straße muß sie ihr Kind zur Welt bringen. Keine Zuflucht steht für sie bereit, kein Obdach für das Neugeborene. Auf äem kalten Steinboden wird das Kind seine ersten Atemzüge tun, in sine Welt, die ihm wieder nur Hunger und Elend bringen kann. Auf der Straße muß es aufwachsen, leben. alt werden, und auf der Straße wird es wieder sterben.
Millionen Kinder werden in In- iien auf der Straße geboren.
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Indien beträgt 35 Jahre.
„Eine neue Epoche, ein neues Zeitalter ist angebrochen, … ein Menschheitstraum wind wahr, …bald wird der erste Mensch den VTond betreten…”, hatten mir noch in paar Stunden zuvor einige Stu- äenten in einer Diskussion voll Stolz versichert.
Unerbittlich stellt sich hier die Frage: Was wiegt die Eroberung des Weltraums gegen ein vor Hunger sterbendes Kind?
Unsere Generation muß es sein, iie das Elend bekämpft — weil wir lazu befähigt sind, weil wir heute iie Mittel dazu haben; nur fehlt es vielfach am Willen.
ERBARMUNGSLOSER NOCH HERRSCHT DAS ELEND in Indiens größter Stadt t— Kalkutta.
Zwei Millionen Menschen, nach Schätzungen der Stadtverwaltung, laben ihr „zu Hause” auf den Stra- 3en der Hauptstadt Bangalens.
Wenn sich voll tropischer Schwüle iie Nacht über die Stadt breitet, ist n manchen Bezirken der Verkehr zöllig lahmgelegt. Die Obdachlosen iüllen nicht nur die Gehsteige und Straßenränder, auch mitten auf der Fahrbahn schlafen sie auf ihren schmutzigen Lacken. Wenn die Schlafenden einen Fremden bemerken, strecken sie Mim sofort ihre Hände entgegen und lallen schlaftrunken: „Baisa, Baisa…”
Mütter heben ihre nackten Kinder hoch und Kranke zeigen ihre Leiden in der Hoffnung auf Almosen. In valide und Krüppel versuchen, auf plumpe selbstgemachte Holzkrük- ken gestützt, nachzuhumpeln und jammern um ein paar Groschen.
Leprakranke Hegen, halb verstümmelt, mit angefressenen Ohren und Nasen, in lichtlosen Ecken und heben mühsam die skelettartigen Arme. Aussätzige geben ihren ge- schwürübersäten Körper preis — Gesichter, denen die Qual alles Menschliche genommen hat.
Panischer Schrecken befällt einen, wenn die Siechen Unverständliches stammelnd, schrille Laute artikulierend, schmerzwimmemd die Straße langkriechen, nach dem Vorbeigehenden tasten, seine Beine zu halten suchen, an seinen Kleidern zerren, um etwas von seinem „Reichtum” zu ergattern. Man beginnt zu laufen, zu fliehen — zurück in unsere Welt.
Jeden Morgen vor Tagesanbruch, fahren große Lastautos der Stadtverwaltung durch die Armutsvierted. Sie haben die Aufgabe, die Toten einzusammeln. Tausende sind es, die täglich an einer SammelsteHe dem Feuer übergeben werden. In den Zeiten der großen Seuchen steigt ihre Zahl bis ‘ins Unermeßliche an, pausenlos fahren dann die Lastautos, und wie Unrat werden die Toten gesammelt und verbrannt.
WÄHREND DIE LANDBEVÖLKERUNG IMMER eine Möglichkeit findet, die elementarsten Bedürfnisse des Menschen zu stillen — in den Großstädten sind die Armen hilflos dem Hunger ausgeliefert. Nirgends auf dem Lande konnte ich solche Armut sehen, wie in den übervölkerten Städten Indiens.
Deprimierend ist die Begegnung mit den arbeitenden Lastenkulds, die sich mir im Hafen von Madras bot.
Auf primitiven Karren, die nur aus Eisenrädern und drei bis vier Meter langen Holzstämmen bestehen, werden von jeweils sechs Kulis Güter befördert, die ein Lastauto füllen könnten.
Sie arbeiten barfuß und nur rnit Lendenschurz bekleidet. Viele leiden an Elephantiasis und haben monströs angeschwollene Beine.
Die Gesichter sind von äußerster Anstrengung verzerrt, und ihre Schreie, mit denen sie sich freie Bahn au schaffen suchen, gleichen dem Brüllen gefolterter Tiere.
Ihre unmenschlich harte Arbeit, vom frühen Morgen bis zur Nacht, reicht jedoch nicht aus, sich auch nur an der balligsten Nahrung satt zu essen.
Wenn die Monsumzeit kommt, liegen die abgemagerten, dunklen Gestalten auf regennassen Straßen, mit ihren Kindern in dünne Tücher gehüllt, an Hauswände gedrängt. Untertags durchstreifen die Kinder weinend und bettelnd die Stadt oder stöbern in Abfallhaufen nach Nahrung.
Im südlichen Indien, besonders in den Hafenstädten, herrscht die Elephantiasis, eone von Stechmük- ken übertragene Krankheit. In ihrem Verlauf verdicken sich die Beine des Befallenen bis zu unförmigen Klumpen, gleich Elefantenfüßen. Die Haut beginnt aufzuplatzen, und da keine Behandlung erfolgt, kommt fast immer eine Infektion dazu, und der Erkrankte siech dahin, bis sich sein trauriges Schicksal erfüllt.
Völlig unverständlich bleibt unserer Denkweise die Apathie, mit der diese Menschen ihr trostloses Joch tragen. Fatalistisch und ohne erneuernde Ideen verharren sie in ihrer mittelalterlichen Arbeitsweise, und keine Auflehnung ist in ihnen gegen den menschenunwürdigen Frondienst.
Willenlos — so erscheint es uns — treiben sie dahin, von ihrer Religion gebannt und auf eine glücklichere Wiedergeburt wartend.
ZWEI DRITTEL DER MENSCHHEIT HUNGERN! Eine Tatsache, die jeder Volksschüler weiß und die hin- genommen wird als unabänderlich. 30 Millionen Menschen verhungern jedes Jahr.
„Für” den Weltfrieden werden Waffen gebaut, deren Vemichtungs- kraft immer unheimlicher wird, aber der Frieden kann nie gesichert sein, solange die Mehrheit der Menschen hungern muß. Mit immensen Mitteln werden die Symptome bekämpft, mit strategischer Überlegenheit in Schach gehalten, die Krankheit selbst aber schwielt weiter: der Hunger !
Im Jahre 2000 wird die Erdbevölkerung auf 6 Milliarden angewachsen sein. Die Lebensmittelproduktion muß bis dahin vervielfacht werden, um die Menschen zu ernähren.
Die ungeheure Verantwortung dafür liegt in den Händen jener Staaten, die auf Grund ihrer tech nischen und wissenschaftlichen Entwicklung in der Lage sind, den Kampf gegen das Weltelend erfolgreich aufzunehmen.
Um die Armut zu bekämpfen, genügt es nicht, die Hungernden zu speisen. Es muß neben technischer Hilfe Schritt für Schritt der Bildungsnotstand, der Analphabetismus — man schätzt, daß heute noch 45 bis 55 Prozent der Erdbevölkerung Analphabeten sind — und der hygienische Mißstamd abgebaut werden. Es müssen Spezialisten geschult und Fachpersonal ausgebildet werden, damit die Entwicklungsländer die Voraussetzung bekommen, nach und nach zur Selbsthilfe zu finden.
So paradox es klingen mag, einseitige Hilfe verschärft noch die Not in den Entwicklungsländern. Das beweist etwa die Tatsache, daß durch breit angelegte Impfaktionen die großen Epidemien eingedämmt werden konnten, die Bevölkerung somit explosiv anwuchs — ohne deshalb über mehr Nahrung zu verfügen.
Die Erde birgt noch viele uner- schlossene Emährungsquellen.
Längst haben die Ernährungswissenschaftler bewiesen, daß alle Menschen auch bei steigender Bevölkerungsprogression ausreichend ernährt werden können; selbst dann sind die Nahrungsreserven der Erde erst zur Hälfte ausgenützt.
In Indien wird der Boden heute noch größtenteils mit den selben Geräten bearbeitet wie vor 3000 Jahren: mit dem hölzernen Pflug!
Pflanzenernährung, Bewässerung, intensive Bodenbearbeitung, rationelle Emtemethoden sind weithin unbekannt.
Hier muß geplante und großzügige Hilfe eingesetzt werden.
WIR STEHEN ZUM ERSTEN MALE in der Geschichte dem Hungerproblem nicht mehr wehrlos gegenüber. Eine Statistik hat errechnet, daß die heute für die Rüstung aufgewandten Gelder, für den Kampf gegen das Weltelend verwendet, in absehbarer Zeit wirksame Hilfe gegen den Hunger vieler Millionen Menschen sein könnte.
Wie lange noch müssen Millionen Menschen dahinvegetieren, mit den glänzenden Augen der gequälten, hilflosen Kreatur?
Wann endlich wird der Mensch menschlich? — sich besinnend seiner Pflicht: zu helfen!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!