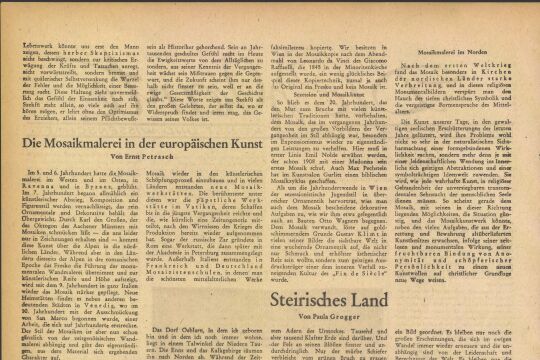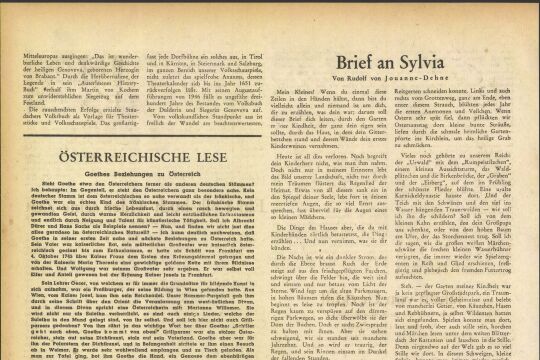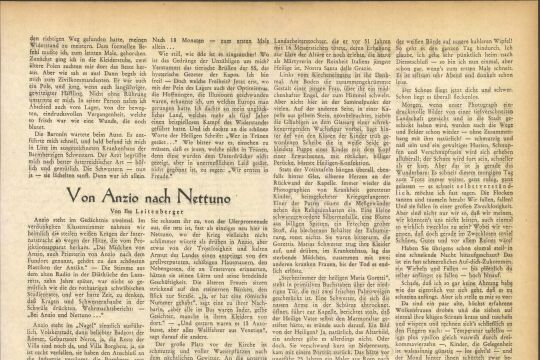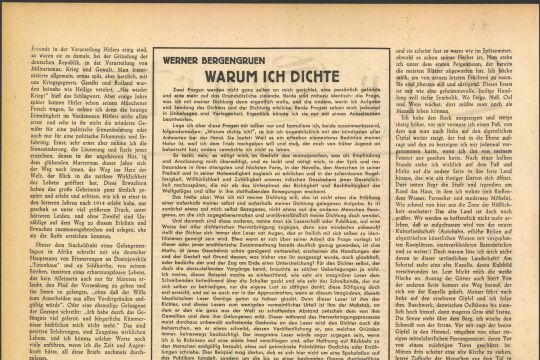Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vor den Berghöhlen der Zigeuner
AUF DEN FLACHEN DÄCHERN VON GRANADA brütete noch vor einigen Wochen die Hitze. Ein nicht enden wollender Menschenstrom ergoß sich durch die Straßen, über die Plätze, vorbei am düsteren Prunk der Kathedrale, an überlebensgroßen Kinoplakaten, an holpernden Eselkarren und an den Wasserverkäufern, die im Schatten maurischer Torbögen mit ihren tönernen Krügen und singendem „agua“ die Hitze erträglicher zu machen schienen.
Kaum erinnert man sich dieser „Spanischen Impressionen“, so kehrt jeder flüchtige Eindruck, jede Begegnung wieder ins Bewußtsein zurück, und man träumt, man erlebt förmlich das Geschaute nochmals. Erinnerungen werden lebendig, werden Gegenwart. In den Patios sitzen die Frauen hinter wippenden Fächern und in den Cafes die Männer hinter einem Glas Jerez, dem Nationalgetränk der Spanier.
Er ist ein wenig anstrengend, solch ein Bummel durch Granada — die „rote Stadt“, die letzte maurische Festung —, die Stadt der Zigeuner. Nirgendwo in Spanien habe ich so viele Zigeuner gesehen. Hier sind sie überall. Am Placa de Bibarranilla schaukeln sie ihre Kinder und verkaufen nebenbei allerlei selbstgebastelten Hausrat. In den Gaststätten und Restaurants bieten sie Kämme an, Blumen und gestickte Mantillas. Auf den Straßen betteln ihre Kinder: „Una pes... una peseta ...“, und die kleinen, schmutzigen Hände greifen überall hin — nicht selten auch in die Rocktaschen der Passanten. Sie wohnen in verfallenen Häusern, in selbstgemachten Hütten oder ganz einfach irgendwo am Straßenrand. Sie lachen, klimpern mit ihren Kastagnetten und wollen den vorübergehenden Touristen die Zukunft weissagen. Von den Spaniern sind sie geduldet, wenn auch nicht gern gesehen.
FÜR DEN STIERKAMPF besitzt der Zigeuner eine ebenso intuitive Begabung wie für Gesang, Musik und Tanz. In den Kabaretts von Granada singt er den Cante Jondo, er spielt di Gitarre und tanzt den Flamenco. Aber um das ursprüngliche, von Tourismus und Amerikanismus wenig beeinflußte Zigeunerlied kennenzulernen, muß man mit einem Sänger und Gitarristen eine kleine Gaststätte aufsuchen, sich mit ihnen in eine von Bretterwänden umfriedete Nische zurückziehen, eine Flasche Manzanilla bestellen und warten. Vielleicht muß man die ganze Nacht warten, ohne daß der „Duende“, der Dämon, den Sänger erfaßt. Vielleicht aber hat man auch Glück, und mit einer weiteren Flasche Wein kommt die Inspiration über den Sänger, und er wird mit jenem eigenartigen, gebrochen und schmerzvoll klingenden „cante grande“ — dem großen Lied — die Liebe und den Tod besingen. Denn: „II gitano tiene la alergine de estar triste“ — dem Zigeuner macht es Freude, traurig zu sein, sagt der Spanier.
ALS FERDINAND VON ARAGO-NIEN und Isabella von Kastilien die Alhambra bezwangen und die letzten Mauren vertrieben wurden, da kamen über die schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada die Gitanos nach Granada — die Zigeuner. Sie waren genauso dunkeläugig, heiter und beschwingt wie die geflohenen Mauren, und sie ließen sich außerhalb der Stadt in den Höhlen des Sacro Monte nieder. Dort wohnen sie heute noch.
Als ich von meinem Wunsch sprach, den „Heiligen Berg“ allein zu betreten, stieß ich bei den Spaniern auf heftigen Widerspruch. Es schien ihnen ein ausgesprochen gewagtes Unternehmen zu sein. Man hielt mir die Gefahren vor, die mich dort erwarteten. Die Zigeuner seien unberechenbar. Einem Gitano könne man nicht über den Weg trauen. Ich würde belästigt, vorerst umschmeichelt, dann beschimpft und schließlich mindestens ausgeraubt werden. Daher sei es viel besser, den Abend abzuwarten, um mich einer von den Touristenbüros organisierten Führung anzuschließen. Ich würde in internationaler Gesellschaft den Berg besichtigen, der Dolmetsch würde Kontakt mit der Bevölkerung herstellen, man würde mir besonders typisch ausgestattete und eingerichtete Wohnhöhlen zeigen, den echten Zigeunertanz in der echten Zigeunertracht, begleitet vom echten Zigeunerlied. Alles in allem lag mir etwas zu viel „Echtheit“ in diesen Versprechungen.
UND SO STEIGE ICH ALLEIN den Berg hinauf, während unter mir der Sonnenglast auf den Dächern von Granada schimmert und dazwischen Straßen wie weiße Schlangen brennen. Hier oben gibt es keine Straßen. Nur Geröll, stachelige Kakteen und einige schmale Pfade, auf denen die Mulis ihre Lasten schleppen. Aber dafür gibt es Hitze. Und Fliegen, die mich in surrenden Schwärmen umkreisen.Vorerst passiert gar nichts. Und ich weiß auch warum: Weil- man mich noch nicht erblickt hat. Noch bin ich verdeckt von den weißen Felsen und den niederen Mauern, die sich über den Berg hinziehen. Aber nachdem ich eine letzte entscheidende Biegung gewonnen habe, kommt es auch schon auf mich zu: ein johlendes Durcheinander ganz oder halbnackter Kinder, dazwischen eingeklemmt und eingekeilt, aber sich dennoch mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit fortbewegend, eine Zigeunerin mit ihrem Baby am Arm, das sie hoch in die Luft hält — um es vor etwaigen Quetschungen zu bewahren oder mir nur besonders deutlich zu machen, kann ich so rasch nicht feststellen. Ich zücke meinen Photoapparat — aber schon ist es gänzlich unmöglich geworden, auch nur eine Aufnahme zu machen, denn die Kinder sind bereits bei mir, um mich und an mir, und jedes Bemühen, einen kleinen Abstand zu gewinnen, erweist sich als erfolglos. Die Zigeunerin hält mir ihr Baby entgegen, damit ich es auch gebührend bewundere, und die Kinder rufen im Chor ihr Cigarro, Peseta und Chocolata, man will mir vortanzen, vorsingen, und die Kleinen nehmen sogleich die typische Flamenco-Stellung an — einen Arm über den Kopf und einen eng am Körper haltend. Und nachdem ich einige Peseten aufgeteilt habe — es sind natürlich nie genug —, werde ich schließlich im Triumph den We$ hinaufgeführt.
DIE ZIGEUNER WISSEN GENAU, warum sie immer noch in diesen Höhlen wohnen, die in terrassenförmigem Übereinander wie Bienenwaben in den Berg gebaut sind. Der erste Grund dafür ist die im Inneren herrschende Kühle — ein weiterer der besonders in den letzten Jahren ständig zunehmend Tourismus. Denn die abendlichen Tanzvorführungen am Sacro Monte stellen eine beliebte Geldquelle dar, und mancher Ausländer fühlt sich verpflichtet, angesichts des ihn umgebenden und oft sehr nachdrücklich betonten Elends etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Einige der Höhlen sind so klein, daß die mehr oder minder zahlreiche Familie gerade genug Platz zum Schlafen findet. Andere wieder sind groß und geräumig und mit allem Komfort, wie Teppichen, Ruhebetten und prachtvollen Kupferkrügen, ausgestattet. Sie werden oft von berühmten Tanzstars und Sängern bewohnt. Aber auch für sie, die unten in den Kabaretts von Granada auftreten, ist es ein Selbstverständliches, hier oben den Touristen anzubetteln. Es gehört eben dazu wie das Essen und Schlafen und ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil ihres Zigeunerlebens.
Viele der Kinder sind unterernährt, und man wundert sich, wie es möglich ist, daß aus diesen kleinen Elendsbündeln ausgewachsene Menschen werden. Aber während sie um Brot und Schokolade betteln, besitzen ihre Eltern oft Radios und elektrische Beleuchtung in den Höhlen. Es ist das sorglose und unorganisierte Von-der-Hand-in-den-Mund-Leben der Zigeuner, das diese manchmal grotesk anmutenden Zustände schafft. Während ein kleiner nackter Urenkel auf dem Schoß der Urgroßmutter schreit, weil er Hunger hat, verkündet drinnen, in schmutzstarrender Höhle, die gepflegte Stimme eines Ansagers die neuesten Nachrichten.
WENN AUCH AM SACRO MONTE der wirtschaftliche Fortschritt Spaniens mit Radioapparaten und elektrischer Beleuchtung gefeiert wird — Wasser ist nach wie vor große Mangelware geblieben. Es muß vom Brunnen, der sich am Fuße des Berges befindet, heraufgetragen werden. Und wenn man sieht, wie beschwerlich es ist, auch nur einen einzigen Krug den heißen, ausgetrockneten Pfad hinauf-zuschleppen, dann wundert man sich über gar nichts mehr. Man beginnt sogar den Schmutz, der beim Kleinkind anfängt und beim Alter geradezu konserviert wird, mit anderen Augen zu betrachten.
Am Vormittag wirkt der Berg wie ausgestorben, und außer Kindern und alten Leuten ist hier niemand anzutreffen. Denn dann sind die meisten der Männer und Frauen unten in der Stadt, um auf irgendeine Art und Weise Geld zu verdienen. Aber am Nachmittag, wenn die Hitze unerträglich wird, ist vor den Höhleneingängen die ganze umfangreiche Familie samt allen Haustieren versammelt. Hier wird gelacht, geplaudert und zwischen irgendwelchen Korbflechtarbeiten, Stik-kereien und einfachen Webstühlen auf den kühleren Abend gewartet. Und wenn das Rot der müden Sonne hinter den Bergkuppen verlöscht und die Häuser der Stadt zu einer dunklen Masse erstarren, dann wird die bunte Zigeunertracht angezogen, vor den Touristen getanzt und die Peseten werden gezählt, die in den herumgereichten Mützen klimpern.
EIN BENEDIKTINERKLOSTER steht auf der Spitze des Berges. Und während ich mich ihm nähere, lichtet sich auch die inzwischen mindestens auf das Dreifache angewachsene Schar kleiner Nackedeis. Es gelingt mir sogar, einige Photos zu machen. Dann entfernt sich ihr Geschrei. Und schließlich bin ich allein. Mir gegenüber schwimmt die Alhambra wie eine Fata Morgana hinter grauen Hitzeschleiern. Mit Türmen und Arkadengängen, kühlen Höfen und Brunnen, mit Gärten, in denen Manuel de Falla seine Cante-Jondo-Feste veranstaltete und Garcia Lorca seine Zigeunerballaden schrieb. Hier Armut und Elend auf einem trockenen Boden, der gierig jeden, von den pausenlos auf und ab schreitenden Wasserträgerinnen verschütteten Tropfen aufsaugt — dort kühle Pracht und farbige Blütenwunder. Es ist der Gegensatz zwischen arm und reich, hell und dunkel, Ausgelassenheit und tiefer Schwermut, der hier wie überall dem Land sein eigenartiges Gepräge gibt.
WIE SCHWARZE AMEISEN zwischen den weißen Steinen — so sieht da unten das Klettern der Zigeunerkinder aus. Bald werde auch ich wieder den schmalen Weg hinuntersteigen, vorbei an den dunklen Löchern der Höhlen, die als Eingang und einzige Lichtquelle dienen, vorbei an den staubigen Kakteen, auf deren stacheligen Blättern die Wäsche trocknet, und eine treue Anhängerschaft „kleiner Zigeuner“ wird mir folgen. Bis zu jener Grenze, an der ihr Reich aufhört — unten, beim Brunnen, der ständig von Mensch und Tier belagert ist. Dort werden sie stehenbleiben und mir nachsehen. Dann werden sie wieder hinauflaufen zu einem Leben in Armut und Schmutz, das sie trotzdem nicht anders haben wollen. Und ich werde drunten am Placa de Bibarranilla der alten Zigeunerin doch noch einen ihrer Kämme abkaufen, die sie mir täglich beim Vorbeigehen beharrlich und fast schon angriffslustig unter die Nase hält. Obwohl ich eigentlich gar keinen brauche.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!