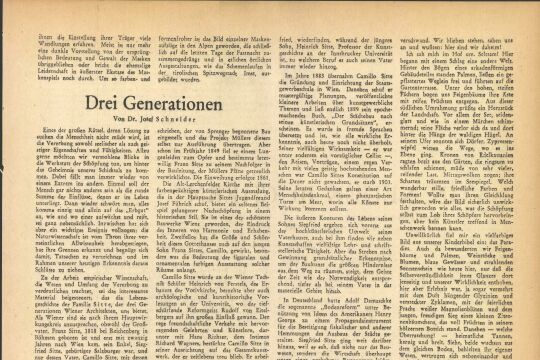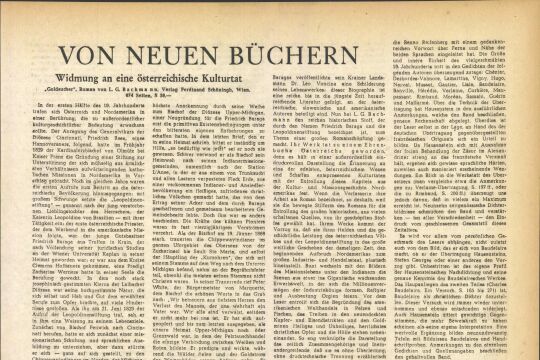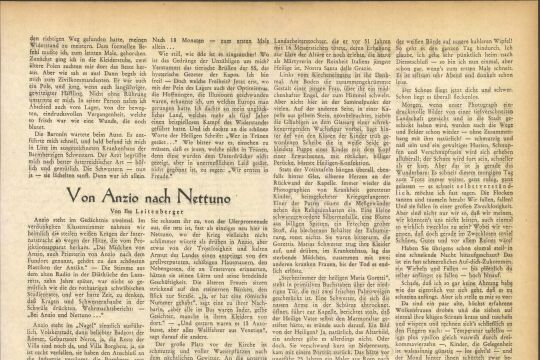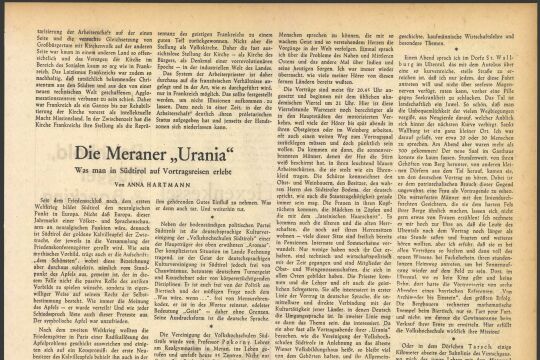DAS SCHICKSAL GUATEMALAS wird durch seine Vulkane bestimmt. Die erste Hauptstadt, deren Ruinen heute als „Ciudad Vieja”, als „alte Stadt”. zu sehen sind, ging in der Mitte des 16. Jahrhunderts unter, als der Wassarvulkan „El Agua” nach wochenlangen Regenfällen ausbrach und sie unter einem Meer von Schlamm begrub. Nur die Barockkathedrale ist erhalten.
Wenige Kilometer entfernt entstand die zweite Hauptstadt, „Antigua”. Sie wurde 1773 durch das „Erdbeben der heiligen Martha” zerstört.
Am eindrucksvollsten sind die Ruinen eines Klosters und seiner Kirche, vor denen gewaltige Blöcke Mauerwerk wie nach einem furchtbarem Bombardement liegen. In der einstigen Sakristei wohnen Indianer, deren Kinder die historischen Daten wie Fremdenverkehrsführer plappern. Antigua ist eine Sehenswürdigkeit mit drei Sternen im Fremdenführer. Sie ist aber auch durch die Webwaren berühmt. Im Vorbeifahren winken die Indianerinnen. Vor ihren Gärten hängen Gestelle mit kunstvoll gewebten Decken — Preis etwa 200 Schilling —, in ihnen hängen Apfelsinen in unvorstellbarer Fülle. Der beste Kaffee der Welt kommt aus Antigua. Die Plantage gehört — wie zahllose andere — der reichsten Kaffeefamilie des Landes, Herrera. Aber so friedlich das fruchtbare Land mit der uralten Handwerkskunst wirkt, der Schein trügt. Es gibt historische lokalpolitische Kämpfe. Das reiche Indianerdorf San Antonio Aguas Calientes hat Land, das arme Zwillingsdorf Santa Catalina hat Wasser. Sie befehden sich seit einem Jahrhundert.
Die jetzige Hauptstadt des 4-Mil- lionen-Staates ist etwa 50 Kilometer entfernt nach den Erdbeben stillos entstanden. Bunte einstöckige Häuser erinnern an den Kolonialstil der Wildwestfilme. Bäcker, Schneider, Fleischer, Apotheker und Drucker scheinen in Geschäften aus dem Jahre 1850 zu handeln. Dazwischen liegen moderne Kinos. Im „Cine Tropical” lief gerade „Die Nacht der Dämone”. Nur wenige Hochhäuser, moderne Asphaltierung und Straßenbeleuchtung mit Lichtbügeln deuten auf die Gegenwart.
AM FRÜHEN MORGEN WAREN die Geschäfte noch geschlossen, Betrunkene Indianer, die ihre Jacken als Schutz gegen die nächtliche Kühle und die morgendliche Helle über ihren Kopf gezogen hatten, lagen in der gedeckten, rosa überblühten Parkanlage des Hauptplatzes oder — wenige Schritte entfernt am Straßenrand. Barfüßige Indianer, Riesenlasten auf dem Rücken, und Indianerinnen, schwere Packen auf dem Kopf, trabten vorbei. Was sie trugen, stand — wie bei den Ameisen außer Verhältnis zu ihrer Körpergröße. Schuhputzer, selbst mit schmutzigen und verwahrlosten Schuhen, manche verkrüppelt oder verstümmelt, suchten Kunden.
Aber schon wenige Kilometer vor der Hauptstadt spürte ich den großen Reiz dieses alten Indianerstaates. Durchsichtiger Nebel lag über dem Riesental der Hauptstadt. Bepackte Esel trugen viereckige Strohkörbe. Tannen, Palmen und Eukalyptus wuchsen auf lehmigem Boden. Noch in 3000 Meter Höhe wechselten tannenbesetzte Hügel mit Äckern, standen kleine Häuschen aus Alscobe, den Lehmziegeln. Wie in einer Bepgund Talbahn schaukelten die Autobusse von einem Indianerdorf zu dem anderen, bis ein Schüd „Pana Jachel, 1500 Meter hoch, 2947 Bewohner” anzeigte. Dort begann hinter den Indianerstraßen freilich ein luxuriöses Wohnviertel, in dem die reichen Bewohner der Hauptstadt, aber auch viele Ausländer, ihr Wochenende zwischen Bananen und Zedern und Gärten mit herrlicher Blumenpracht verbringen. Zwischen drei Vulkanen liegt der mehr als 500 Quadratkilometer große See Atitlän. Da die zweijährige Indianerin — wie ihre Großmutter — einen langen Rock’ trägt, erregten die Shorts, in denen ich zum Baden ging, allgemeine Heiterkeit. Das Wasser ist klar, aber der Strand lehmig und steinig. Außerdem verdarb mir ein elender alter blinder Indio, der sich mit seinem Stock den Weg durch das zerklüftete Lehmfeld suchte, die Freude. Um den See liegen 12 Indianerdörfer. Sie unterscheiden sich auch durch die Muster und die Webart ihrer Kleidung.
Gegen Abend spielten Trommler und Pfeifer zu einer Prozession. Alte Indianer trugen uralte, kostbare, silberne Kreuze. Ihnen folgten je vier Männer, die kitschige neue Heiligenfiguren auf Tragbahren transportierten. Wenn sie sich niedersetzten, knieten Indianerinnen vor ihnen und schwenkten Weihrauchkessel. Raketen knallten — wie so oft —, Signale des Gemeinschaftsaktes.
VOR EINEM KLEINEN SAUBEREN Häuschen sah ich ein Schild: „El pintor, The Painter Hannes Wie- manin”. Er stammt aus einer Hamburger Malerfamilie, gehört zum Jahrgang 1908 und malt — Impressionist mit eigenem Stil — seit fünf Jahren am See Atitlän. Er hat in dem Indianerleben sein Sujet und in dem internationalen Publikum, das es besichtigt, seine Käufer gefunden. „Nachts male ich die Indianerfeste”, erzählt er, „Kerzen in der Hand, 50 Indianer, Frauen und Kinder, Polizisten und Besoffene, um mich herum. Aber ich kann mich konzentrieren. Die Indianer haben vor der Kamera Angst, weil sie glauben, daß der Photograph mit ihrem Gesicht davongeht, aber sie haben zu meiner Arbeit Vertrauen… ein herrliches Gebiet für einen Maler… und zu denken, daß man — noch im Bett liegend — einen Kolibri mit der Hand fangen kann …” Ein in Sujet und Farben gleich erregendes Bild stand neben seiner Staffelet Es gehört dem deutschen Industriellen Federico Rotter, der den schönsten Garten der Traumstadt besitzt. Wiemann kopierte es für einen nordamerikanischen Diplomaten aus Bangkok. „Der berühmte Indianermarkt in Chichi- castenango… Sie müssen ihn sehen...”, sagte Hannes Wiemann.
So fuhr ich am Pfingstsonntag nach Chichicastenango. Von ferne schien es in der Kirche zu brennen. Vor ihr gab es ein großes Holzfeuer. Hunderte zündeten an ihm kleine Weihrauchkessel an und schwenkten sie. In der ganz verräucherten Kirche waren große Holzuntersätze aufgestellt. Unzählige Kerzen brannten auf ihnen, Junge und Alte, Männer und Frauen zündeten kniend viele Kerzen auf einmal an. Steintöpfe und Stühle, Idolos und Kräuter, Stücke von buntem Nylonstoff, die als Regenmäntel dienen, Kalkstücke, die in der Suppe aufgelöst werden, stehen zum Verkauf. In Garküchen schlürften sie rote — pfefferige — Suppe aus Maistortillas, dünne Scheiben, die wie Eierkuchen aus- sehen. Eine Indianerin preßte ein Stachelschweinchen, das sie verkaufen wollte, an die Brust. Männer zogen mit Riesenbündeln Holz ab. Dörfler zogen mit Flöte und Trommel in die Kantine „La Esperanza”. Kinder bettelten von morgens bis abends. In einem Hausflur hatte ein Friseur, auf der Terrasse vor einem anderen Haus ein anderer seine Werkstatt zum Massenhaarschnitt aufgezogen. An manchen Stellen hockten junge Mädchen zusammen. Aber sogar sie schwiegen.
NEBEN DER KIRCHE LAG EIN GROSSER viereckiger Gebäudekomplex: der Pfarrhof. Dort ist unter anderem eine Schule untergebracht.
400 Jungens, die Lehrer werden sollen. Am Sonntag mittag spielte ihr Schulorchester. Sieben schlugen die „Marimba”, ein dem Xylophon ähnliches Holzinstrument, das die Negersklaven im 16. Jahrhundert aus Afrika mitgebracht haben. Dazu spielte einer die Baßgeige und ein anderer die Trommel. Hunderte von Indios hörten zu, während ihre Frauen auf dem Markt verkauften. „Die Frau ist die ökonomische, der Mann die gesellschaftliche Stütze der Familie”, sagte ein Priester.
Innerhalb des Pfarrhofes sah ich die Poliklinik. Dort traf ich Dr. Juan Alemän, der vor wenigen Jahren in Hamburg und Heidelberg seine Fachausbildung als Chirurg beendet, aber die deutsche Sprache schnell vergessen hatte. Er erzählte: „In unserem Departement, das 65 Kilometer lang ist, wohnen 300.000 Indianer. Es gibt 20 Priester und vier Ärzte für sie. Wir haben ein modernes Ruralhospital mit 200 Betten, aber nur eine Ambulanz, die noch dazu auf den Lehmwegen oft nicht durchkommt. 75 Prozent der Bevölkerung haben Amöben. Außer dieser Wurmkrankheit, die tödlich sein kann, sind Tuberkulose und Unterernährung unsere größten Sorgen.” „Reichen die Eigenproduktion und die Einnahmen aus dem Tauschhandel der Indios nicht, um sich ausreichend zu ernähren?” frage ich. „Nur zum Teil”, sagen er und seine Mitarbeiter. „Die Indios essen falsch, zu wenig Fleisch und Gemüse. Und sie leben falsch: Sie schlafen mit dem Vieh auf dem Boden ihrer Hütten. Wenn sie Geld haben, geben sie es für Schnaps oder Raketen aus und kaufen sich lieber ein Fahrrad oder ein Transistorradio als ihren Kindern Schuhe.” „Ich habe den Eindruck”, meine ich, „daß sie keine Hygiene kennen. Auch die Kinder sind unvorstellbar schmutzig.” „Gewiß”, antwortet der Arzt, „aber sie haben oft ein ,Temascal’, ein kleines Häuschen, in dem Feuer unter einem großen Kessel angezündet wird, eine Art .Sauna”, in der die ganze Familie gleichzeitig ein Dampfbad nimmt.”
„Ich wundere mich über die Frömmigkeit der Indianer”, meine ich. „Die spanischen Eroberer haben auf jede Pyramide, in denen die azte- kischen Götter verehrt wurden, eine Kirche gebaut, und wenn sie auch sonst gewiß nicht die Seelen der Indios erobert haben, so habe ich noch niemals so in das Gebet versunkene Menschen gesehen wie die Indianer, wenn auch neben ihnen schreiende Säuglinge in der Kirche liegen, die sie eben nirgends abgeben können.” „Das Problem ist viel komplizierter”, sagt der Priester. „Sie haben einen großen Glauben an Gott, aber der Kult ist nur äußerlieh. Sie werden getauft, aber nicht konfirmiert und gehen nicht zur Beichte. Sie beten gleichzeitig vor den Altären, die ihre Zauberer für ihre alten Götter unterhalten, und opfern ihnen oft Schnaps. Sie respektieren nicht die Autorität der Pater… sie haben kein Gefühl für die Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers … Richter und Polizei sind für sie lästige Probleme… kennen keine politische Kollektivveranitwortung … kommen zuweilen nicht einmal zeit ihres Lebens in das Nachbardorf...”, sagt der Arzt.
IN DEM AUTOBUS, IN DEM ICH zu dem Indianerdorf geschaukelt, saß zwischen den Indios, die Apfelsinenreste auf den Boden spucken, eine ungeschminkte blonde Frau. Sie gehörte zu den 14 „Freiwilligen”, die das „American Friends Service Comitee” auf zwei Jahre in das Gebiet geschickt hatte, um bei den Indianern Sozialarbeit zu leisten. Ihr 32jähriger Mann lehrt Landwirtschaft. Die anderen bilden Indiolehrerinnen aus, die ihren Schülern das Abc, Kochen und Nähen bei- bringen sollen. Eine andere dieser Entwicklungshelferinnen, eine 23jäh~
rige Nordamerikanerin, hat bis vor zwei Jahren in München Germanistik studiert. Sie ist Protestantin, arbeitet aber in dem katholischen Sozialwerk mit, dessen lokales Zentrum die Pfarrei der Kirche von Chichicastenango ist. Gerade mit ihnen wollte ich das Rassenproblem der Indios diskutieren.
„Das Rassenproblem existiert bei den Indios nicht?” frage ich vorsichtig. „Gewiß nicht als Problem der Haut..antworten sie. „Ein Indio braucht sich doch nur einen europäischen Anzug zu kaufen, westliche Sitten äußerlich anzunehmen, und schon gilt er als .Ladino”...” „Nein”, antworten sie, „es ist kein äußerliches .Umsteigen” in einen anderen ,Kulturkreis”. Erstens muß er in einen anderen Ort ziehen. Man wird einen Mann, der als .Indianer” bekannt war, in seinem Ort niemals als .Ladino” anerkennen. Er muß auch aus einem anderen Grund den Wohnsitz verlegen. Die Indianer hassen die Spanier und die Ladinos in gleichem Maß. Wenn er .Ladino” wird, bricht er mit seiner Gemeinschaft und wird als eine Art Verräter angesehen. Dieser Übertritt läßt sich am leichtesten mit dem Religionswechsel vergleichen”, sagt eine der Entwicklungshelferinnen. „Der Wechsel vom ,Indio” zum .Ladino” wirkt sich nach unseren Erfahrungen”, sagte eine Soziologin unter der Gruppe, „charaktermäßig sehr schädlich aus. Die echten Indianer sind gütig, aufrichtig und vorzügliche Mitarbeiter. Wenn sie aber .Ladino” geworden sind, mißtrauen sie allen wie sich selbst. Sie werden unaufrichtig, falsch und unzuverlässig.”
„Kommen Sie mit der Alphabetisierung vorwärts?” frage ich.
„Es ist ein Wettrennen mit der Bevölkerungsvermehrung, das wir verlieren”, antworten alle. „Es werden viel mehr Kinder geboren, als Lehrer ausgebildet oder Schulen gebaut werden können...”
„Und ist die Geburtenkontrolle nicht, wie in Indien oder Japan, ein Ausweg?” frage ich. „Aussichtslos”, ist die einstimmige Antwort.
Haben nun die Missionare, haben die Entwicklungshelfer Erfolg? „In der Abstinenzlererziehung ein wenig. Sonst nicht… Die Gemeinschaftsform, in der die Indianer völlig abgeschlossen von der modernen Welt leben, entspricht ihrem Sicherheitsgefühl. Sie kennen keine Lebensangst, und sie fühlen sich unglücklicher, wenn sie die westliche Zivilisation akzeptieren.”
Die Einordnung der Indianer in das normale Wirtschaftsleben ist im Staatsinteresse unerläßlich, aber für sie als Menschen ein fragwürdiges Geschenk.
SO HAUST EINE DER 14 JUNGEN Nordamerikanerinnen aus reichem Hause in einem gräßlichen Zimmerchen über einer alten Brücke in Chichicastenango, das wie das Verließ einer Festung wirkt, und zündet zwei Kerzen an, bei denen sie liest und tippt. Elektrisches Licht gibt es bei ihr nicht. Die Monatsmiete beträgt 200 Schilling.
„Der Mensch ist gut. Die Indianer sind gut. Wir müssen ihnen helfen”, sagt sie.
Dabei ist ihr klar, daß der „ameri- can way of life” die indianische Lebensform nur zerstören kann, ganz abgesehen davon, daß ihr Tropfen Güte in einem Meer von Gleichgültigkeit versinkt