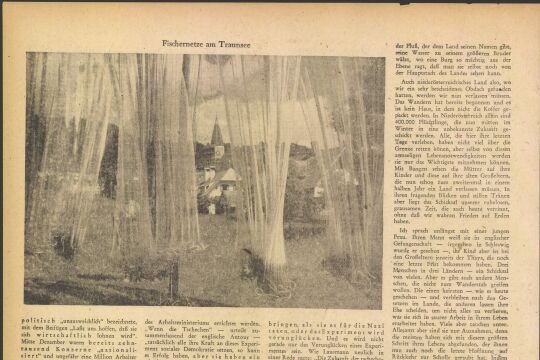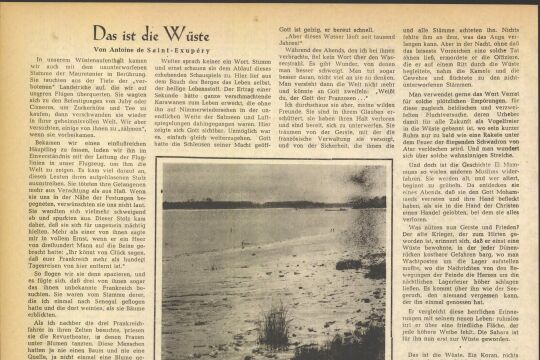Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Landraub“ acht mal zehn Meter
Am Orte der Invasion angelangt, erzählte uns Joao, daß sich bereits 1500 Familien angesiedelt hätten. „Wir haben weder ein Syndikat noch Agitatoren; ein Stückchen Erde zu besitzen, ist für uns eine Frage auf Leben und Tod.“ Keiner der Invasoren hatte mehr als ein winziges Fleckchen Erde von etwa acht mal zehn Meter besetzt. „Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, eine Hütte, die nichts kostet. Ich selbst habe siebzehn Jahre auf einer Plantage gearbeitet. Nahezu die Hälfte meines Gehaltes (10 bis 15 Dollar im Monat) mußte ich als Miete für die Hütte bezahlen, die wir bewohnten. Sie verstehen, bei der herrschenden Teuerung, kann eine Familie davon nicht mehr leben. Wir mußten auf die Straße. Vielleicht finde ich in der Stadt Arbeit.“
Sein Nachbar Pedro ist aus dem „inferior“, aus dem Trockengebiet des Landes. Wie viele andere hatte er Land gepachtet. 50 Prozent der Ernte gehen an den Besitzer. Von der anderen Hälfte muß die Familie leben. Dies reicht aber nur selten aus, vor allem aber dann nicht, wenn der Regen ausbleibt. In diesem Falle muß er beim Besitzer Schulden machen, die immer mehr anwachsen, bis nicht selten die ganze Ernte, sein geringes Hab und Gut dem Landbesitzer zufallen und er mit seiner Familie ein sklavenäihnliches Dasein führt. Die Mutigsten, deren Initiative noch nicht ganz gebrochen ist, ver-, suchen ihr Glück in der Stadt — sie gehören dann zu den Tausenden und Abertausenden ungelernter Arbeiter, die den rapid anwachsenden Ring der Elendsviertel um die Städte Brasiliens bilden. Pedro ist seit Monaten arbeitslos. Er teilt das Schicksal hunderttausender Fabriksarbeiter, die durch die wirtschaftliche Krise im abgelaufenen Jahr die Arbeit in der Industrie verloren haben. Pedro hat fünf Kinder. Seine Frau hält das Jüngste, das etwa sechs Monate alt ist, auf dem Arm. Es ist bläulich-blaß und wimmert erbärmlich. Bald wird es den 50 Prozent (und mehr) aller Kleinkinder angehören, die vor Vollendung des ersten Lebensjahres sterben. Zum Arzt zu gehen ist zu teuer, von den für die Armen unbezahlbaren Medikamenten ganz abgesehen. Eine andere Frau kocht Bohnen in einer alten Konservendose über einem Holzfeuerchen vor der Hütte: Bohnen, Mandiokamehl, manchmal Bananen und getrockneter Fisch, das ist die ausschließliche Nahrung dieser Menschen vom sechsten Monat ihres Lebens an. Milch kennen die Kinder nicht. Die aufgedunsenen Bäuche der kleinen, nackten, schmutzigen Kinder geben Zeugnis von Hunger und falscher Ernährung...
Ein stiller Krieg gegen wehrlose Kinder
Hier wütet ein „stiller Krieg“ gegen wehrlose Menschen; viele Tausende fallen ihm jedes Jahr zum Opfer (allein in Reoife sterben täg-
lich 15 Kinder an den Folgen der „miseria“ — 5200 im Jahr!). Die Ursachen dieser Situation sind so komplex, daß sich schließlich keiner mehr dafür verantwortlich fühlt. Das Land baut historisch auf die Tradition der portugiesischen Konquistadoren auf, die wohl das Evangelium brachten, aber zugleich die Gesinnung der Ausbeutung in die Struktur der sich heranbildenden Gesellschaft einprägten.
Eine andere Quelle des Egoismus im eigenen Land liegt darin, daß der industrialisierte Süden Rohstoffe und Agrarprodukte im Norden billig aufkauft und teure Industrieprodukte in die Notgebiete liefert, von denen nur eine Minorität profitieren • kann.
Es ist jedoch leicht, die Verantwortung anderer zu sehen. Die wenigsten Europäer und Nordamerikaner fühlen sich mitverantwortlich für diese Situation. Wem von uns ist es bekannt, daß wir seit Jahren auf Grund internationaler Vereinbarungen Rohmaterialien (Erze, Metalle, Erdöl usw.) und Agrarprodukte zu ständig sinkenden Preisen in den Entwicklungsländern aufkaufen, während die Preise der dorthin exportierten Industrieprodukte ständig steigen? Der daraus zum Beispiel Lateinamerika erwachsende Verlust betrug seit 1958 rund 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr, das heißt, er überstieg die Summe aller im gleichen Zeitraum diesem Kontinent zufließenden Hilfsgelder, die „Alliance for Progress“ miteingeschlossen (CEPAL). Das will also heißen, unsere großzügigen Spenden sind nichts anderes als die teilweise Wiedergutmachung eines diesen Ländern zugefügten Unrechts.
Macumba und Zuckerrohrschnaps
„Eminenz, geben Sie mir die ärmste Pfarre Ihrer Diözese.“ Padre Joses Gesundheit war durch das tropische Klima des Nordens, durch harte Arbeit und Krankheit untergraben. Er mußte in den kühleren Süden, in die Diözese Sao Paulo — aber er will weiter arm mit den Armen bleiben. Was ihm zugeteilt wird, ist keine Pfarre, sondern eines jener Elendsviertel — favelas genannt —, die in kürzester Zeit aus dem Boden wachsen und dem Elend der Zuwanderer aus dem Innern des Landes die Konfrontation mit dem Großstadtleben hinzufügen. Es ist nichts da als ein wirrer Haufen von Hütten und Obdachlosen, Massen zerlumpter Kinder, roter Lehm, in dem alles versinkt, sobald die heftigen Regengüsse einsetzen. Abends brennen kleine Feuer vor den Hütten, als Opfer mit Speise und Trank sollen sie die mächtigen Geister freundlich und gewogen stimmen. Die dumpfe Trommel des Macumba tönt durch die Nacht. Die Jungen fesselt die Phantasiewelt des Radios, Fernsehens und Films — so reich, so stark, so mächtig sein können wie die —, ein paar Schüsse
genügen vielleicht, um herauszukommen aus diesem verfluchten Elend, das einem das Leben zerschlägt... Die Alten quälen sich nicht mehr. Sie haben die Lösung längst im Zuckerrohrschnaps gefunden.
Padre Jose schaut auf seine Zone, die sich kilometerweit vor ihm erstreckt. Er schaut auf seine mageren, müden Arme: „Du Herr, lebst, liebst, leidest in jedem von ihnen. Durch Macumba und Schnaps hindurch wirst Du mir das Große und Wahre, die Sehnsucht, die Menschlichkeit,
die Liebe zeigen, die dn ihnen liegt. Nur sie selbst können- sieh aus diesem Morast befreien, weil Deine Wahrheit und Gerechtigkeit schon in jedem von ihnen lebt, weil die Macht Deiner Liebe in ihnen wohnt, die stärker ist als Ausbeutung und Egoismus.“
Nicht zu predigen, nicht zu taufen, keine Kirche zu bauen, galt es zu-
nächst, sondern es ging darum, Christus in hundert obdachlosen Familien eine Wohnung zu bauen. Und sie bauten selbst, alle zusammen. Die Favelados selbst wählten die jeweils ärmste Familie, die das nächste fertiggestellte Haus bekam; dann bauten sie eine Baracke für ärztliche Hilfe, eine Schulbaracke und schließlich eine kleine Kirche, arm, bescheiden — so arm und bescheiden wie sie selbst.
Dann begann der Kampf gegen Unrecht und Ausbeutung in den Fabriken. Dazu wurden Syndikate gegründet, um gemeinsam für Gerechtigkeit zu arbeiten. Als wir Padre Jose kennenlernten, fuhr er gerade zum erstenmal mit einigen Arbeitern zu einem Gespräch mit Abgeordneten: „Die Politiker haben keine Ahnung davon, was das Volk braucht, was es zu geben hat, wo es ihres Einsatzes bedarf... Wissen Sie, das Evangelium ist die radikalste Revolution, wenn wir es nur leben. Diese Revolution braucht keine Waffen; sie beginnt hier und heute und ist mächtiger als alle Atombomben.“
Christen haben das Volk verraten
Mit einer wachsenden Anzahl von Priestern und Laien gehört Padre Jose zu jenem jungen, erneuerten Christentum Brasiliens, das die Kirche wieder als Zeichen der Hoffnung für die Armen aufrichtet, als Zeichen einer ganz konkreten Hoffnung für Seele und Leib. Diese Christen wissen aber auch — und das ist wesentlich —, daß Jahrhunderte hindurch Christen das Volk verrieten, es seinem geistigen und materiellen Elend überließen; sie wissen, daß das nur gutzumachen ist durch wirklichen Dienst am Volke.
Es ist hier nicht der Platz, um von den harten Auseinandersetzungen zwischen traditionsgebundenen Christen und Avantgarde zu sprechen, die den ganzen lateinamerikanischen Kontinent durchdringen. Sie sind stark an politische und soziale Konzeptionen gebunden. Aber wir müssen wissen, daß in Brasilien eine junge, entschiedene, aus der Mitte des Evangeliums lebende Kirche ihren Weg sucht; durch Gefängnisstrafen, ^Verleumdung und härteste Opfer hindurch ist sie nicht nur ein Zeichen der Hoffnung für das Volk, sondern auch für jene Tausende und Abertausende junger Menschen, die die kompromittierte traditionelle Kirche verließen, die für sie nichts anderes als Pharisäertum und Fassade ist.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!