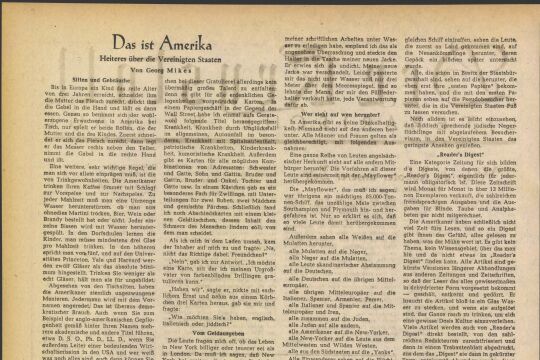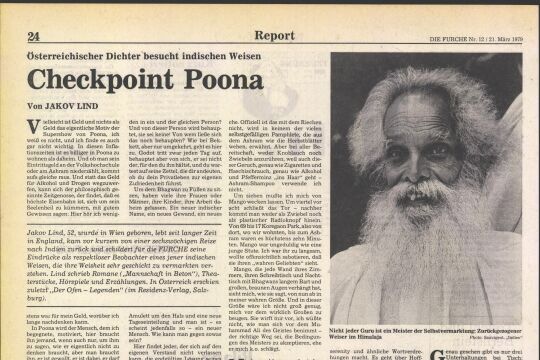IN PUNTA CAUCEDO, dem Flughafen von Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, erwartet die Ankommenden eine kleine Musikband. Ein paar Neger, Mulatten und Mestizen mit Ziehharmonika, Handtrommel, Blechkanister und Rasseln spielen den dominikanischen Nationaltanz, den Merengue.
Im Nu ist alle Flugmüdigkeit abgefallen, und unsere dominikanischen Gastgeber zeigen uns auch schon die Schritte dieses lebendigen Tanzes. Aber es steht wohl im Schicksalsbuch geschrieben, daß schwerfällige Mitteleuropäer diesen Raketentemporhyth-men nicht folgen können. Und unter dem Gelächter der Zuschauer geben wir unseren kläglichen Versuch auf. „Was für ein lebensfrohes, liebenswürdiges Volk“, sagen wir zu unseren Freunden. „Gewiß. Aber sehen Sie sich die Musikanten näher an, ihre Lumpen, ihre hohlwangigen Gesichter. Das ist die Kehrseite der dominikanischen Medaille. Wissen Sie, was das Hauptinstrument beim Merengue ist? Der knurrende Magen!“
Einer unserer dominikanischen Bekannten, Sohn eines deutschen Vaters und einer italienischen Mutter, aber nur eines absonderlichen kreolischen Singsangs mit den halbverschluckten Silben mächtig, so daß selbst ein Spanier Mühe hat, ihn zu verstehen, lädt uns zu einem Besuch des „barrio
pobre“, der Slums, ein. Aus der Hintertasche seiner Cowboyhose schaut der Schaft eines riesigen Colts hervor.
„Und das da“, fragen wir, „wozu?“ — „Amigo, es ist besser! Man weiß nie. Außerdem trägt hier jeder eine Pistole seit dem Sturz Trujillos. Wir wollen doch wissen, daß wir wieder frei sind.“ Ernst oder ironisch gemeint? Ich habe es nie erfahren. Jedenfalls näherte sich mir bald, nachdem wir ins Barackenviertel gekommen waren, ein Neger, der mir wild mit den Händen vor dem Gesicht herumfuchtelte. Drohungen oder bloß der Versuch, mir etwas mit Gesten deutlichzumachen?
Schon ist ein kleines schwarzes Mädchen da: „Mein Bruder ist nämlich stumm“, piepst es. „Er will Sie bloß fragen, ob Sie einen Revolver haben. Wenn nicht, kann er Ihnen einen verschaffen. 125 Bucks, ganz neu, aus Puerto Rico!“
DIE STIMMUNG IM „BARRIO POBRE“ ist feindselig. Ob wir unseren Rundgang durchführen können? Unser Führer konstatiert: „So geht das nicht. Ich muß das ändern.“ Er wartet, bis uns wieder ein Haufen schwarzer, brauner, gelblicher junger Leute umringt. Die Mienen sind nicht vertrauenserweckend. „Chicos, Jungen“, ruft unser Begleiter. „Das sind gute Leute, keine Yankees. Das sind — Deutsche!“ Mit einem Schlag ändert sich die Lage. Überall breitestes Lachen; eine Frau zupft mich am Ärmel, um mir ihr Kind — es ist fast ganz weiß, ein Wunder im Barackenviertel — zu zeigen; andere bitten uns, doch einen Schluck Rum in ihrer Hütte zu nehmen. Wir sind plötzlich willkommen und können tun, was wir wollen.
Natürlich möchten wir wissen, wieso Deutsche hier so beliebt sind. „Amigo! Die Leute kennen hier nur Yankees und Südamerikaner. Mit den einen haben sie keine guten Erfahrungen gemacht, von den anderen erwar-
ten sie. nichts. Bleiben die Europäer, und von denen kennen sie eigentlich nur die Deutschen. Wieso? Ich weiß es selbst nicht. Aber es ist ratsam, sich hier als Deutscher auszugeben.“
Vor einer Hütte steht ein alter schwarzer Mann. Er hat durch den „Slumtelegraph“ schon erfahren, daß „Deutsche“ da sind. Sein Lachen geht von einem Ohr zum anderen. „Wissen Sic, wie ich meine Söhne getauft habe? Hitler und Rommel! Und der Hitler hat uns seine Deutschen hergeschickt. Die haben im Norden, wo nur Disteln wachsen, die beste Erde im ganzen Land geschaffen.“
Tage später kamen wir darauf, was der Vater der pechschwarzen Rommel und Hitler gemeint hatte: Trujillo hatte kurz vor dem Krieg ein paar hundert jüdische aus Deutschland vertriebene Familien aufgenommen, die die besagte Provinz im Norden (Sosua) tatsächlich urbar machten. Und diese mit Mühe und Not geretteten Flüchtlinge hielten die braven Leute von Santo Domingo für Hitlers Abgesandte, ,
■ . ■ '*•■_*• tjfc
REIS, BANANENPÜREE, „HABl-CHUELAS“ — schwarze Bohnen —, und wenn es hochgeht „chorizo“, eine scharfe Wurst, sind die tägliche Mahlzeit im Slum. Wie könnten sich aber die Leute besser nähren, wenn einer, der 100 Pesos monatlich hat (Kaufkraft etwa 1600 Schilling), als Krösus gilt, da nur drei Prozent der Gesamtbevölkerung dieses Einkommen erreichen? Viele verdienen nur 60, oft nur 30 Pesos, und die meisten sind überhaupt arbeitslos. Natürlich gibt es eine dünne „Barackenaristokratie“, zum Beispiel Werftarbeiter, die Löhne bis zu 400 Pesos beziehen und darum in ihren armseligen, aber ziemlich sauberen Hütten Fernsehapparat und Eisschrank und vor der Wohnstätte, für die keine Miete gezahlt werden muß, oft sogar ein altes Auto stehen haben.
Aber die anderen, die den ganzen Tag herumlungern, mit der Rumflasche in einem schattigen Winkel sitzen oder sich im Billardsalon — was für ein Salon: vier Bretterwände und ein Tisch! — amüsieren, von was leben die? Die Antwort lautet lakonisch: „Vom Stehlen!“
Zwei Drittel der Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Leben ist freilich zuviel gesagt. Die meisten haben einen Taglohn von 1.50 Pesos, manche nicht einmal das. Die Nahrung ist noch kärglicher als im Baracken-
viertel. Gewiß ist die tropische Natur großzügig. Sic bietet den Menschen zu essen: Die Kokosnuß wächst das ganze Jahr, und je nach Saison gibt es Bananen, Mangofrüchte, Papayas, Zuckerrohr, Mais und vieles andere. Der Hunger kann wohl gestillt werden, aber die Menschen sind falsch ernährt, krank, kurzlebig.
70 Prozent der Bevölkerung sind mit Darmparasiten verseucht, die Tbc grassiert, jährlich gibt es 45.000 Malariafälle, von 1000 Säuglingen überleben nur 865 das erste Lebensjahr.
„GUTMÜTIG BIS ZUM EXZESS sind hier die Leute“, sagte unser Mentor. „Aber wehe, wenn sie in Zorn geraten, wenn der Rum sie hemmungslos macht!“ In der Tat: Fährt man über Land, sieht man häufig abgebrannte „Canaverales“, Zuckerrohrplantagen, an denen aufgebrachte Tag-löhner ihre Wut ausgelassen haben. In den Städten wird aus dem unsinnigsten Anlaß gestreikt, und die Streiks, eine Selbstverständlichkeit im dominikanischen Alltag, gehen selten ohne Gewalttätigkeit vor sich. Selbst
Schüler treten in den Ausstand, weil ihnen eine Maßnahme der Lehrer oder der Behörden mißfällt. Und da auch sie Schußwaffen tragen, schießen sie tapfer durch die Lüfte, und man wundert sich, daß es nicht mehr Opfer solcher „Freiheitsmanifestationen“ gibt, als die Zeitungen berichten. Läßt sich so eine Demokratie errichten, von der in Santo Domingo alles schwärmt, lassen sich unter solchen Umständen soziale und wirtschaftliche Reformen durchführen in diesem Land, wo es immer warm ist, überall Blumen blühen, die Sonne immer scheint, die
Menschen stets fröhlich wirken und selbst ihre Sorgen lachend erzählen?
„SOZIALREFORMEN, INDUSTRIALISIERUNG, Demokratie“, ruft unser Gastgeber aus, in dessen luxuriöser Villa wir zu einem Galadinner eingeladen wurden, „— alles wunderbar, und ich wünsche ehrlich, daß sie sich durchführen lassen. Aber unser Volk versteht doch nicht, um was es dabei gehtl Die Leute sind unwissend, faul und voller Laster. Da hat man ihnen von Landreform die Ohren vollgeblasen, und die Folge war, daß sie in einigen Gegenden, mit Macheten bewaffnet, auf ein Gut zogen, den Besitzer vertrieben und sich breitmachten. Felderbestellung, Wartung des Viehs? Keine Rede. Der Bürgerpräsident wird schon dafür sorgen, daß alles in Ordnung geht!
Ich habe nichts gegen Bodenreform. Sie ist unerläßlich und betrifft mich nicht. Zehn Prozent der bebauten Erde, ungefähr 3000 Quadratkilometer, gehörten den Trujillos, wurden vom Staat beschlagnahmt und können jetzt aufgeteilt werden. Außerdem gibt es wenigstens 10.000 Quadratkilometer Boden, die urbar gemacht werden könnten. Aber man muß auch die Zwerggüter zusammenlegen, denn die unwirtschaftlichen Minifundien machen 70 Prozent des Grundbesitzes aus. Und wenn man schließlich den 700 Familien, die etwa 25 Prozent des Bodens besitzen, etwas wegnimmt, wird sich niemand darüber ernstlich aufregen. Aber bedenken Sie: Hier können nur tropische Gewächse gepflanzt werden, und die brauchen eben Plantagenwirtschaft. Oder will man unter Kreolen Kolchosen 'einrichten? Das ist nicht einmal Fidel Castro gelungen!“
„Erziehung vermag doch viel!“
„Glauben Sie nicht, daß in diesem angeblich so frommen Land die Pfarrer den Leuten seit Generationen Unterricht in .Moral', ich meine das sechste Gebot, geben! Aber was geschieht? Verdient einer einmal 100 Pesos, dann nimmt er sich sofort eine Nebenfrau, und womöglich bald eine zweite, und so haben wir eine Bevölkerungszuwachsrate von über vier Prozent, eine der höchsten der Welt.“
„Würde die Industrialisierung, die Bosch vorhat, nicht auch die Leute ändern?“
„Wir haben doch schon seit Jahren einige Industrien, aber die städtischen
Arbeiter sind nicht besser als das Landproletariat. 60 Pesos Mindestlohn sind natürlich nicht viel. Aber in einigen Unternehmen wird ordentlich gezahlt, genug für eine gesunde Wohnung, ein Auto und gute Erziehung der Kinder. Aber was geschieht? Die Leute züchten Kampfhähne, verwetten alles, und haben sie nichts mehr, streiken sie, oder — sie bringen sich um.“
MISTER SHRIVER, Kennedys Schwager und Leiter des Peace-Corpi
Phoio: Herrmann
(Friedenskorps), zu Besuch in Santo Domingo, lädt uns ein, ihn auf einer seiner Fahrten zu begleiten. Nur ein paar Kilometer außerhalb der Stadt — Santo Domingo besteht aus einem riesigen Traumvillenviertel, aus Slums und einem schäbigen Stadtkern — wurde eine Schule errichtet. Vor einem fast fertigen einstöckigen Haus stehen ein paar Dominikaner, sehr bescheiden, aber ordentlich angezogen. Mit ihnen die Männer vom Peace-Corps. Ein uralter, zahnloser Mulatte hält eine Rede, ein Amerikaner übersetzt sie Shriver. „Sie haben uns, Senor Shriver, mehr gegeben als bloß eine Schule. Ihre Leute, jetzt unsere Freunde, haben uns gezeigt,' wie man ein ordentliches Haus baut, und das danken wir Ihnen. Man hat uns niemals etwas beigebracht, man hat uns vergessen, ich alter Mann kann nicht lesen und schreiben. Lind da sind Ihre Leute gekommen und haben uns gelehrt, wie man eine gerade Mauer errichtet, wie man mit dem Werkzeug umgeht. Jetzt wissen wir, unsere Kinder werden es wirklich besser haben.“
„Und wo werdet ihr die Lehrer hernehmen?“ fragt der sachliche Shriver. „Zuerst müssen wir uns mit Aushilfe aus der Stadt behelfen. Aber wir bekommen bald Lehrer, die ihre Schule nächstes Jahr abschließen. Dann ist alles in Ordnung, okay“, fügt der Greis seinen einzigen englischen Ausdruck hinzu, und in seiner Stimme liegen Tränen.'
„Mister Shriver“, frage ich auf dem Rückweg, „glauben Sie, daß Ihr Erziehungswerk gelingt?“ — „Why not? Mit Pessimismus erreicht man überhaupt nichts: Wir haben 2000 Leute in. unserem PeacerCorps, die mit den Menschen in den Entwicklungsländern leben, arbeiten, sich vergnügen sollen und so verstehen lernen, was fehlt und wo geholfen werden muß. Wir schenken nichts, wir bieten keine Kredite, wir lehren arbeiten. Die Schweden und die Deutschen haben auch schon ihr Friedenskorps gegründet. Etwas bringen wir schon zustande; wenn nicht morgen, so übermorgen.“
„ALLES AMI-PROPAGANDA! Die geben nichts, wo sie nicht das Doppelte daran verdienen“, äußert sich der europäische Kollege auf spanisch, damit Shriver ihn nicht verstehe. „Idiota!“ erwidert der dominikanische Chauffeur überzeugt.