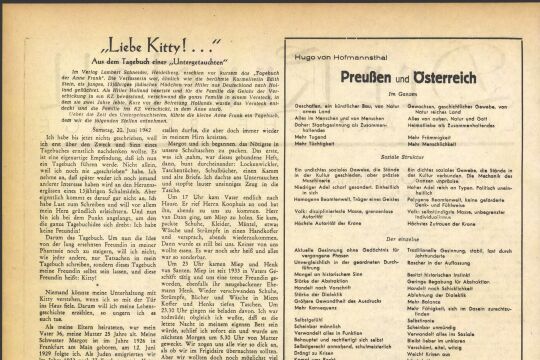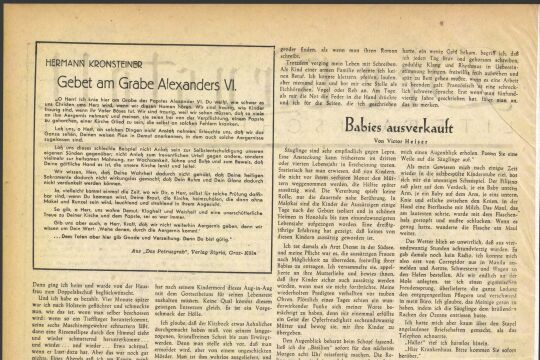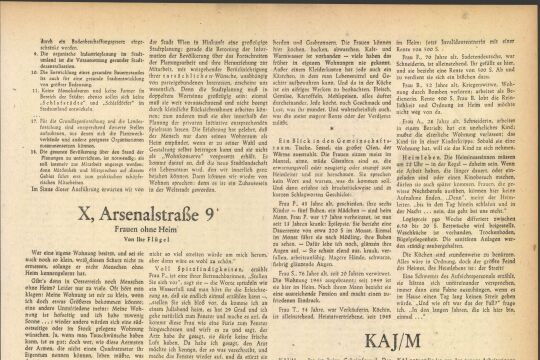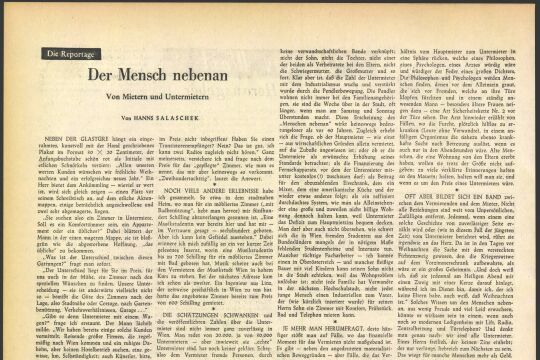Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Proletenpassion aus 1996
Strahlend sitzen sie bei mir im Büro. Sie kommen aus der Entbindungsstation des städtischen Spitals, um mir ihren kleinen Sohn zu zeigen. Manuel Alexander. Sechs läge alt. Schwarze Haare, Stupsnase. Rundum zufrieden liegt er in seiner Tragtasche, gewiegt von den zärtlichen Blicken seiner überglücklichen Eltern.
Seine Mutter putzt bei uns schon jahrelang das Büro. Sie ist „Rumäne-rin" wie sie selbst sagt —, seit mehr als zehn Jahren in Osterreich und bei uns mit einer Minimalanstellung beschäftigt. Reim wöchentlichen Kaffe-tratsch haben wir uns über all die Jahre besser kennengelernt. Oft hat sie mir von ihrer Familie in Rumänien und ihrem gar nicht einfachen Leben in Österreich erzählt. Sieben Geschwister hat sie in Rumänien, eine alte Mutter und ein Haus. Plötzlich gab es keine Arbeit mehr für sie, so folgte sie ihrer Schwester in die Schweiz. Irgendwie landete sie dann in Österreich und versuchte hier, zu überleben.
Die ersten Jahre waren geprägt vom Zittern um Aufenthaltsgenehmigungen und wechselnden Jobs als Tanzbär-Kellnerin bei korrupten Dienstgebern. Oft gab es kein Geld am Monatsende, oft war die versprochene Anmeldung nicht erfolgt, so-daß sie ihre Arztbesuche selbst bezahlen und um das Visum kämpfen mußte. Sie biß sich durch. Verlor sie einen Job, weil die Rar schließen mußte (meist waren nichtbezahlte Steuern, fehlende Gewerbegenehmigungen oder das Verschwinden des Besitzers die Ursache), suchte sie sich einen neuen und fand sehr schnell den nächsten türkischen oder jugoslawischen Rarbesitzer, der sie beschäftigte und versprach, sie anzumelden und ordnungsgemäß zu entlohnen.
Ihr größtes Problem war die Wohnungssuche. Kaum hatte sie ein Zimmer gefunden, mußte sie wieder ausziehen. Teure Mieten für kleine Löcher, die sie immer liebevoll einrichtete. Schöne Vorhänge, eine Waschmaschine, alles sollte sauber sein, darauf war sie sehr stolz. Fünfzehn Mal dasselbe Spiel - einmal nur knapp der Abschiebung entronnen, einmal von der besten Freundin um ihr Erspartes aus sechs Jahren gebracht. Für die gemeinsame Wohnung hatte sie es ihr geborgt und es nie wieder gesehen. Eine 'Tür vor der Nase zugeknallt, eine Freundin, eine Wohnung und fünfzigtausend Schilling weniger. Kurzfristig standen damals Waschmaschine und Habseligkeiten in unserem Rüro.
Von den Männern, die sie als korrupte Dienstgeber und grapschende Kunden erlebte, hielt sie wenig. „Es gibt keine guten Männer", sagte sie mir, wenn sie von den unzähligen Anträgen erzählte, die sie alle ausschlug. Zu viele „Rumänerinnen" hatten schon schlechte Erfahrung mit In- und Ausländern gemacht, so wurschtelte sie lieber allein weiter und war vorsichtig. Über Kinder sprach sie trotzdem gerne. Alle ihre Geschwister, ihre Cousins und Cousinen hatten Kinder. IJber alle schwierigen Geburten, Schulprobleme, Familienfeste, Scheidungen und Existenzsorgen erzählte sie mir detailreich. Wenn sie in die Heimat auf Besuch fuhr, wurden alle mit Geschenken bedacht. Ihre Deutschkenntnisse wurden immer besser, obwohl ihr die Nachtbars als Schule deutlich anzumerken blieb.
Irgendwann setzte sie sich in den Kopf, den Führerschein zu machen. Das Taxi fraß oft ihren halben Lohn, denn im Morgengrauen traute sie sich nicht Autostopp zu fahren. Die Angebote angeheiterter Barkunden schienen ihr zu gefährlich, deshalb mußte ein Führerschein her. Er kostete sie ein kleines Vermögen, da sie natürlich Sprachprobleme bei Fachausdrücken hatte und deshalb zweimal durchfiel. Zudem erfand der Fahrlehrer immer neue Gründe, um ihr zusätzliche Fahrstunden aufzubrummen. Schließlich schaffte sie es doch, ohne Dolmetsch und kurvte bald mit einem kleinen alten Auto durch die Gegend.
Irgendwann gestand sie mir im Vertrauen, daß sie unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen sei. Errötend wie ein Schulmädchen, obwohl längst über dreißig, fügte sie hastig hinzu: „Ich habe einen Freund, er ist Österreicher und sehr brav." Nachdem sie nun diese erste Diskretionshürde genommen hatte, erfuhr ich wöchentlich über ein Jahr lang, wie gut ihr Freund sie behandelt, daß er keinen Alkohol trinkt und sein Geld spart. Stolz berichtete sie, wie sie seine Junggesellenwohnung in ein gemütliches Heim verwandelt hat, die Vorhänge aus Rumänien mitgebracht und selbst genäht, ein Schlaf zimmer gekauft und für alle Zimmer Luster, die sogar seiner „so einer Ausländerin" abweisend gegenüberstehenden Mutter Bewunderung abnötigten. In allen Details hörte ich, was sie ihm kochte, für die Firma einpackte und wie sauber sie immer die Wohnung hält. Richtig glücklich, endlich ihre guten Hausfrauenkenntnisse umzusetzen und ihn damit glücklich zu machen.
Schließlich wurde geheiratet. Die Schwester kam aus der Schweiz und es gab ein kleines Fest mit rumänischen Speisen, dem die Schwiegermutter fern blieb. Danach holte er sie manchmal von unserem Rüro ab. Ein stiller, einfacher Mann, der sichtbar stolz auf seine hübsche, tüchtige Frau ist.
Das Glück ist perfekt, als sie schwanger wird. Da beunruhigt sie nicht einmal ernsthaft, daß sie kurz vorher ihre fixe Arbeit verliert. Sie sei mit ihm mitversichert. Er verdiene genug für beide, schließlich habe er einen ganz sicheren Job bei der Semperit, noch dazu in der Reifenabteilung, die als Herz des Retriebs von den gerüchteweise kursierenden Personalabbauplänen nie betroffen sein wird, versichert sie mir.
Die folgenden Monate kreisen unsere Kaffeegespräche um Rabyaus-stattung, Geburtsdetails und Kinderzimmerplanung.. Zum ersten Mal in Österreich fühlt sie sich beschützt und abgesichert. Sie hat nur mehr „schöne" Sorgen, ob die Schwester die Wippe, der Rruder die versprochene Ra-bykleidung rechtzeitig schickt, ob sie zur Schwangerschaftsgymnastik gehen und wie sie ihre' Ernährung umstellen soll, um nicht zu schnell zuzunehmen.
Jetzt sitzen sie bei mir mit ihrem Raby, und ich frage nach vielen bewundernden Ahs und Ohs eher beiläufig, weis von den Zeitungsberichten über Probleme in der Semperit zu halten sei, da ich immer an sie beide denke, wenn ich davon lese. Und wie froh ich bin, daß er ja nicht betroffen sein kann. Er wird ganz still, ein Schatten huscht über sein Gesicht: „Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht." Da bricht es aus ihm heraus, er erzählt, wie er, der schüchterne Mann, wohl noch nie mit fremden Leuten gesprochen hat. Von den ersten Re-unruhigungen im Vorjahr, als man ihnen dauernd gesagt hat, daß die deutschen Kollegen viel bessere Arbeit leisteten. Als sie auf die höheren Löhne dieser Kollegen verwiesen, verstummten die unterschwelligen Aufforderungen, mehr zu leisten. Im Frühjahr gab es eine riesige Jubiläums-Feier der Firma, zu der sie alle geladen waren, bei der das erste und einzige Mal ihre Arbeit in höchsten Tönen gelobt wurde. „Und jetzt reden sie vom Zusperren," er greift sich an den Kopf. Angefangen habe es damit, daß überraschend die Akkordarbeit wieder eingeführt wurde, die schon jahrelang kein Thema mehr im Retrieb war. Man wollte Qualität, war damals das Argument gegen den Akkorddruck. Plötzlich „durften" sie alle wieder im Akkord arbeiten. Das heißt, sie mußten. Als sie die früher üblichen Prämien einforderten, wurden sie darüber aufgeklärt, daß es keine gibt, weil es sich bei dieser Akkordarbeit nur um ein Angebot der Firma für Freiwillige handle. Alle haben im Akkord gearbeitet, denn „wer traut sich das schon, wenn bereits von Kündigungslisten die Rede ist?" Er wird immer bitterer. Eine Versammlung der Belegschaft habe vor dem Werk stattgefunden. Sie wurden ordnungsgemäß informiert und gleich darüber aufgeklärt, daß sie zwar ruhig teilnehmen könnten, ihre Akkordzahlen aber trotz verringerter Arbeitszeit erfüllen müßten. Also sind sie alle nicht hingegangen, denn sie waren sich einig, daß schon am nächsten Tag der Akkord erhöht wird, wenn sie ihre Stückzahlen für acht Stunden auch in sieben erledigen würden. In den Betriebsrat hat er kein Vertrauen, „der beschwichtigt nur" und die Gewerkschafter reden dauernd von „Kompromißbereitschaft", die wir zeigen müßten. Die Politiker, die jetzt so groß reden, die haben uns auch versprochen, daß die For-schungs- und Entwicklungsabteilung nicht nach Deutschland ausgegliedert wird. Getan hat es die Firmenleitung trotzdem.
„Solidarität wird es in der Sempe-rit nie geben können!", meint er resignierend. Dazu wären zu viele ausländische Kollegen im Betrieb, die auch um die Hälfte arbeiten. Jetzt wird doch nur mehr einer gegen den anderen ausgespielt, und alle haben Angst. Uberall gibt es Informationen, daß man sich über einen finanziell vorteilhaften Ausstieg aus der Firma erkundigen kann. „Keiner traut sich, das zu tun, weil wir fürchten, daß auch darüber Listen angelegt werden und diese Interessierten dann als erste gekündigt werden." Der kleine Manuel Alexander ist längst an der Brust seiner Mutter eingeschlafen. „Sie können uns nicht alle 2.000 auf die Straße setzen. Sie werden sicher einen Fonds einrichten und uns umschulen. Ich muß ja noch fast 30 Jahre arbeiten, um eine Pension zu kriegen. Bei mir lohnt sich das auf jeden Fall. Und lernen kann ich alles."
Behutsam legt er den Winzling in die Tragtasche. Die Familie verläßt uns. Ich komme zum Kaffeetrinken, verspreche ich, sie wollen mir ihre Wohnung zeigen. Silvana will den besonderen Kuchen backen, mit dem Rezept der Cousine aus Rumänien...
PS. Der kleine Manuel Alexander ist bereits zwei Monate alt und gedeiht prächtig. Sein Vater erhielt gestern die Kündigung!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!