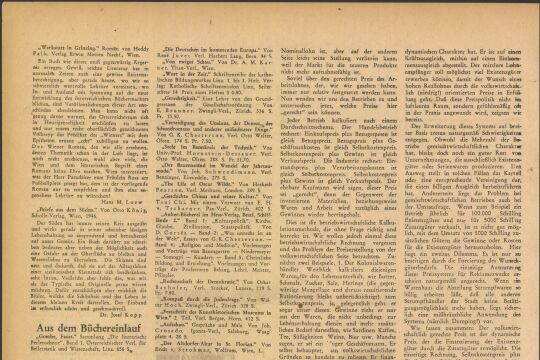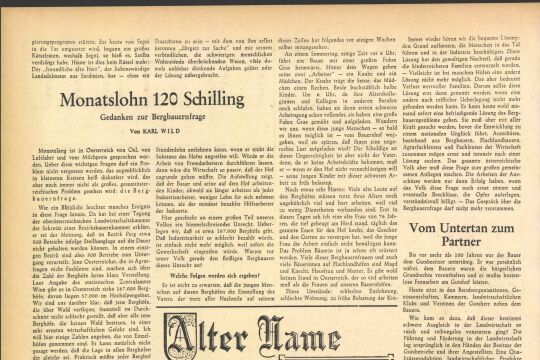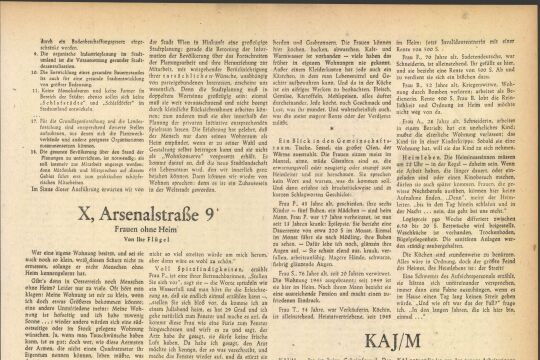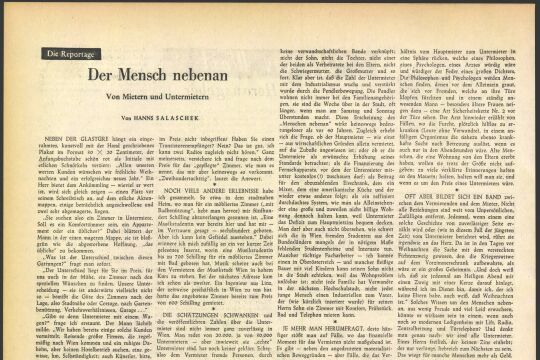Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Menschen - und Fremdarbeiter
„Gastarbeiter“ — die meisten Österreicher assoziieren zu diesem Wort wenig Positives. Ungepflegt, um nicht zu sagen schmutzig, entweder finster dreinblickend oder aufdringlich grinsend, mit einem Wort suspekt; das sind so die Adjektiva für eine gesellschaftliche Minderheit, deren soziale Deklassierung in politischen Sonntagsreden mit der Bezeichnung „Gast“-Arbeiter nur kaschiert wird.
„Gehen Sie da bloß nicht allein hinein!“ warnten mich die Nachbarn, als ich ein völlig verwahrlostes, abbruchreif wirkendes Gebäude in einer Seitengasse des 15. Wiener Gemedndebezirkes betrat, in dem angeblich „wahre Massen von Halbzigeunern und Tschuschen“ hausten. Die Leute schienen recht zu haben: Tatsächlich traf gleichzeitig ein Wagen der Funkstreife ein, um eine Messerstecherei zu schlichten.
Dieser Aspekt des Gastarbeiterproblems ist ja auch der einzige, der den Tageszeitungen Schlagzeilen liefert. Schlagzeilen, die die Mauer des Vorurteils immer höher und unüberwindlicher machen. Nach dem Warum fragt niemand, das verkauft sich schlechter.
Und so sieht das „Fremarbeiter- ghetto“ aus, das ich auf stöberte: 30 Jugoslawen unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen in einem aufgelassenen Lagerschuppen. „Wer will schon einen Ausländer als Untermieter?“ fragte ein 27jähriger Hilfsarbeiter aus Serbien resigniert.
Er „wohnt“ mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einem zehn Quadratmeter großen Zimmer, dessen Mobiliar aus zwei Betten und einem Tisch besteht. Es gibt weder Wasser noch Toiletten. Das Wasser wird aus dem Nebenhaus geholt. Wer auf die Toilette muß, geht ins nächste Gasthaus.
Die monatliche Miete beträgt 600 Schilling. Der Mann arbeitet in einer Werkstätte der Wiener Verkehrsbetriebe, wo er im Monat 2400 Schilling verdient. Dazu kommt noch die Kinderbeihilfe von etwa 1000 Schilling. Man kann darüber streiten, ob fünf Personen davon leben können, dieser Mann will aber nicht nur „durchkommen“, sondern sich etwas ersparen. Er hat ein Haus in Jugoslawien („viel schöner als das hier!“, versichert er). Allerdings kann er es nicht erhalten. In Jugoslawien kann nur ein Familienmitglied Arbeit finden und der Lohn ist noch niedriger als hier.
Besser geht es einem etwa 40jäh- rigen Kroaten, der auf der anderen Seite des vor Schmutz starrenden und mit Gerümpel verstellten Hofes wohnt. Er teilt sein Zimmer mit drei Kollegen. Einer muß immer auf dem Boden schlafen, denn es gibt nur drei rostige Feldbetten. Der Hausbesitzer, ein Altwarenhändler, kassiert 1200 Schilling pro Monat für dieses Zimmer. Die Männer sind Bauern, die sich hier als Hilfsarbeiter verdingen, um ihre kleinen Höfe, die sie zu Hause haben, erhalten zu können. Sie arbeiten doppelte Schicht und Akkord, damit etwas übrigbleibt. Die Löhne sind dadurch ansehnlich: 7000 Schilling im Monat.
Zwei Frauen wohnen in einer Waschküche. Sie arbeiten in einer Großküche und in einer kleinen Buchbinderei und verdienen durchschnittlich 2000 Schilling. Davon zahlen sie 900 Schilling Miete.
Diese Menschen verbringen durchschnittlich zwei Jahre in Österreich, um zu arbeiten und zu sparen. Während dieser Zeit haben alle Heimweh — kein Wunder, sie sind zwar billige Arbeitskräfte für unsere Wirtschaft, werden aber von den Einheimischen wie Asoziale behandelt. Auf die Dauer muß dieser Zustand, verbunden mit wirtschaftlichem Elend, zu Aggressionen führen, die sich in Gewalttätigkeiten entladen.
Auf die Idee, sich um die Unterkünfte der Gastarbeiter zu kümmern, kommt kaum ein Dienstgeber. Die Wiener Verkehrsbetriebe schaffen wenigstens für einen Teü ihrer nicht einheimischen Arbeiter Abhilfe. Sie beschäftigen etwa 30 jugoslawische Arbeiter in ihren Werkstätten. Senatsrat Dr. Ehrenfreund von der Personalabteilung meint, daß die Zahl,im nächsten Jahr auf- gestockt wird. Der Kontakt mit den Wiener Verkehrsbetrieben wird größtenteils durch Bekannte hergesfeilt, die schon längere Zeit dort arbeiten.
Da die Männer ausnahmslos ohne Ausbildung kommen, können sie nur als Hilfsarbeiter eingestellt werden und verdienen daher auch relativ wenig, durchschnittlich 2400 Schilling pro Monat. Wegen der mangelnden Sprachkenntnisse ist eine weitere Schulung kaum möglich und damit auch die Aussicht auf besseren Verdienst und berufliches Weiterkommen gering. Aber hier hat man zugleich mit der Einstellung von Arbeitern aus dem Ausland Unterkunft für sie geschaffen. Im 9. Bezirk, in der Grünentorgasse, gibt es eine Art Heim. 53 Plätze können dort vergeben werden, nur 20 sind zur Zeit belegt.
Es gibt Fließwasser und Kochplätze, die Zimmer sind einfach, aber sauber. Ein Aufseher sorgt dafür, daß sie es auch bleiben. Damit tritt man einem weitverbreiteten Argument entgegen, man könne „diese Leute“ in kein „ordentliches Haus“ einziehen lassen, da sie in Kürze „alles verschlampen“. Dieser Ansicht waren auch die entsetzten Nachbarn, als sie von dem Projekt der „Fremdarbeiterherbergen“ erfuhren. Ein wahrer Sturm von Beschwerden setzte ein, solche Nachbarn seien einfach unzumutbar.
Die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Bis jetzt gibt es keinerlei Klage. Weder Raufereien noch ein verschlamptes Haus. Das große Plus für die Arbeiter: Sie zahlen nur 30 Schilling Miete im Monat. So können sie sich von ihrem Lohn doch noch Ersparnisse zurücklegen, da sie sehr bescheiden leben. Allerdings hat die Sache einen Haken: Nur Alleinstehende können Unterkommen. Für Familien bleiben mit wenigen Ausnahmen nur die Elendsquartiere.
Nach dem letzten stärkeren Regen wurde das Gesundheitsamt des 15. Bezirkes verständigt. Der Hof des beschriebenen alten Hauses stand völlig unter Wasser. Sämtliche Kanäle liefen über und die sich selbst überlassenen Kinder der Gastarbeiter spielten im Schlamm. Die Kommission war erschüttert über die herrschenden Zustände. Aber das Gesundheitsamt kann von sich aus nichts unternehmen, es kann nur Anträge stellen und Vorschläge unterbreiten. Die einzige Behörde, die einschreiten und dazu beitragen könnte, daß Wien keine Slums hat, und sich nicht Hausbesitzer am Elend ausländischer Arbeiter bereichern, wäre die Baupolizei.
Der ach so soziale Staat sieht seine Grenzen offensichtlich genau dort, wo die sozialen Fälle eigentlich erst beginnen.
Wegen eines Storches mit einem Pfeil in der Brust aber gibt es tagelang Schlagzeilen in den Zeitungen. Daß mitten in Wien Menschen schlechter als Tiere vegetieren, rührt kaum eines der goldenen Wiener Herzen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!