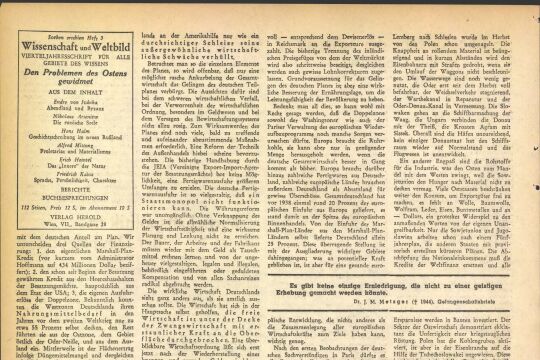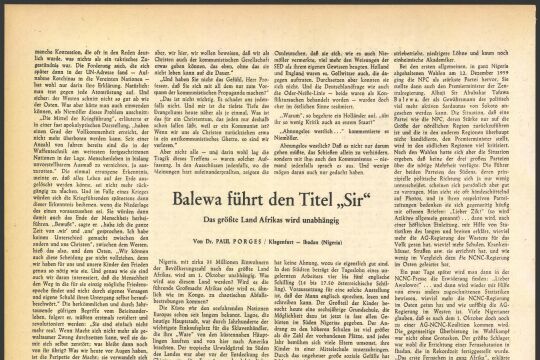Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Saisonniers aus dem Armenhaus
Die Kosovo-Albaner schik- ken ihre Söhne zum Geld- verdienen ins Ausland. Mußte es früher ein ausran- gierter Mercedes sein, wer- den jetzt die Devisen in Fir- mengründungen gesteckt.
Die Kosovo-Albaner schik- ken ihre Söhne zum Geld- verdienen ins Ausland. Mußte es früher ein ausran- gierter Mercedes sein, wer- den jetzt die Devisen in Fir- mengründungen gesteckt.
Saisonniers" sind derzeit der ein- zige Exportschlager der von ethni- schen Spannungen und sozialem Elend gleichermaßen geschüttelten Provinz Kosovo. Seit Anfang März fliegt jeden Tag dreimal eine Ma- schine mit Arbeitswilligen in die Schweiz. Die Eidgenossen bieten wenigstens in begrenzten Rahmen Möglichkeiten zum Geldverdienen. Daß die Arbeitsbewilligung auf drei Monate beschränkt bleibt, stört die Gastarbeiter aus Jugoslawiens Armutswinkel am wenigsten: et- was ist noch immer besser als gar nichts!
Da jeder Albaner - schließlich sind sie die gebärfreudigste Natio- nalität Europas - über eine Un- zahl von Brüdern, Vettern und Onkel verfügt, ist immer für „Nach- schub" an Hilfskräften gesorgt. Außerdem kann man so im Sippen- verband genügend Kapital für die Gründung eines Betriebes zusam- mentragen.
Tatsächlich ist es in den letzten Monaten zu einem Betriebsgrün- dungsboom gekommen. Neben dem beträchtlichen Devisentransfer seitens der Gastarbeiter hat die Regierung Markovic' die Prozedu- ren für die Betriebsgründung we- sentlich vereinfacht. Außerdem wurde der Steuersatz für Privatun- ternehmen von 60 auf 30 Prozent reduziert.
Früher hatte die hohe Besteue- rung zu abenteuerlichen Zustän- den in Handel und Gewerbe ge- führt: Während für die ersten zwei Jahre nach Betriebsgründung Steu- erfreiheit winkte, wurde mit der 60-Prozent-Besteuerung dem her- beigeredeten „freien Unternehmer- tum" die Daumenschraube ange- legt. Um dem Fiskus zu entkom- men, war es allgemein üblich, nach zwei Jahren das Fleischergeschäft zu schließen und statt dessen eine Boutique zu eröffnen. Von beiden Sparten hatte der „Unternehmer" in der Regel keine Fachkenntnisse. Steine und Plastikstückchen in der Salami, Kleider mit aufgegange- nen Nähten, Schuhe, die beim er- sten Regenguß die Sohle verloren, waren dann das Resultat. Zum Ärger der Konsumenten.
Daß jeder albanische Hausvater seine erwachsenen Söhne zum Geldverdienen ins Ausland abkom- mandiert, gehört zur Tradition. Die verdienten Devisen aber mußten früher - aus Prestigegründen - in Form eines ausrangierten Merce- des oder Opel heimgebracht wer- den. Fast skurril muten dem Besu- cher die Nobelkutschen vor den ärmlichen Häusern in den engen Gassen Priätinas an. Erst jetzt ren- tiert es sich, das Geld effektiver anzulegen. Azem zum Beispiel hat in seinem Bauunternehmen schon 120 Beschäftigte. Gaststätten, Tischlereien und Import-Export- läden schießen überall aus dem Bo- den. Seit Anfang März können auch die Bauern Grund dazukaufen.
In Jugoslawien findet sich der klassische Nord-Süd-Konflikt im kleinen: Lange Zeit galt der Koso- vo als Faß ohne Boden. Die nörd- lichen Republiken sind nicht nur „reicher", sie leisten Entwick- lungshilfe, die den Bedürftigen nie zugute kommt. Seit 1964 gibt es den „Fonds für unterentwickelte Regionen". Die Albaner, die 90 Pro- zent der Bevölkerung stellen, ha- ben aber keinen Einfluß darauf, wo und wie die Hilfsgelder eingesetzt werden. Westliche Beobachter in PriStina meinen, daß die Zuschüsse im Parteisumpf versickern. Tito wollte mit großspurigen Projekten die Bevölkerung zufriedenstellen. Nach der Zweckmäßigkeit wurde dabei nicht gefragt. So wurde die Priätiner Universität überdimensio- nal angelegt. Die Mehrheit der 50.000 Studenten widmet sich den Geisteswissenschaften. Techniker oder Wirtschaftsfachleute hingegen sind Mangelware. Die Massenar- beitslosigkeit der Akademiker kommt daher nicht von ungefähr.
Die Jugendarbeitslosigkeit klet- tert manchmal auf 90 Prozent, die der Erwachsenen auf 40 bis 50 Prozent. Dabei ist das Arbeitskräf- tepotential durch die Überbeschäf- tigung im Agrarsektor, in dem ein Viertel der Bevölkerung offiziell beschäftigt ist, noch lange nicht ausgeschöpft. Die Gehälter sind um zwei Drittel niedriger als in Slowe- nien, das Pro-Kopf-Einkommen beträgt sogar nur ein Siebentel. Die Zweimillionenprovinz kann nur magere 2,1 Prozent des jugoslawi- schen Sozialprodukts erwirtschaf- ten. Beim Export fällt gar nur 1,6 Prozent auf Güter aus dem Kosovo, und davon wird lediglich etwas über ein Prozent in Hartwährungslän- der exportiert. Wie eingangs er- wähnt, ist die Ware „Arbeitskraft" so ziemlich das einzige Kapital der Provinz.
Wie ein Entwicklungsland ver- fügt der Kosovo kaum über verar- beitende Industrien. Das Heraus- pressen von Rohstoffen ist für den Staat einziges Interesse: 50 Pro- zent der Kohle, 87 Prozent aller Erze sowie die gesamte Magnesit- produktion wird dort abgebaut. Zurück bleiben nur Schutt und Asche und eine verheerende Luft- verschmutzung. Die Hausfrauen in Priätina müssen ihre Gardinen - falls sie sich solche leisten können - alle zwei Wochen waschen.
Das „Grand Hotel" im Herzen PriStinas gilt als Absteige Nummer eins für die spärlichen Westtouri- sten. Das Gebäude hat Symbolcha- rakter für Titos gescheiterten „Dritten Weg": großspurig in der Konzeption ist es nach einer Deka- de schon zur Ruine verkommen. An der Fassade fehlen viele Marmor- platten. Die vorbeikommenden Bauern brechen sie ab. Das Mate- rial eignet sich doch bestens zum Abdecken des eigenen Hausdaches!
Es wäre aber verfehlt, die Schuld für die wirtschaftliche Misere al- lein den Belgrader Planwirtschaf- tern oder den serbischen Chauvini- sten in die Schuhe zu schieben. Die lokalen Traditionen, mit einem rigiden Islam und einem gewalttä- tigen Patriarchat, begrenzen glei- chermaßen den Raum für den Fort- schritt: An die 600 Familien sind in Blutfehden verwickelt. Die Land- wirtschaft ist weitgehend Frauen- sache. Der Bauer fährt morgens seine Frauen - in der Regel hat er mehrere - auf die Felder. Mit pri- mitivem Werkzeug bearbeiten sie den Acker. Ihr „Herr" hilft ihnen höchstens beim Aufladen der Krautköpfe. Diese verbreiten, wie auch alles andere Gemüse, beim Kochen einen Geruch, der sehr an eine öffentliche Bedürfnisanstalt erinnert. Kein Wunder: die Felder sind hoffnungslos überdüngt: Auf den ein bis drei Hektarflächen werden die Fäkalien von 20 bis 30 Personen „entsorgt". Aber um hygienische Standards kümmert man sich nicht. Kraut ist Kraut.
Obwohl die politische und sozia- le Rangreihe ganz klar die wenigen Serben als „Kolonialherren" aus- weist, sind die Albaner keineswegs die „underdogs". Diese Position nehmen die zahlreichen Zigeuner ein. Über die genaue Anzahl dieser Volksgruppe gibt es keine Daten. Man sieht sie aber überall. Mit Handkarren, vollbepackt mit Ab- fällen, ziehen sie durch die Straßen der Städte. Sie betreiben auf ihre Art „Abfallverwertung": in den Müllcontainern wühlen sie nach Papier, Glas, alten Kleidern und derlei mehr. Mist und „Rohstoff" werden auf die Straße geworfen. Streunende Hunde und Katzen balgen sich um die Speisereste. Kleine Kinder spielen inmitten des Mistes und den, oftmals kranken, Vierbeinern. Mit oft üblen Folgen: Letzten November starben rund 200 Kinder an den Folgen einer Epidemie, die die Streuner über- trugen. Zwar werden viele Tiere von erbosten Anrainern erschlagen, die Kadaver aber räumt niemand weg. Die Medien wettern zwar re- gelmäßig über diesen Mißstand, aber niemand fühlt sich verant- wortlich, etwas in dieser Hinsicht zu unternehmen.
Wie in allen (ehemals) kommuni- stisch regierten Ländern liegt die öffentliche Moral am Boden: Dieb- stahl und Korruption werden von den Menschen längst nicht mehr als solche empfunden. Verirrt sich ein Tourist in den engen Gassen der Pristiner Altstadt, fordern selbst- bewußte Halbstarke „Tribut". An der Universität werden Zeugnisse im Tausch für Devisen vergeben. Da das Gehalt der Professoren um die 2.000 Schilling liegt, wundert dies nicht. Kürzlich verweigerte ein Dozent die Annahme des „Prü- fungsgeldes". Die gewitzten Stu- denten bedrängten daraufhin des- sen Ehefrau, die weitaus pragmati- scher jdachte, das Geld nahm und entsprechenden Druck auf den Prüfer ausübte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!