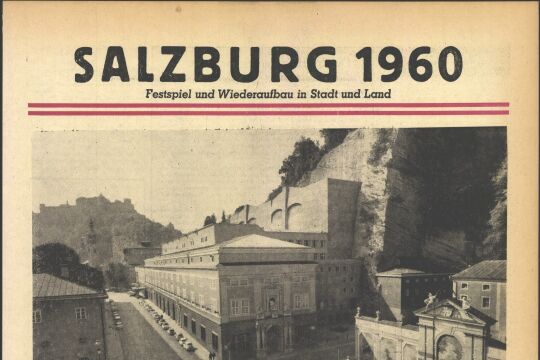Zu einer Zeit, da die Bundesregierung die Frage des Einheitswertes einer einigermaßen befriedigenden Lösung zuführen konnte, ist dieser Beitrag, der konkretes Zahlenmaterial aus einem der österreichischen Bundesländer vorlegt, von besonderem Interesse.
*
Finanzverwaltung und Gesetzgeber stehen in Oberösterreich seit einiger Zeit unter schwerem Beschuß: Die Auswirkung der Neufestlegung der Einheitswerte — so argumentiert man — würde sehr rasch eine Vernichtung und Umschichtung des Eigentums an Grund und Boden sowie an Wohnhäusern zur Folge haben — während man eich gleichzeitig und nicht allzu erfolgreich bemüht, neues Eigentum, etwa vermittels Kleinaktaen, zu schaffen. Erschwerend wirkt noch die Tatsache, daß Grund- und Hauskäufe von Ausländern nicht nur nicht verhindert, sondern daß die vereinzelten Käufe mit meist nicht ortsüblichen Kaufsummen zum Anlaß genommen werden, die Einheitswerte bed österreichischen Eigentümern, die keinerlei Absicht haben, zu verkaufen, nach oben anzupassen. Diese in zweifacher Hinsicht unsinnige Praxiis hat dazu geführt, daß die neuen Einheitswerte in Oberösterreich weit höher als in den anderen österreichischen Bundesländern festgelegt werden.
Die angeführten Beispiele mögen kraß sein und sind vielleicht nicht überall die Norm — sie haben jedoch den Vorteil, drastisch aufzuzeigen, wie rasch Österreich den Weg zu einer völligen Besitzumschichtung beschreiten würde, ohne daß man heute sagen könnte, wessen Vorteil letztlich diese Entwicklung wäre.
Der Einheitswert eines Einfamilienhauses in Linz war bisher mit 154.000 Schilling und ist nun mit 606.000 Schilling festgelegt. Die Grundsteuer würde von 1500 auf 4040 Schilling, die Vermögenssteuer von 1200 auf 3800 Schilling steigen.
Bei einem Althausbesitz im Zentrum von Linz betrug der bisherige Einheitswert 547.900 Schilling und Wurde auf 2,499.000 Schilling hinaufgesetzt. Die Grundsteuer würde demnach im gegebenen Fall von 5000 auf 20.800, die Vermögenssteuer von 4485 Schilling auf 19.000 und die Erbschaftssteuer von 20.000 auf 350.000 (!) Schilling steigen. Nicht nur in Linz
Diese Situation aber ist keineswegs auf den Raum von Linz beschränkt. Hier weitere Beispiele aus Oberösterreich:
Für ein gemischt genutztes Grundstück mit Althaus in Schärding soll ein Einheitswert von 149.000 statt bisher 11.200 Schilling festgesetzt werden;
der Einheitswert eines Nebenhauses in Schärding soll von 22.700 auf 88.000 Schilling erhöht werden;
ein Altbaus in Schärding soll einen Einheitswert von 216.000 statt bisher 44.700 Schilling bekommen;
Seit Monaten befaßt sich die Handelskammer in Linz und ihr Präsident Dr. Schütz intensiv mit dieser einkommenzerstörenden Entwicklung. Man betont dabei ausdrücklich, daß es sich um ein Problem handelt, das praktisch alle Stände und Einkommenschichten berührt, die einkommenschwachen Bevölkerungskreise aber besonders hart trifft. Auch dafür kann man eine Fülle von Beispielen anführen:
Eine Pensionistin mit einer monatlichen Pension von 1350 Schilling verfügt über ein ererbtes Einfamilienhaus, in dem sie wohnt, aus dem sie aber keine Einnahmen bezieht. Darüber hinaus liegt auf dem Haus und dem Grundstück ein Bauverbot, so daß keinerlei bauliche Änderungen und Erweiterungen vorgenommen werden können. Bisher mußte für dieses Haus jährlich an Grund-und Vermögenssteuern 2700 Schilling bezahlt werden; in Hinkunft aber sollen es 9100 Schilling sein, so daß die Pensionistin mehr als die Hälfte ihrer Pension, nämlich monatlich 751 Schilling, für die Vermögensund Grundsteuer beiseite legen muß, um die Steuern bezahlen zu können, von der vorgesehenen Nachzahlung mit 1. Jänner 1963 in der Höhe von 19.200 Schilling gar nicht zu sprechen, die zu einem sofortigen Verkauf des Hauses zwingen würde.
Die bisher für eine Liegenschaft zu bezahlende Erbschaftssteuer einschließlich der weiteren mit dem Einheitswert zusammenhängenden Abgaben betrugen bisher 13.564 Schilling; sie sollen nun 96.971 Schilling ausmachen, eine Summe, die von den Erben unter keinen Umständen aufgebracht werden kann und zum sofortigen Verkauf der Liegenschaft zwingen würde.
Weitere Ungerechtigkeiten
Man hat aber in Oberösterreich noch weitere Munition auf Lager, um zu beweisen, daß man geneigt ist, bei Berechnung der neuen Einheitswerte in Oberösterreich besonders radikal vorzugehen. Der Bodenwert beträgt etwa im Zentrum des stei-rischen Judenburg 500 Schilling je Quadratmeter, im Zentrum von St. Pölten 700 Schilling je Quadratmeter, dm Zentrum von Wels aber 1500 Schilling je Quadratmeter. Während der Bodenwert in der Gumpendorfer Straße in Wien mit 600 Schilling je Quadratmeter beziffert wird, erreicht er in der Herrenstraße von Linz, die gewiß nicht zu den besonders bevorzugten Geschäftsstraßen der Stadt gehört, auch wenn sie zentral gelegen ist, mehr als das Vierfache, nämlich 2500 Schilling je Quadratmeter. Vergleichbare oberösterreichische und niederösterreichische Bezirksstädte zeigen folgendes Bild: Im Zentrum von Amstetten macht der Bodenwert 350 Schilling je Quadratmeter aus. Die Erhöhung gegenüber 1956 beträgt 140 Prozent. Im Zentrum von Braunau aber macht der Bodenwert je Quadratmeter 700 Schilling aus.
Die Erhöhung gegenüber 1956 macht daher 280 Prozent aus.
Die Erbitterung gegenüber den beabsichtigten Bewertungsmaßnahmen ist verständlich, weil bei fast allen Neubewertungen der Steuererhöhung keinerlei erhöhte Einnahmen, in sehr vielen Fällen überhaupt keine Einnahmen, gegenüberstehen. Daher verweist man darauf, daß es sich also vielfach um konstruierte und fiktive Mehrwerte handelt, praktisch um Konfiskationsversuche.
Besonders hart trifft die Neubewertung natürlich alle jene Personen, die ihr Eigentum überhaupt nicht verkaufen wollen. Mit Recht fragte man daher auch, wie die Situation im Falle einer Wirtschaftskrise wäre. Käme es zu einer solchen, könnte ein Großteil der Abgabepflichtigen die steuerliche Mehrbelastung nicht mehr tragen. Schlagartig würde eine Unmenge von Liegenschaften und Häusern zum Kauf angeboten werden. In dieser kritischen Phase würde man sofort und sehr deutlich sehen, daß der gegenwärtig von den Finanzämtern geschätzte Preis überwiegend völlig unreal ist, nie erzielt und praktisch zu einer Massenliquidation von Eigentum führen würde. Gerade in einer Krisensituation könnte aber der Staat kaum eine Umgruppierung in seinem Steuerwesen vornehmen.
Für gerechte Lastenverteilung
Erschwert wird das Problem auch durch die Tatsache, daß es sich bei der Festsetzung des Einheitswertes, der die Bemessungsgrundlage für nicht weniger als sechs Steuern und Abgaben ist (Vermögenssteuer, Erbschaftssteueräquivalent, Grundsteuer, Bodenwertabgabe, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer) keineswegs nur um Geldquellen handelt, die ausschließlich dem Bund zufließen, so daß verständlicherweis auch die Gemeinden mitzureden haben. Aber dieselben Argumente, die dem Bund gegenüber gelten, gelten natürlich auch den Gemeinden gegenüber. Und deren sicherlich stark angestiegenen Ausgaben entsprechen anderseits auch stark erhöhte Einnahmen. So ist etwa in Oberösterreich seit 1948 (=100 Prozent) die Gewerbesteuer auf 998 Prozent angestiegen, die Lohnsummensteuer auf 869 Prozent, die Summe der Lebenshaltungskosten auf 278 Prozent, die Großhandelspreise haben sich auf 299 Prozent, die Kleinhandelspreise auf 214 Prozent, die dem Bund zukommende Einkommenssteuer auf 753 Prozent und die Lohnsteuer auf 558 Prozent erhöht.
Man sollte also, bei allem Bemühen, die Lasten in Österreich so gerecht wie möglich zu verteilen, nicht auf der einen Seite nach neuen Möglichkeiten einer Einkommensbildung Umschau halten und etwa Besitzfestigungsaktionen mit viel Geld und Mühe starten, und auf der anderen Seite das längst zusammengeschmolzene private Eigentum noch mehr reduzieren helfen.
Seit mehr als einem Jahr tragen Beamte die unter dem Namen „Wachstumsgesetze* auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt gewordenen wirtschaftspolitischen Gesetzentwürfe von Amt zu Amt, von einem Ministerium zum anderen, zu den Interessenvertretungen und wieder zurück. In den Kanzleien wanderten diese Akte mehrmals von der linken auf die rechte Seite des Schreibtisches. In dieses Spiel haben sich seit einem Jahr die Minister eingeschaltet. Zu einem greifbaren Ergebnis ist es bisher nicht gekommen. Oder, um die Lage zu verdeutlichen, den augenblicklich aktuellen Fußbal-lerjargon zu verwenden: zahlreiche Schüsse verfehlten das Tor; die redliche Mühe des in diesem Fall als Miffelsfürmer spielenden Finanz-minister Wolfgang Schmitz hatte auf dem holprigen Rasen der Investitionsfinanzierung keinen Erfolg. Die Koalition konnte sich wieder einmal nicht einigen.
Worum handelt et sich bei den vielzitierten Wachstumsgesetzen! Obwohl die Materie reichlich vielfältig ist, läßt sie sich mit dem Folgenden am ehesten auf einen Nenner bringen: Unternehmen brauchen Finanzierungsmittel, um entweder ihre Erzeugung einer ständig steigenden Nachfrage anzupassen oder ihre Herstellungskosten bei einer weitgehend gleichbleibenden Produktion zu senken. Die Wachstumsgesetze sollen nun eine Aufbringung dieser Finanzierungsmittel durch die Unternehmen erleichtern. Die Entwürfe lassen sich in drei Gruppen gliedern. Die erste dient den grofjen, kapitalmarktfähigen Unternehmen; einer Kapitalbeteiligung aus Gesellschaffsmitteln (Umwandlung von Rücklagen in Grundkapital) soll die Ertragskraft stärken. Die zweite zielt auf die mittleren Unternehmen, denen der Kapitalmarkt verschlossen ist, und soll die Bildung von Investitionsrücklagen durch Steuerbefreiung erleichtern. Die dritte schließlich denkt hauptsächlich an die kleinen Betriebe) künftig sollen die nicht entnommenen Gewinne steuerlich begünstigt werden, womit die vielen selbständigen Gewerbetreibenden ihr Kapital vermehren können.
Es geht hier um sehr abstrakte Zusammenhänge. Dies gilt vor allem für den Kapitalmarkt. Vielleicht mangelf es deshalb zahlreichen kleineren und mittleren Parteifunktionären an dem nötigen Verständnis. Es sei zumindest versucht, diese Zusammenhänge anzudeuten.
In Osterreich Ist der Kapitalmark!
zweimal, 1918 und 1945, schwer erschüttert worden. Er konnte deshalb nicht seine Aufgabe erfüllen, da verschiedene Einflüsse, wie ein Bericht des Kapifalmarkfausschusses des Beirates für Wirtschafts- und Sozialfragen feststellt, sowohl das Angebot als auch die Nachfrage verzerrten. Die staatliche Wirtschaftspolitik sah bisher den Kapitalmarkt ausschließlich in einer steuerpolifischen Perspektive. Die Maßnahmen des Staates haben daher einen Aufbau des Kapitalmarktes eher gestört als gefördert. Auf dem Teilmarkt für festverzinsliche Papiere (Staatsanleihen, Energieanleihen, Industrieobligationen usw.) entwickelte sich ein Monopol der öffentlichen Hand. Der Aktienmarkt wiederum konnte sich nicht entfalten, weil die gegenwärtige Gesetzgebung ihn mit Steuern überaus belastet. Der Ertrag einer Aktie nach der Besteuerung ist in Österreich nach internationalem Maßstab sehr gering; die Aktie fiel deshalb in unserem Land in den letzten Jahren als Finanzierungsinstrument weitgehend aus. Ein Sparbuch bietet zweifellos eine bessere Rendite als jede österreichische Aktie. Dies führte zu einem ständigen Wachsen der Spareinlagen. Gegenwärtig verwalten die österreichischen Kreditunternehmen auf ihren Sparkonten rund 162 Milliarden Schilling. Manche Kreise möchten die Lage verniedlichen, indem sie auf den Umstand hinweisen, daß die österreichische Wirfschaft eine durchaus beachtliche Investitionsquote (Investitionen in Prozent des Bruttonationalproduktes) aufweist. Sicherlich nimmt Österreich mit einer solchen von rund 22 Prozent unter den westeuropäischen Staaten einen guten Rang ein. Diese Tafsache läßt sich jedoch kaum zugunsten der gegenwärtigen Zustände anführen. Seit dem Ende der unmittelbaren Nachkriegszeit finanzierten die Betriebe den Kauf neuer Anlagen,
den Bau moderner Werkshallen vorwiegend aus eigener Kraff; der lang anhaltende Verkäufermarkt ermöglichte ihnen die Selbstfinanzierung, zumal die Banken auftretende Finanzierungslücken mit Zwischenkrediten überbrückten. Auf den ausländischen Märkten haben sich in den letzten Jahren die Verhältnisse völlig geändert. Wer heute Investitionsgüter im Ausland verkaufen will, muß gleichzeitig lange Zahlungskredite bieten können, er muß also neben der Maschine die Finanzierungsmittel mitliefern. Hierzu sind die heimischen Unfernehmen wegen einer zu niederen Eigenkapitaldecke nicht imstande. Der Anteil der Eigenmittel (Grundkapital plus Rücklagen) von rund 500 Aktiengesellschaften an ihrer Bilanzsumme ist nach inoffizieller Schätzung höchstens 35 Prozent; diese Verhältniszahl beträgt in Westdeutschland zwischen 40 Prozent und 50 Prozent und in Großbritannien fast 70 Prozent.
Dieser Zustand erklärt sich zu einem gewissen Teil wieder aus der Steuerpolitik. Während die Jungen für einen Kredit zum Beispiel als Betriebsausgabe den Gewinn verkleinern, ist eine Kapitalerhöhung mittels Emission an der Börse mit der Wertpapiersteuer, der Börsenumsatzsteuer und selbstverständlich mit der Körperschaftssteuer belastet. Als Abhilfe schlägt der Kapitalmarkfsausschuß einen ermäßigten Körperschaftssfeuer-safz für Kapitalerhöhungen, Abschaffung der Börsenumsatzsteuer und wesentliche Verringerung der Werf-papiersfeuer vor. Dieser Vorschlag ist zwar ein Ansatz, aber noch nicht eine Lösung. Der gespaltene Körperschaftssteuersatz ließe nämlich zwei verschiedene Kurse für die Aktien der gleichen Gesellschaft entstehen. Bei einer einheitlichen Bruffodividende würde die Rendite der alten Aktien geringer und damit der Kurs niedriger sein als der neuen Aktien, da sie mit einer höheren Körperschaftssfeuer verbunden sind. Niemand wollte alle Aktien kaufen, ein Aktiensparer erhebliche verlieren, weil seine Aktie plötzlich weniger wert ist. Abgesehen von allen anderen Mängeln wäre eine solche Lösung zweifellos auch sozialpolitisch bedenklich und keinesfalls geeignet, das Vertrauen in das Wertpapiersparen zu vergrößern.
Ein Arrangement mit der EWG in
der einen oder anderen Form wird in den nächsten Jahren sicherlich Zustandekommen. Die österreichische Industrie, bei weitem der wichtigste Sektor der Wirtschaft, wird damit in einen größeren Markt hineinwachsen müssen. Gegenwärtig melden fast 60 Prozent der Industriebetriebe nach einer Statistik der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft eine Betriebsgröße unter 50 Beschäftigte. Fraglos wird die Eingliederung in den europäischen Wirtschaftsraum Struktur-politische Maßnahmen erfordern. Wenngleich angenommen werden kann, daß die Marktkräfte von sich aus eine Anpassung bewirkten, dürfte es dabei doch nur mit schmerzlichen Nebenerscheinungen abgehen. Die Wirtschaftspolitik sollte daher trachten, diesen Prozeß möglichst reibungslos zu gestalten, so wie sich der Arzt bemüht, etwa eine Geburt heute schmerzfrei zu ermöglichen. Auch gegen den Widerstand mancher Unternehmer wird er vielleicht die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit der kleinen und mittleren Betriebe fördern. Auch kapitalmäßige Verflechtungen könnten durchaus sinnvoll erscheinen. Eine einzige Papiermaschine erzeug) zum Beispiel in Kanada mehr Rotationspapier als die gesamte österreichische Papierindustrie. Der technische Fortschritt schraubt ständig die optimale Betriebsgröße nach oben. Ein amerikanisches Photounternehmen beherrscht heute mehr als 50 Prozent des Weltmarktes.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen. Die Zeit drängt, überholte ideologische Standpunkte neu zu überdenken. Wir können es uns einfach nicht leisten, zu einem Anachronismus zu werden wie es heute schon die Zwergrepubliken sind. Der Kapitalmarkt ist nicht der Schauplatz übler Spekulanten, sondern übt eine wichfige Aufgabe aus. Nicht zuletzt sichert er, daß die österreichische Wirtschaft bei politischer Unabhängigkeit auch in einem größeren Markf wird bestehen können. Die Wachstumsgesetze sind der erste Schritt zu einer gesunden finanziellen Basis der Investitionstätigkeit der Wirtschaft.