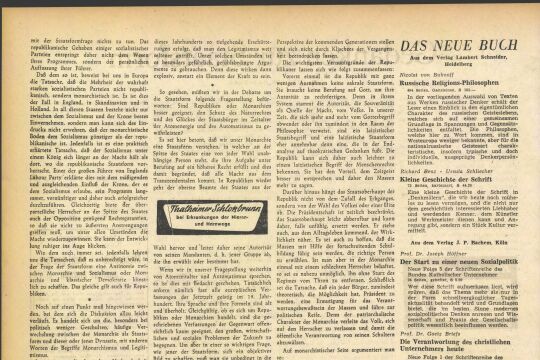Über Architektur und Stadtplanung ist in den letzten Jahren eine breite öffentliche Diskussion aufgekommen; ein verwandtes Gebiet von einschneidender Bedeutung hat bisher wenig Interesse gefunden.
Besonders seit dem zweiten Weltkrieg verstärkt sich die Tendenz, das der Orts- und Stadtplanung übergeordnete Gebiet, also die Planungsangelegenheiten eines ganzen Staates, wissenschaftlich zu bearbeiten. Entscheidungen, die bislang die reine Domäne von Politikern waren, werden mehr und mehr von Fachleuten beeinflußt. Die — nun einmal so benannte — „Raumordnung“ bedient sich aller Wissenschaften, die hier von Nutzen sein können: der Geographie, der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie, der Statistik, der Rechtswissenschaft. Sie sammelt Fakten und wertet sie aus; und schließlich trifft sie Entscheidungen: sie schlägt vor, wo — um bei handfesten Beispielen zu bleiben — Industrien angesiedelt, wo der Fremdenverkehr gefördert, wo Straßen gebaut werden sollen.
Die Raumordnung ist also nicht bloß eine Wissenschaft, sondern sie ist politische Willensbildung auf fachlicher Grundlage. Ihre fachliche Autorität verdient sie dann, wenn sie unabhängig von politischer Macht arbeitet, wenn sie die Schlüsse, zu denen sie kommt, auch gegen die Meinung der Politiker vertritt.
Hier ergibt sich aber eine entscheidende Schwierigkeit: den Auftrag zu einer Raumplanung über ein Gebiet kann praktisch nur die diesem Gebiet vorstehende politische Macht geben; und vor allem kann nur sie die Durchführung veranlassen. Hier wiederholt sich in großem Maßstab das Verhältnis zwischen Bauherr und Architekt. Ein Beispiel möge das erläutern: Rolond Rainers Stadtplanung für Wien mußte zweifellos von Beginn an auf Absichten der Gemeinde Rücksicht nehmen (die zweite Ebene für den Massenverkehr spielt in seinem Planungskonzept beispielsweise noch eine geringe Rolle). Vielleicht wäre sein Konzept nicht angenommen worden, wenn er weniger,' “vielleicht wäre er länger Stadtplaner geblieben, wenn er mehr Kompromisse geschlossen hätte.
Auch in Osterreich
Vor einigen Wochen schlug Landwirtschaftsminister Diplomingenieur Dr. Schleimer dem Ministerrat eine solche Expertenuntersuchung für ganz Österreich vor, und zwar unter der Leitung von Dipl.-Ing. Doktor Rudolf Wurzer, Professor an der Technischen Hochschule Wien. Da sich der Ministerrat nicht sofort einigen konnte, setzte er ein Ministerkomitee (Bundeskanzler Dr. Klaus, Vizekanzler Dr. Pittermann, die Minister Dr. Bock, Proksch und die Staatssekretäre Dr. Kotzino und Rösch) zur Weiterbehandlung der Angelegenheit ein.
Wenn nun — um das obige Beispiel fortzusetzen — vor der Betrauung Roland Rainers mit der
Wiener Stadtplanung Auftraggeber und Öffentlichkeit sich von den Überzeugungen und Zielsetzungen, von der fachlichen Qualität des Planers ein Bild machen konnten, so kann man dies im Fall Professor Wurzers nicht sagen. Seine Wahl ist auch deshalb überraschend, weil es seit 1957 (als Arbeitsgemeinschaft seit 1951) ein „österreichisches Institut für Raumplanung“ gibt, das in Un* '* linken versc' ' jnen Um-fanges bereits Gebiete bearbeitet hat, die fast die Hälfte des Bundesgebietes ausmachen.
Aber noch in einem anderen Zusammenhang ist dieser Personenvorschlag bedeutsam. In Österreich sind noch wenige Gemeinden darangegangen, eine für das ganze Ortsgebiet verbindliche Planung durchzuführen; die Entwicklung hängt im allgemeinen von den zufällig auftretenden Bauwünschen der Grundbesitzer ab. Den baulichen und wirtschaftlichen Folgen dieser „Zersiede-lung“ will eine Initiative der Architektenschaft entgegentreten: Ein eigener „Planungsausschuß“ unter dem Vorsitz von Architekt Hugo Potyka befaßt sich in der Ingenieurkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland damit, die Gemeinden auf freiwilliger Basis dazu zu bringen, Ortsplanungen durchführen zu lassen.
„Herr Planer“
Obwohl jeder Architekt während seiner Ausbildung sich mit Stadtplanung befassen muß, ist für den, der sich einer Ortsplanung widmet, eine spezielle Weiterbildung unerläßlich.
Der Planungsausschuß der Kammer aber will diese Tätigkeit von einer eigenen Befugnis abhängig machen; sie soll nach einem zwei-semestrigen Pflichtstudium verliehen werden, das — nach den bisherigen Vorschlägen — ausschließlich bei Professor Wurzer an der Wiener TH zu absolvieren ist.
Nun wird eine solche Weiterbildung ohnehin im wesentlichen auf ein Literaturstudium, hinauslaufen. Es ist daher unangebracht, dafür einen zwangsweisen UnterrichF einzuführen. Wer aber Wert auf eine persönliche Unterweisung legt, muß die Wahl haben zwischen allen bestehenden akademischen Bildungsmöglichkeiten (außer der Wiener TH die Wiener Akademie, die Grazer TH, aber auch die Linzer Sozialhochschule) und allen Möglichkeiten praktischen Anlernens bei tätigen Stadtplanern, Instituten und Behörden.
Aber schon die Konstituierung des „Planers“ als eigenen Beruf gibt zu einigen Bedenken Anlaß. Abgesehen davon, daß jede gesetzlich vorgeschriebene Spezialisierung auf dem Gebiete der Architektur abzulehnen ist (sie tritt ohnehin in hohem Maß von selbst ein), sind auch sachlich Stadtplanung und Architektur untrennbar verbunden.
Wenn man auch den „Bebauungsplan“, der — vereinfacht gesagt — die Lage und Form der einzelnen
Gebäude festlegt, vom „Flächenwidmungsplan“ unterscheiden muß, der etwa bestimmt, welche Gebiete überhaupt bebaut werden dürfen, welche hauptsächlich der Industrie oder hauptsächlich den Wohnbauten zuzuweisen sind, so kann doch eine bestimmte architektonische Vorstellung von einer Bebauungsstruktur auch den Flächenwidmungsplan beeinflussen. Architekten, die eine Bebauungsstruktur in einer Ortsplanung verwirklichen wollten, wären durch eine Spezialistenregelung daran verhindert, selbst wenn eine aufgeschlossene Gemeinde sie beauftragen wollte.
Die Sorge ist berechtigt, daß unfähige oder gar korrupte Architekten sich in schlecht beratenen Gemeinden der Ortsplanung annehmen. Aber bei dem verständlichen Bemühen, das „allgemeine Niveau zu heben“, wie der Terminus lautet, ist die viel schlimmere Möglichkeit im Auge zu behalten, daß durch eine Reglementierung die wenigen überragenden Leistungen verhindert werden — die schließlich viel mehr Einfluß auf den „Durchschnitt“ haben.
Weg des geringsten Widerstands?
Ohnehin stehen überall in Österreich die geltenden Bauordnungen im Wege, die beispielsweise mit der Bestimmung der „offenen Bauweise“ die Errichtung von Reihenhäusern und anderen wünschenswerten Bebauungsformen verhindern. Diese Gesetze müssen geändert werden, so daß bei Ortsplanungen der Architekt eine von ihm erarbeitete Siedlungsform vorschlagen kann.
Gerade Professor Wurzer aber vertritt die Ansicht, daß Stadt- und Landesplanung unabhängig von Architektur zu betreiben sind; und folgerichtig setzen nach seiner Meinung die geltenden Bauordnungen einer Ortsplanung keine Schwierigkeiten entgegen. — Es liegt freilich auf der Hand, daß eine solche Initiative weniger Schwierigkeiten vorfindet als eine, die auf der Änderung der geltenden Gesetze besteht. Überdies sieht Professor *Wurzer im Raumplaner nicht einen unabhängigen Fachmann, sondern das fachliche Vollzugsorgan der bereits bestehenden politischen Absichten.
Man sieht, daß hier ein wichtiges Gebiet von zwei Seiten stark unter den Einfluß einer einzelnen Persönlichkeit geraten würde, einer Per-sönichkeit zudem, deren bisherige Leistungen in der Öffentlichkeit — weil nicht bekannt — nicht einmal umstritten sind. Inzwischen wurde Professor Wurzer mit der Stadtplanung für Graz beauftragt, obwohl kein fachlicher Grund bestand, ihn dem dort ansässigen Städtebauer und Professor an der TH Graz, Hubert Hoff mann vorzuziehen. Immerhin wird jetzt Gelegenheit sein, eine umfangreiche Arbeit Professor Wurzers zu beobachten und öffentlich zu diskutieren.
Daß die Diskussion über diese Dinge in Schwung kommt, ist an der Zeit
Niemand weil] noch, wann und wie die österreichische Wirtschaft in den groben konfinentaleuropäischen Markt einbezogen wird. Es ist sogar ungewiß, ob unsere Wirtschaft überhaupt Anschlufj findet, oder, um den gleichen Sachverhalt in der offiziellen Sprache zu wiederholen: sich mit der EWG arrangiert. Die gegenwärtigen Verhandlungen lassen aber doch eine skizzenhafte Bestandsaufnahme angebracht sein. Denn wie immer man zur Frage Integration oder Nichtintegration stehen mag, nach einem erfolgreichen Arrangement wie nach einem Zusammenbruch der Brüsseler Verhandlungen werden die Verhältnisse nicht mehr zum Zustand von gestern zurückkehren können.
Wer die zahlreichen Reden von
Unternehmern und Leitern der wirtschaftlichen Verbände, die Jahresberichte der verschiedenen Organisationen überfliegt, kommt zu der Vermutung, daß weife Kreise der österreichischen Wirtschaft geistig noch nicht integrationsreif sind. Nach den Lippenbekenntnissen zu den Grundsätzen des Vertrages von Rom, deren wichtigster wohl jener des Wettbewerbes ist, finden sich die Wünsche nach einer ganzen Kette von Ausnahmen und Obergangsregelungen. Es gelingt vielen Unternehmern nicht, über ihre protekfionistischen Schaffen zu springen.
Unsere Wirtschaftsordnung kennt noch allzu viele Beispiele des wettbewerbseinschränkenden Verhaltens. Wir haben die Kartelle, die sich zwar Konditionen- oder Rationalisierungskarfelle nennen, in den meisten Fällen aber doch eine Ausschaltung des Marktmechanismus und damit höhere Preise bezwecken. Das Streben nach Marktkontrolle geht in manchen Fällen so weit — wie unter anderem im Fall des Papierkartells —, daß man eine Importorganisation gründet, die auch das ausländische Angebot dem regelnden Einfluß des inländischen Kollektivmonopols unterwirft. ' Die Interessenorganisationen stehen nicht abseits. Sie üben einen ständigen Druck auf die staatliche Wirtschaftspolitik aus, den Inlandsmarkt gegen das Ausland abzuschirmen. Am liebsten möchte jede Gruppe als „Hard-core“-Fall gelten, das heifjt, als ein solcher, den nie der frische Wind internationalen Wettbewerbs wirklich umwehen soll. Noch immer fordern die Verbände, daf) die Einfuhr wichtiger Güter mengenmäßig beschränkt bleibt, dah die Zölle auf ihrem hohen Niveau verharren sollen. Und stimmen sie schon einmal der Ermäßigung eines Zolles zu, beeilen sie sich und verlangen sofort, dies möge durch eine Erhöhung der Ausgleichssteuer ausgeglichen werden. So antwortete der Vertreter eines Fachverbandes der Industrie (wohlgemerkt eines Teiles der öffentlich-rechtlichen Wirtschaftkammer) einmal auf die Frage nach dem Ausmaß der ausländischen Konkurrenz in Österreich, mit den schlichten Worten, daß „wir den heimischen Bedarf errechnen und nur soviel Einfuhr hereinlassen als unsere Betriebe nicht decken können“.
In die gleiche Gruppe gehören die Versuche eingesessener Unternehmer, die Niederlassung ausländischer Betriebe zu verhindern, weil man die Abwerbung der Arbeitskräfte oder eine Erhöhung des inländischen Angebotes befürchtet.
Ist diese Art des protekfionistischen Verhaltens noch faßbar, sind die übrigen wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen zwar bekannt, aber nicht greifbar. Man trifft sich im Kaffeehaus, auf dem Golfplatz oder fährt gemeinsam zur Jagd, spricht sich dort aus und trifft irgendein ungeschriebenes Gentlemen's Agreement. Diese Absprachen sind sehr lose und formlos. Gemüsegroßhändler mögen einander auf einer Landstraße begegnen, kurz anhalfen und sich den Preis zuflüstern, den man nicht überbieten wolle. Zweifellos gibt es solche oder ähnliche wettbewerbsbeschränkende Praktiken auch im Ausland: In Österreich förderte sie noch der kleine Markt. Diesen Mangel an Wettbewerbsgeist kann man gleichsetzen dem Mangel an Unternehmungsgeist; nie ist die österreichische Wirtschaft von den Unternehmerpionieren geprägt worden, deren Vorhandensein der große österreichische Nafionalökonom Josef Schumpeter als unabdingbar für eine dynamische Wirtschaft erklärt hat. Obschon es sicherlich bösartig ist, enthält doch der Satz eines ausländischen Journalisten ein Körnchen Wahrheit, der da behauptet, daß das Fiakerprinzip und die Einstellung „es muß leicht gehen... nur nicht zuviel anstrengen müssen“ das Verhältnis der Österreicher zur Wirtschaft leite. Arbeitnehmer wie Arbeilgeber im selben Maß.
Es tollte jedermann einleuchten, daß durch ein wirtschaftlich* Inte-
gration dieses Verhalten entweder unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wurde. Der Staat könnte nicht mehr wie bisher dem Druck der Inferessenverbände weichen und wetfbewerbsbeschränkend eingreifen. Der zweifelsohne berechtigte Wunsch nach dem Schutz der selbständigen wirtschaftlichen Existenz wird auf andere Weise befriedigt werden müssen. Nämlich in einer solchen Art, welche die österreichische Wirtschaftsverfassung wirklich in eine soziale Marktwirtschaft verwandelt und gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Betriebe kräftig erhöht. Wohl der einzige gangbare Weg scheint die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zu sein.
Ehe wir darauf näher eingehen, sei auf einen wichtigen, vielfach übersehenen Zusammenhang hingewiesen: Die Wissenschaftler sagen, daß auf einem Markt Konkurrenz gegeben sei, wenn weder die Produzenten noch die Konsumenten den Preis beeinflussen können, wenn zum Beispiel soviel Firmen Herrenhemden erzeugen, daß keine von ihnen eine Preissteigerung herbeiführen kann, indem sie ihre eigene Produktion einschränkt. Aus dem folgt, daß Wettbewerb, Betriebs- und Marktgröße eng miteinander verknüpft sind. Was heute in dem Siebenmillionenmarkt Österreichs ein marktbeherrschendes Unfernehmen isf, wird morgen vielleicht nur eines von vielen sein; wenn heule ein Betrieb mit, sagen wir, 2000 Beschäftigten hier herausragt und die wirtschaftliche Selbständigkeit von Klein- oder Mittelbetrieben gefährdet, sieht er morgen vielleicht schon einem großen Fisch gegenüber, der starken Appetit auf ihn verspürt; das marktbeherrschende Unternehmen wird zu einem kleinen Fisch geworden sein.
Und es würde nach einer Einbeziehung der österreichischen Betriebe in den großen Europäischen Markt, der in der EWG heute schon mehr als 200 Millionen Menschen umfaßf, unzählige Zwergfische und eine Reihe von kleinen Fischen geben. Schon wenige Zahlen unfermauern dies. Nach der letzten nichtlandwirtschaftlichen Betriebszählung gibt es In Dsferreich 242.000 Betriebe, von denen nur rund 1700 oder 0,7 Prozent mehr als hundert Arbeitskräfte beschäftigen; bloß 10.000 Betriebe (oder 4 Prozent) verfügen über mehr als 20 Arbeiter und Angestellte; das heißt, etwa 96 Prozent sind ausgesprochene Kleinbefriebe. Vergleicht man die österreichische mit der westdeutschen Industrie, so springt sofort der strukturelle Nachteil der heimischen Betriebe ins Auge. In Österreich ist da der Anfeil der Mittelbetriebe (zwischen 50 und -500 Beschäftigten) etwa doppelt so groß wie in Deutschland. (Mit Großbritannien fiele der Vergleich ähnlich, mit Frankreich allerdings weniger ungünstig aus.)
Um In einen größeren Markt hineinwachsen zu können, bieten sich den österreichischen Unfernehmen grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmol können sich mehrere (etwa über den Kapitalmarkt) zu einem größeren zusammenschließen; das brächte den Verlust der Selbständigkeit mit sich, da der Aktionär bekanntlich das Betriebsgeschehen kaum mehr beeinflussen kann. Als Ausweg öffne! sich die erwähnte betriebliche Zusammenarbeit. Sie verbindet den Vorteil des Großbetriebes weitgehendst mit der wirtschaftlichen Selbständigkeit, da jene die geplante und organisierte Kooperation von Betrieben, Verbänden und anderen Wirtschaftsgebilden umfaßt (Professor Dr. Erich Hruschka) und eine wirtschaftliche Leistung ermöglicht, die sonst unerreichbar wäre. Und da sie in der Regel nicht den Wettbewerb beschränken, hat Max Mitic sie schon vor 13 Jahren als „positive Karfelle“ propagiert — ohne Erfolg. Die Zusammenarbeit kann sich von der Planung, dem Rechnungswesen, der Produktion, der Forschung und Auswertung von Erfindungen, Verlrieb bis zur Finanzierung erstrecken. Am bekanntesten sind etwa Markenverbände, wie Quikoton, Coltonova, Mini-Iron usw., oder Modellgemeinschaffen in der Bekleidungsindustrie (International Fashion). Um den Unternehmern den weifen Bereich der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit nahezubringen, wird das Wirt-schaftsförderungsinstifuf der Handelskammer im Herbst eine Veranstaltung diesem Thema widmen.
Dieses Insfiful erwirbt sich damit ein großes Verdienst. Denn die Alternative zur zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit käme dem Verhalfen der Lemminge gleich, dieser Mäuseart in Norwegen, die unbekümmert in den Tod wandert. Hoffen wir, daß sich die österreichischen Unternehmer genügend geisfige Regsamkeit bewahrt hoben und ihre Chance erkennen.