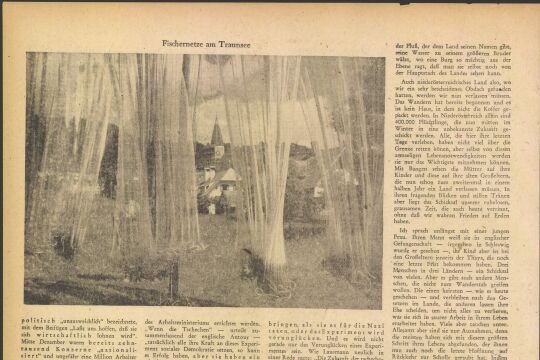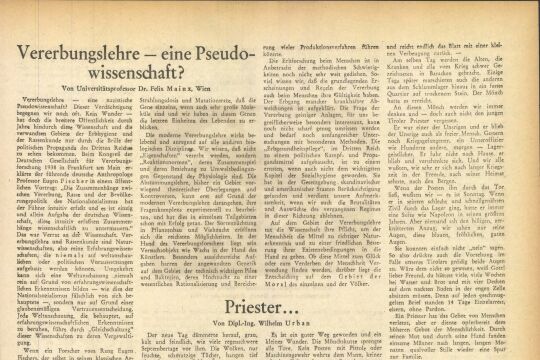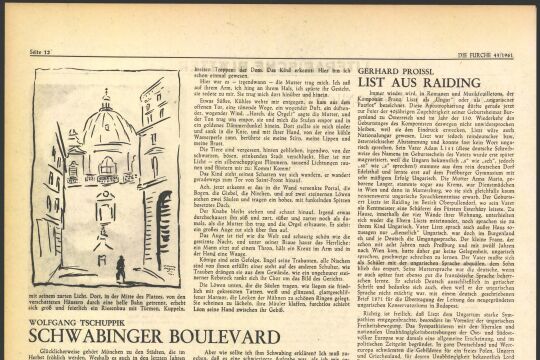FÜNFUNDZWANZIG KILOMETER bis Traiskirchen. So steht es auf dem Fahrplan der Lokalbahn Wien—Baden in der Stadtmitte. Ein trüber Morgen. Ueberau ist noch die Beleuchtung eingeschaltet. Menschen fahren zur Arbeit, Kinder gehen zur Schule. Rot und blau zittern die Leuchtstreifen der Neonröhren auf dem regennassen Asphalt. 55 Minuten entfernt aber: ein kleiner, einsamer Bahnhof, geduckt unter dem kalten Südostwind, der aus der Unermeßlichkeit der Ebene daherfegt. Traiskirchen, ein Markt in der Bezirkshauptmannschaft Baden, 6000 Einwohner zählend. Zu diesen kamen über Nacht 3000. Meist ohne Mantel, mit einer Pappschachtel, einem Koffer, der mit Spagat zusammengebunden ist; die Frauen haben oft ihre Habseligkeiten — mit einem Tuch zu einem unförmigen Ballen zusammengeknüpft — über die Schulter geschwungen. Es sieht aus, als wäre irgendwo wiederum Krieg, wie ihn diese Gegend von 1945 her nur zu gut kennt; aber es ist Frieden — für uns freilich nur, nicht für die 40.000 Flüchtlinge, die bisher aus Ungarn kamen und von denen ein Teil in Traiskirchen vorläufig Zuflucht auf dem Areal der einstigen Kadettenanstalt fand, wo mehrere Gebäude von der früheren Besatzungsmacht verlassen dastanden. Versteht sich, in der entsprechenden Verfassung. Jetzt ist es nicht mehr so wie in den ersten Tagen. Da war die Bundesstraße 17 mit Fahrzeugen förmlich blockiert. Dennoch ist auch heute ein stetes Kommen und Gehen. Gendarmerieposten an den Straßenkreuzungen und vor dem Haupttore. Im dürr gewordenen Grase innerhalb der Umzäunung parken Kraftwagen des Roten Kreuzes, Omnibusse von Gemeinden und Transportunternehmungen, dann wieder Personenwagen mit ausländischen Kennzeichen. Dort ein großer Bus mit der Aufschrift „France: secours catholique“, dahinter die niederländische Flagge, daneben die portugiesische und die schwedische. Und zwischen allen Fahrzeugen, die trotz ihrer Zahl in der Weitläufigkeit des Geländes wie verloren anmuten, Männer, Frauen, junge und alte, allein, zu zweit, in Gruppen, Zurufe weitergebend, Papiere — es sind die Kennkarten oder die Kleideranweisungen — in der Hand haltend.
Bewegung, Erregung und doch erstarrte Gesichter. ERSTARRTE GESICHTER. Etwa die der zwei jungen Männer da, beide aus Raab gekommen, zwei Tage unterwegs, in der vorigen Nacht am Südende des Neusiedler Sees durch die Sümpfe über die Grenze. Warum sie nicht den geraden Weg genommen hätten? „Panzer“, war die Antwort. „Auf jeden von uns kamen fünf Panzer. Auf unserem Weg allein haben wir mehr als vierhundert gezählt.“ Während wir sprechen, kommt ein älterer Mann dazu, der nicht deutsch versteht. Unser Dolmetscher übersetzt. Der Bauer, Endre mit Vornamen, verlor seinen Besitz an eine Kolchose, wurde als politischer Sträfling von Lager zu Lager geschoben, bekam überall seine Nummer auf die Haut tätowiert und landete zuletzt in einem Bergwerk. Endre schiebt seinen Rockärmel hoch. „Ich habe schon vier Ziffern gehabt“, sagt er.
DER MENSCH ALS ZIFFER. Gespenstig ist es, hier über die Gänge des Hauptgebäudes zu gehen. Irgendwie sehen sich alle Menschen ähnlich. Wenn man einen von ihnen auch nur eine Minute später suchen wollte, man fände ihn nicht heraus. Und wenn man auf den Zimmertüren die Kreideschriften liest; 18 Personen, auf der nächsten Türe: 30 Personen — so wird die quälende Erinnerung an die Kriegstransporte des ersten Weltkrieges wach, wo Mann und Pferd summarisch als Ziffern auf den Güterwagen aufschienen. Das Schicksal wird verfrachtet — seit mehr als 40 Jahren geht es so. Hier kommt nur eine Station dazu. Zwei junge Burschen gehen uns im ersten Stock entgegen, als wir auf den öden Hof hinausblicken, und sprechen uns ungarisch an. Als man sagt, man verstände nicht ungarisch, suchen sie mühselig ein paar deutsche Brocken zusammen. Der jüngere der beiden dürfte kaum mehr als 16 Jahre zählen. Er fragt: „Was wird mit uns geschehen?“ und blickt etwas mißtrauisch auf den Bleistift, den man in der Hand hält. Der ältere: „Wird Oesterreich ausliefern?“ Warum ausliefern, wollen wir wissen. Wer hat das behauptet? — „Das hat man uns immer gesagt. Oesterreich — neutral! Liefert alle aus, die hingehen.“ Schreck und Mißtrauen auch im'Blick dieses Mannes.
DER SCHRECK UND DAS MISSTRAUEN. Erst allmählich lösen sich die gespannten Gesichter. Helferinnen des Roten Kreuzes kommen mit Tragbrettern vorbei, auf denen Kaffeeschalen stehen. Hier wird nicht einfach in jedes beliebige Geschirr ein Schöpfer voll eingegossen. Man bemüht sich, auch unter den schwierigen Verhältnissen, bei dem ständig wechselnden Belag und den ungünstigen Raumzuständen eine Spur von Häuslichkeit herzuzaubern. Dort, am Fenster des nächsten Raumes, den wir betreten, steht ein Wasserglas mit zwei Astern. Es gab nirgends, wohin wir kamen, die berüchtigten Holzdoppelbetten übereinander. Ueberau stehen Feldbetten mit Decken, zuweilen ein Sessel vor dem Bett. Ueberau Tische. Die Räume sind halbwegs warm. Im nächsten Zimmer zieht eine Frau gerade ihrem Kinde Strümpfe an, die sie erhalten hat. Aus den alten will sie für das Kind Handschuhe machen. Wenn sie nur ihr Nähzeug hätte — verdolmetscht der Begleiter des Lagerpfarrers, der zu uns getreten ist. Woher sie komme? Aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Särvär an der Raab. Ueber Buk an der Rabnitz hat sie ein Traktor mitgenommen, bei Lutzmannsburg überschritten sie die Grenze des Burgenlandes. Ob sie einen Wunsch habe? Das Gesicht der Frau verschattet sich. Sie weiß nichts von ihrem Mann, der sich bei Steinamanger befand. Ihr Bruder ist tot. Ihre Schwägerin ist tot.
TOT. TOT. Immer wieder tropft dieses Wort' in die Gespräche. Namenszettel gehen von Hand zu Hand. Bilder werden hergezeigt. Wer weiß etwas von dem? Wer von diesem? Eine Gemeinschaft des Schicksals bildet sich, eine Brüderschaft des Mitleidens. Wir gehen vom ersten Stock in den zweiten. Auf der Stiege eine junge Frau, die ein kleines Kind trägt und ein anderes mit der freien Hand führt. Eine Schwester des Roten Kreuzes kommt mit Kartons, auf die Spiele geklebt sind. Das Kind, das neben seiner Mutter geht, wählt aus und lächelt. Es ist das erste Lächeln, das wir an diesem Tage sehen. Als wir wieder ein Zimmer öffnen, glauben wir in einem Möbellager zu sein. Hier sind die wenigen Einrichtungsgegenstände, die, meist mit Pferdefuhrwerken, mitgenommen werden konnten. Mit der Dürftigkeit dieser Kasten und Truhen und der Abwesenheit von Menschen wirkt der Raum geisterhaft-unwirklich. Ein Schlüssel — wohin mag er gehören? — liegt auf dem Boden. Wann war es das letzte Mal, daß ihn glückliche, friedliche Menschen in der Hand hielten? Wer wird ihn wieder gebrauchen? Und wo?
EIN SCHLÜSSEL ZU DEN HERZEN dieser Flüchtlinge ist die österreichische Hilfsbereitschaft. Mit wem immer man spricht, jeder wünscht, den Oesterreichern zu danken. Der Chemiker mit dem Vornamen Jänos fragt: „Womit haben wir das alles verdient?“ Er spricht ausgezeichnet deutsch. Er will, wenn möglich, in Oesterreich weiterstudieren. Zuletzt war er in den Borsoder Werken. Auswandern? Nein, auswandern will er auf keinen Fall. Warum? „Damit ich Ungarn recht nahe bleibe!“ antwortet er. „Ich will sobald wie möglich etwas verdienen. Ich habe mir leider meine Zeugnisse nicht mitnehmen können — sie sind sehr gut —, aber man wird ja sehen, daß ich etwas leisten kann. Die Hälfte meines Verdienstes will ich für die Ungarnhilfe geben, solange einer meiner Landsleute Not leidet.“ Er geht mit uns die Treppe hinunter. Wir kommen an Kisten, voll mit Aepfeln, vorbei; die Stapel reichen beinahe bis zur Decke. Daneben liegen in Ballen Textilien. Ein Gendarm geht die Lagerräume ab. Wir fragen ihn, ob eine Bewachung nötig sei. ,-,Vorschrift“, sagt er kurz und setzt dann hinzu: „Ich habe^bisher noch nicht gehört, daß etwas weggekommen sei. Im Gegenteil! Vorhin sah ich, wie eine• Frau, die einen-Mantel bekam, sofort ihre Wolljacke auszog und der Nachbarin gab, die keinen Mantel hatte.“ Die Haltung der Gendarmerie wird allseits anerkannt, ja es gibt Flüchtlinge, die unverhohlen ihr Erstaunen ausdrücken, wie freundschaftlich und hilfsbereit diese „Polizei“, wie sie sagen, ist. Am ersten Tag der Flüchtlingstransporte nach Traiskirchen haben diese Männer 24 Stunden ohne Unterbrechung Dienst gemacht. „Jetzt gibt es schon wieder drei bis vier Stunden Schlaf“, meint der Gendarmeriebeamte, der auf dem Wege zum Kleiderdepot auf und ab geht. Dieses Gebäude liegt im Ostteil des Areals, gegen die Karl-Theuer-Straße zu. Vor dem Eingang steht ein etwa 17j ähriges Mädchen mit blauem Sommerpullover und schwarzem Rock. Man sieht, es ist ihr kalt: die bloßen Hände hat sie in die Aermelöffnungen gesteckt. Die Medizinstudentin Etelka wartet auf ihre Schwester Vera. Sie weiß von ihrem Bruder, der in Budapest zu Besuch war, als der Aufstand losbrach, noch nichts. „Aber ich hoffe, daß er lebt! Ich werde mich schon durchschlagen und arbeiten; zuletzt war ich in einer Spitalsapotheke. Nur weg von da, aus diesem Lager!“ Inzwischen ist Vera gekommen. Auch sie ist zuversichtlich mit ihren 15 Jahren. Sie hat als landwirtschaftliche Gehilfin — „Agronomin“ sagt sie noch nach östlicher Terminologie — nächst Jäczbereny gearbeitet. Ein anderes Mädchen mit dürftig aussehendem Regenmantel und abgetretenen, aber sauber geputzten, hohen Schuhen kommt vorüber. „Das ist Jolän“, sagt Etelka. „Jolän kann nur wenig deutsch“, setzt sie fort; aber Jolän fällt ihr ins Wort und sagt drei Worte: „Oesterreicher sind gut.“ Etelka erzählt, daß Jolän über ein Jahr lang eingesperrt war, weil sie beim Aufmarsch am 1. Mai vorigen Jahres nicht teilgenommen hat.
Wer die alten Lager und die Stimmung des einzelnen und das Verhältnis der Insassen vergangener Zeit zueinander kennt, der ist “immer wieder aufs neue überrascht von der Disziplin und der Zuversicht, die hier herrscht. Man betrachtet den jetzigen Zustand als Durchgang und Uebergang. Es gibt kaum wo ein dumpfes Brüten, ein heftiges Wort. Wir hörten nirgends eine Stimme des Hasses. Das wird uns auch von der Lagerleitung bestätigt, die im übrigen berichtet, daß fortlaufend Besucher kommen, welche um Zuweisung von Frauen und Kindern ersuchen. Auch Arbeitskräfte wurden schon gefragt. Es ist in zweckmäßiger Weise denn auch in Traiskirchen ein Arbeitsamt eingerichtet worden. Wenn wir mehr wissen wollten — so sollten wir in das Caritashaus nach Wien fahren.
CARITASHAUS. Hauptquartier der Nächstenliebe. Wir sind über Mittag nach Wien gefahren. In dem großen Haus Währinger Gürtel 104 hatten wir Gelegenheit, mit einer leitenden Persönlichkeit zu sprechen, trotzdem viele Besucher warten und alle Telephone klingeln. Nach Karteiaufnahme erhalten die Flüchtlinge von der NCWC 20 Schilling, Nahrungsmittel und eine Anweisung auf die der Caritas gespendeten Kleider. Alte Leute und Kinder bekommen überdies Anweisungen auf Mahlzeiten. Die LInterbringung in Traiskirchen wird als Provisorium betrachtet. Die Parole der Caritas: „Heraus aus den Lagern!“ begegnet sich durchaus mit der Stimmung in Traiskirchen. Es wäre auch jede wahllose Auslandverschickung abzulehnen und sorgsam die Umwelt zu prüfen, in welche die Flüchtlinge kommen. Die Unterbringung in Landgasthöfen als zahlende.Gäste wird intensiviert; die Ueber-nahme von Patenschaften für solche Gasthöfe ist erwünscht. Für die Unterbringung in Gasthöfen und Pensionen muß die Caritas täglich rund 50.000 Schilling aufwenden. Auf dem Lande ist es eher möglich, Fuß zu fassen. Die Menschen, herausgerissen . aus ihrer früheren Welt, sollen nicht das Gefühl der Einsamkeit haben, sie sollen nicht wie dürres Laub im Winde verflattern.
DÜRRES LAUB liegt auf der Zufahrtsstraße zum Lager Traiskirchen, als wir am Abend mit einem Transport dort noch einmal einfahren. Aus den Fenstern fällt mattes Licht. Die weiten Höfe liegen verlassen da. Nur an einer Ecke, die nach Norden vorspringt, stehen zwei Männer. „Stephan Szecheny“, meint der eine, „hat vor langer Zeit das auch gesagt und ich sag es mit ihm: Ich schau nicht so sehr und immer rückwärts, sondern vielmehr nach vorwärts. Viele denken, Ungarn sei gewesen; wir wollen glauben: Ungarn wird sein!“