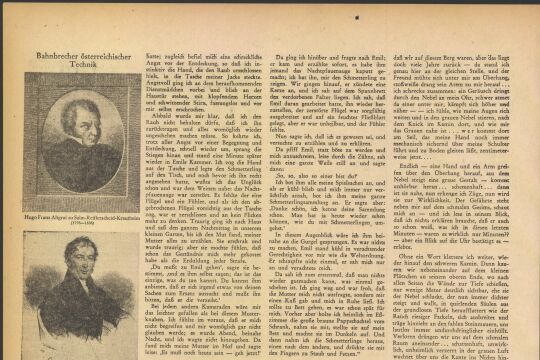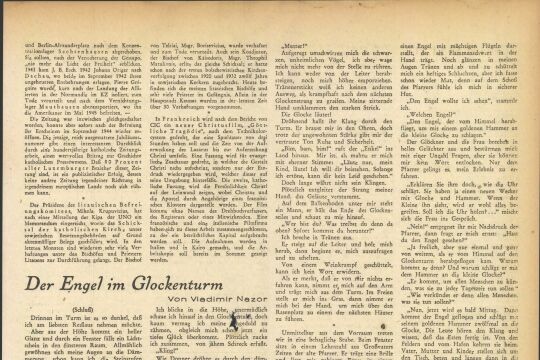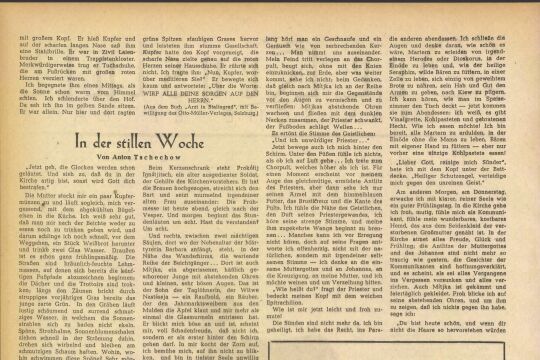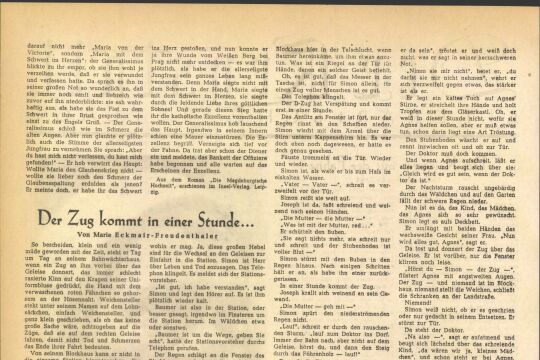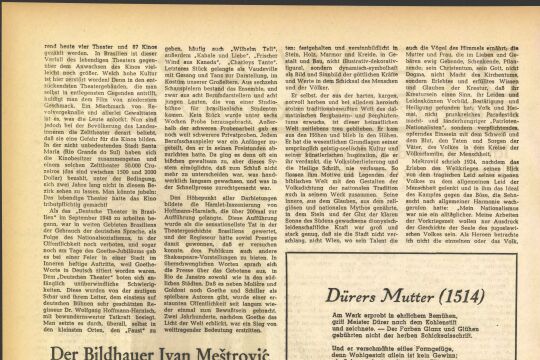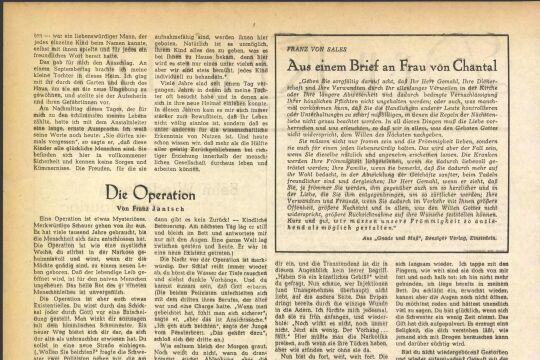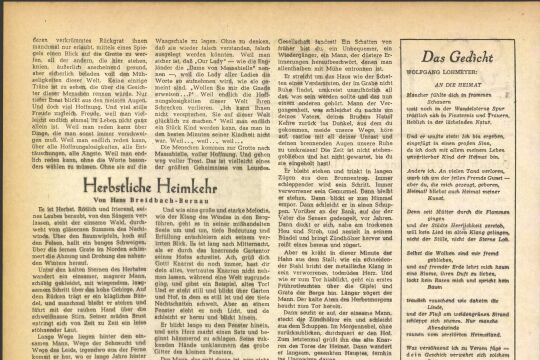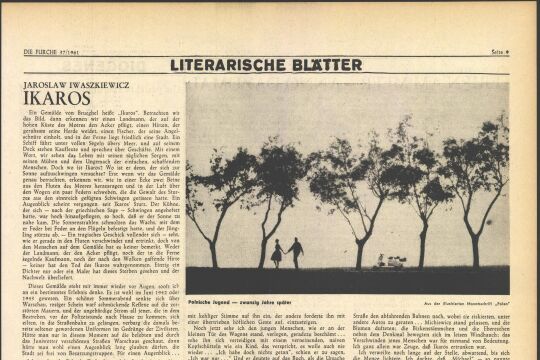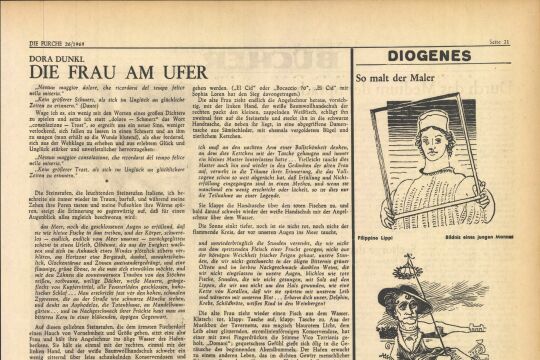Wie soll ich 's ihm sagen von der Mutter? So fragt er sich, seit er nach Bolko sucht. Und immer noch weiß er es nicht. Aber er hat ja noch Zeit, um nachzudenken über die Worte. Er hat noch Zeit genug. Denn was er von Bolko weiß, ist nicht viel. Nur ein Name, von einem, der wissen soll, wo man ihn findet. Aber auch das ist nur unbestimmt, vage, wie alle die Spuren, denen er nachgeht, seit Monaten schon, seit fast einem Jahr. Trotz aller Umfragen, trotz aller Aufrufe ist zuletzt nichts geblieben als diese eine dürftige Spur jenseits der Grenze. Irgendwo in der Hauptstadt, hat es geheißen. Sonst nichts. Keine Straße, kein Haus. Und die Hauptstadt ist groß, und er weiß, wie furchtbar die Fremdheit ist in den Städten für einen, der ankommt und niemanden hat als sich selbst.
Durch lange Dämmerungen schiebt sich träge der Zug. Es ist, als kämpfe er gegen das dunkle Gewölk, das tiefer und tiefer herabsinkt und müde sich auf die Landschaft legt, schwerfällig an, und meistens vergeblich. Immer wieder hält er auf freier Strecke. Die Gegend liegt tot, kein anderer Zug, der vorfährt, und keiner entgegen. Im Abteil, in dem er mittags nach langem Suchen einen Platz fand, ist er nun allein seit der Grenze. Auch auf den Gängen ist niemand zu sehen, und die Abteile neben dem seinen sind ohne Beleuchtung, die Vorhänge zugezogen. Ob auch sie leer sind? fragt er sich laut, um die Stille ringsum zu durchdringen. Aber er wagt nicht, sich selber die Antwort durch öffnen der Türen zu holen. Ob nicht vielleicht jemand dahinter noch wartet wie ich? denkt er. Das einmal erregte, dann wieder gelassengeduldige Warten der Reisenden aller Züge und Strecken und Zeiten? Oder gar schläft? So wie ich selbst schlief, tief und fest, als die letzten mein Abteil verließen, zwei Frauen, alt, mit grauen Gesichtern, als wären sie krank, ja kurz vor dem Tod. Er starrt verloren ins sinkende Dunkel. Nur langsam, im Tempo des Gehens, ziehen die Bäume und Büsche vorbei durch den Abend. Ein Blick auf die Uhr. Halb neun. Noch Zeit bis zur Ankunft. Er lehnt sich zurück und lauscht den Rhythmen der ratternden Räder. Dann plötzlich spürt er den Ruck, der Zug steht von neuem. Er schaut aus dem Fenster, doch keine Lichter. Ein Bahnhof, so scheint es, doch nirgends ein Schild, das den Namen angibt. Und nirgends ein Mensch, der ihn nennt. Aber dort, eine Tafel, weiß, auf dem Nachbargeleise, schief, wie weggeworfener Abfall, sinnloses Blech zwischen Schienen. Das Licht seines Abteils fällt schwach darauf. Zum Ausgang, kann et entziffern und faßt auch den Sinn, obwohl er die andere Sprache nur dürftig versteht. Zum Ausgang. Es ist wie ein Ruf, der ihn angeht. Nur ihn. Er öffnet das Fenster, dort vorne am Ende des Zugs weht ein Schatten. Den ruft er an, doch die dunkle Erscheinung verschwindet. Er wartet und wartet. Aber die Fahrt geht nicht weiter. Da weiß er, hier ist sie zu Ende, und er ist der letzte im Zug. Und dann erlischt auch das Licht im Waggon. So tappt er mühsam — der Koffer ist schwer, wenn auch klein — durch den Gang zur Tür. Vom untersten Trittbrett erreicht sein Fuß keinen Boden. Nicht einmal sehen kann er ihn. Doch er denkt, es kann nicht zu tief sein. Und springt. Es knirscht an den Sohlen von Sand und kantigem Kies. Dann hebt er den Koffer vom Trittbrett.
Endlos quert er Geleise. Ein riesiger Bahnhof. So ist es gewiß: eine größere Stadt. Die Hauptstadt? Doch schon ist der Zweifel in ihm. Wo wären die anderen, die vielen Menschen, die immer, und selbst in den schläfrigsten Stunden von Mitternacht bis zum Morgen, auf Bahnhöfen stehen in größeren Städten? Suchend blickt er um sich. Da sieht er am Rande des Himmels im Osten die Röte von Bränden. Und dumpf fällt Angst über ihn. Denn niemand ist da, der ihm sagt, wo er ist, was hier vorgeht und was ihn vielleicht noch erwartet. Erst als die Stille zerfetzt wird durch Knattern von Schüssen, weiß er, das kann nur ein Kampf sein oder ein quälender Traum, Erinnerung an dunkle Tage des Krieges. Aber er träumt nicht. Er stolpert noch immer über die Schwelle und Schienen, es ist, als wollten sie kein Ende mehr nehmen. Dort drüben, so hofft er, könnte er sein, der Ausgang, die Rettung vor Schienen und Schwellen und Schotter und dunklem Alleinsein. Dort drüben, wo sich die Baumkronen abheben gegen den glühenden Himmel.
Als er dann endlich hinaustritt durchs Tor der Umfriedung, stockt ihm der Atem. Schwarze Kolosse stehen im Schatten der Bäume, mit drohenden Rohren, die auf Häuser sich richten. Nur rasch vorüber, denkt er, nur fort von den Rohren, nur fort von den wuchtigen stählernen Leibern, dunklen Dämonen einer entfesselten Zeit. Aber dahinter sind Leute. Er sieht es am Glühen der Zigaretten. Schon kommen sie näher, rufen ihn an, treten ganz nah auf ihn zu. Uniformen, ein Dutzend vielleicht. Er zählt nicht die Zahl. Er hört nur die Stimmen. Er kennt nicht die Sprache. Was sind das für Menschen? Der eine entzündet ein Streichholz und stößt ihm beinahe damit ins Gesicht. Da sieht er die Fratze riesig vor sich. Und rundherum andere, knochig und derb. Gesichter des fremdesten Erdteils. Der Lauf einer Waffe drückt sich ihm gegen die Brust. Was er schreit, der sie trägt und sie hart mit der Mündung in ihn hineinstößt, immer von neuem schreit, klingt ihm wie eine Frage. Auch andere brennen nun Streichhölzer an und betrachten ihn feindlich. Da weiß er, es wird nicht viel Zeit sein für eine Antwort. Und greift in die Tasche, hält dem ersten den Paß hin. Er spürt, der hat am meisten zu sagen. Doch wiehernd beginnt der zu lachen, greift zu, reißt an den Blättern, und alle, die um ihn sind, greifen danach. Und jeder will ein Blatt, und jeder bekommt es, als wäre es sein Recht. Es wird ehrlich geteilt, denkt der Beraubte, es ist nicht au leugnen. Und jeder lacht wiehernd, sobald er das seine bekommt. Und hält es ins Feuer, bis es aufflammt und langsam zu Asohe zerfällt. Nur der, der die rote Hülle aus Plastik gepackt hat, voll Gier nach der Farbe, ein Riese mit furchtbaren Händen, probiert nun vergebens und flucht vor Enttäuschung und schleudert sie fort, in weitem Bogen ins Dunkel. Die anderen halten noch immer die glosende Asche. Es ist, als wollten sie, stolz auf die Härte und Dicke der Haut an den Händen, dem Fremden ein Kunststüokchen zeigen. Da schreit der erste, und drückt ihm die Waffe noch stärker entgegen, noch einmal laut seine unverständliche Frage. Schreit sie hinein in der anderen Spiel, schreit sie ins Dunkel und heiß auf ihn zu. Und ihn trifft im Gesicht der wehende Atem. Er weiß, jetzt gibt es nur noch das bittende Wort oder die nackte Gebärde. So sagt er: Ich suche den Bruder. Sagt es langsam und deutlich immer wieder: Su - che Bru -der, Bru - der. Und dann, voll Verzweiflung, weil keiner versteht: Brü - der - chen. Und wieder beginnt das Gewieher, neue Streichhölzer flammen auf, sie schneiden Grimassen, rufen durcheinander: Brie - dachen, Brie - da - chen. Rund um ihn ist dieses furchtbare Dachen und Schreien. Da spürt er entsetzt einen Hauch von Wahnsinn und Tod. Und sagt: laßt mich fort! Erst leise, bittend. Und als sie nicht hören, ruft er es, lauter und lauter, bis das Lachen verstummt. Schreit es zuletzt: Laßt mich fort! Und so laut ist sein Schrei, daß er weit in die Stille des Abends fährt. Und er greift nach dem Koffer. Doch setzen sich Stiefel darauf. Drei, vier, sechs, vielleicht mehr. Und die Augen um ihn werden lauernd und böse. Er will seinen Koffer hochreißen, aber zu schwer stehen die Füße darauf. Da packt ihn der Zorn. Und er schreit: Diebe, Hunde, Schweine! Und stößt dem einen den Stiefel weg. Es ist der mit den riesigen Händen, der mit den furchtbaren Flüchen und der Wut des Versagens. Nun ist nichts als Gewalt in den Zügen. Und er hebt sein Gewehr und schlägt zu. Da gibt es kein Ausweichen vor der Wucht des Hiebes. Nur den Kopf kann er seitwärts werfen und sich bücken. So trifft ihn der Schlag an der Schulter. Ihm ist, als flösse Feuer an ihm herab. Und er spürt den Sand und den Kies an den Wangen und Händen wie weiche Tücher, in die er gehüllt wird.
Nur fort! schreit es in ihm in den irren Visionen des Schmerzes. Und er kriecht die Mauer entlang, Meter für Meter, flach an den Boden gedrückt. Ein Glück, so geht sein Gedanke im Kreis um den Brand in der Schulter, ein Glück, daß sie, die rohen Gesellen mit den wilden Gesichtern, mich nicht mehr beachten. Es scheinen ihm Stunden zu sein, bis er die Häuser erreicht. Das erste Tor ist verschlossen, er schleppt sich zum nächsten, hört seinen eigenen Ruf als verzerrte, zerrissene Laute, wankt in die Einfahrt. Und wieder Gestalten im Dunkel. Wohin? ihre Frage. Ein einziges Wort, sonst nichts. Das springt auf ihn zu und fällt mitten hinein in das Singen und Dröhnen des Bluts in den Ohren.Kurz und laut wie ein Schuß. Und dennoch ist's gut zu verstehen, was andere meinen. Und er nimmt sich zusammen und antwortet hastig, mit zitternden Lippen: Ich bin fremd hier und will zu Bolko Beruschin, meinem Bruder. Und nennt auch den Namen des anderen, der von ihm weiß. Doch hört er nur Atmen von denen am Ende des Flurs. Sie schweigen. Was ist? Seid ihr stumm? schreit er hinein in die Stille. Nur langsam! kommt es zurück. Es ist eine jüngere Stimme, vielleicht eines Knaben. Nur langsam! Du bist nicht der erste, der jemanden sucht. Es sind viele wie du unterwegs in der Stadt. Und jeder von euoh erzählt andere Lügen. Er hört diese Worte und faßt nicht den Sinn. Er lehnt an der Wand und weiß nur: da ist einer, der redet und tut sich schwer mit der Sprache, gebrochen und hart klingen die Worte. Und jetzt verschwinde! hört er zuletzt, verschwinde von hier und such ihn dir selbst, deinen Bruder! Und eine der dunklen Gestalten tritt auf ihn zu, und auch andere kommen hervor, und sie jagen ihn fort in die Nacht, in die feindliche Nacht mit den Schüssen und dem Widerschein der Feuer am östlichen Himmel.
Und er geht diesen Bränden entgegen, dem Geknatter der Waffen. Er weiß, er ist nahe am Ziel, und ahnt, bald wird es Antwort geben für ihn. Die Silhouette von Kirchen und Türmen verrät ihm: es ist die
Hauptstadt. Aber jeder Schritt tut ihm weh. Und der Schmerz scheint noch immer zu wachsen, kriecht in den Arm, in die Hand, in den Nak-ken, die Stirn. Um sich zu trösten, spricht er sich Worte vor, laut vor sich hin. Wäre der Brand nicht, sagt er sich etwa, ich wüßte nicht, wo ich bin, und es fiele mir schwer, die Richtung zu finden. Denn keines der Häuser trägt ein Schild mit der Nummer, und namenlos liegen die Straßen. Aber der glühende Himmel zeigt mir den Weg. Er weiß, es ist Unsinn, sein Reden, sein Denken, aber er spielt dieses Spiel, dieses zwanghafte Spiel seiner Not, seiner Qual. Er spielt es und spricht seine Sätze im Rhythmus der Schritte. Dazwischen aber, wo immer er einem begegnet, fragt er nach Bolko, dem Bruder, und fragt auch nach dem,der ihn kennt. Doch niemand gibt freundliche Antwort. Die meisten schweigen. Und wenn einer spricht, heißt es nur: Such ihn dir selbst! Was hat weniger Sinn, sagt er sich laut, und was mehr; sagt sich's im Takt zum eigenen Schritt: das sinnlose Reden voll Trost zu mir selbst oder mein Fragen nach Bolko, dem Bruder.
Lang ist der Weg bis ins Innere der Hauptstadt. Verstört ist sein Sinn vom, vielen nutzlosen Fragen, vom steinernen Schwei gen der' Menschen, vom Andrang brutaler Gewalt. Zerfetzt und beschmutzt ist die Kleidung, sein Körper ein brennender Strom. Und Schweiß der Schwäche steht ihm schwer auf der Stirn. Er hat nur noch eines: den Willen, den Bruder zu finden. Und so fragt er und fragt. Doch immer wieder nur dies: Such ihn dir selbst, deinen Bruder! Und einer sagt: Das kennen wir schon. Und ein anderer: Ist das jetzt die neue Methode? Und einer hebt drohend die Faust. Verräter! ruft er ihm zu, und: Spion! Da bleibt nur die Flucht, die Flucht zu den Bränden, den Schüssen, die öfter und öfter die Stille zerreißen.
Bald kriecht, durchsetzt vom Rot und vom Rauch, das Grau der Dämmerung über die Dächer und steigt in die Senken der Straßen herab. Wohin er auch kommt, dort stehen Menschen in Gruppen beisamimen. Er fragt, aber niemand gibt ihm mehr Antwort. Ein Heben und Senken der Schultern ist alles. Da sieht er vor sich einen Greis, der steht vor der offenen Tür eines Ladens, zerfurcht das Gesicht, mit dicken Gläsern vor halbblinden Augen. Als er dieses Gesicht sieht, weiß er: es gibt noch das Gute. Noch ist nicht alles davon zerschossen durch Salven, noch nicht alles weggebrannt von den Feuern, die an der Stadt fressen, an ihrem Gebälk und Gemäuer und an den Herzen der Menschen darin. Und er fragt ihn, den Alten, ob er Bolko, den Bruder, nicht kenne. Er spürt es: nach dieser Frage ist er am Ende, dann ist die Hoffnung dahin. Darum stellt er sie langsam, die Frage, deutlich, bedächtig, gewichtig und laut. Und erkennt, schon während er fragt, daß er weiß, der Alte, Zerfurchte. Daß er irgendwas weiß von Bolko, dem Bruder. Das Licht in den Augen zeigt es ihm an. Aber schon ist's zu spät für die Worte. Die Antwort geben die stählernen Rohre am Ende der Straße, dort wo sie sich öffnet zum geräumigen Platz. Nur wenige Sekunden dauert die tödliche Sprache. Glas klirrt, Holz splittert, und Mauerwerk bröckelt herab. Dann sieht er den Alten liegen, dicht vor der Tür des Ladens, das Gesicht nach unten. Die Augengläser zerbrochen neben seiner rechten Hand, die weit nach vorne greift, über den Kopf hinaus. Es ist, als hätte er sie, ohne die er hilflos war, noch im Stürzen auffangen wollen.
Da erfaßt ihn dumpfe Verzweiflung. Er weiß, der Alte ist tot, der letzte mit gutem Gesicht. Und er weiß auch, jetzt ist die Antwort für immer verloren. Er sucht in den anderen Gesichtern, aber die bleiben verschlossen und stumm, und keine Hand rührt sich. Er kann es nicht fassen, daß Menschen, auf die man schießt, sich nicht wehren. Als seien sie zur Ohnmacht verdammt. Als hätten sie keine Fäuste, das Unrecht zu Boden zu schlagen. Steht nicht so da! ruft er ihnen entgegen. Schlagt sie doch tot, eure Mörder! Und es packt ihn blinde Wut gegen die Ungetüme aus Stahl, und er wankt auf sie zu, fluchend, mit geballten, erhobenen Fäusten. Drei junge Männer springen ihm nach und zerren ihn zurück. Zorn und Verzweiflung leihen ihm Kraft, aber zu hart sind die Griffe der Burschen, sie halten ihn fest. Noch als sie ihn forttragen, schreit er und wehrt sich. Bis einer auf die blutigen Flecken an seinem Gewand zeigt. Er starrt darauf. Ihm ist zumute, wie wenn er erwachte. Er spürt die Schulter brennen und das Knie. Und schließt die Augen und läßt alles mit sich geschehen.
Die Wohnung, in die man ihn bringt, ist zum Lazarett geworden. Verwundete, einer am anderen, liegen in Betten, auf Strohsäcken, einfachen Decken. Wieder erscheint ihm das Bild, das er sieht, als ein Traum, ein aus den Tiefen dunkler Vergangenheit steigender Traum vom Krieg. Bis ihn der Schmerz zurückruft. Man trägt ihn ins Zimmer des Arztes. Eine der Schwestern legt soeben einen Verband an. Vom Unterarm bis zur Schulter. Darüber ein junges Gesicht, bleich, mit dunklen, erschrockenen Augen. Ein Kind noch, zwölf Jahre vielleicht. Dann ist er selbst an der Reihe. Man legt ihn aufs Feldbett, nimmt ihm behutsam die Kleider ab. Der Arzt tritt heran, beugt sich über ihn, lange. Nun brennen wieder zwei Feuer an seinem Körper, fließen allmählich zusammen, verschwimmen in eins. Nur selten hört er ein Wort. Das Klicken der Instrumente ist alles. Sein Blick geht zur Decke, und er beginnt die weißen und grauen Quadrate des Musters zu zählen. Nur manchmal geht eine Welle von so rasendem Schmerz über ihn, daß er vergißt, wie weit er gezählt hat. Dann beginnt er von neuem. Und zählt und zählt die Quadrate. So lang, bis der Arzt nach dem Nächsten ruft.
Man verbindet ihn, trägt ihn hinaus. Zum Gehen ist er zu schwach. Ein eisernes Bett nimmt ihn auf. Etwa fünfzehn Leute im Zimmer. Das Flüstern hat aufgehört, sie betrachten ihn schweigend. Dann stellen sie Fragen: woher und wohin und wozu. Nur einer bleibt stumm und ohne Bewegung: sein Nachbar zur Linken. Ein Gesicht, das keines mehr ist. Nur ein Teil ist noch frei von Verbänden: ein Auge, die Nase, der Mund. Scharf der Rücken der Nase, die Lippen blutlos und schmal. Doch das Auge, starre Pupille im stahlblauen Ring, sieht ihn an. Und er spürt diesen Blick auf einmal wie den seines stillen Gefährten In fernen, verschollenen Tagen der Kindheit, spürt ihn wie den seiner Mutter. Ihn schaudert. Ist das, was hier liegt, nicht der lange Gesuchte? Und dann weiß er, es muß so sein, sonst gibt es keine Hoffnung mehr auf ein Wiederfinden. Und er ruft es voll Freude den anderen zu: Seht, das ist Bolko, mein Bruder! Ich habe ihn endlich gefunden! Aber dann fühlt er es matt in den Gliedern, er fürchtet, es könnte zu spät sein, wenn er jetzt zögert zu sprechen. Und so beugt er sich hin mit dem Rest seiner Kraft, und Schulter und Knie brennen heißer als je, und Bolko! sagt er, und nochmals den Namen. Langsam spricht er und leise, doch alle können ihn hören. Es ist wieder still geworden im Zimmer. Kaum, daß sie atmen, die andern. Bolko, sagt er noch einmal, kennst du mich noch? Ich bin dein Bruder. Ganz langsam die Antwort: Bru-der. Ein Flüstern, nicht mehr. Bolko, kannst du mich hören? Ich soll dich grüßen von der Mutter und dir sagen —. Da bewegt sich langsam des anderen Mund. Mut-ter. Ein Wort ohne Laut. Man kann es nur sehen, so schwach fällt es ab von den Lippen. Dann sinkt der Kopf auf die Seite.
Die andern rufen die Schwestern. Die schieben das Bett in die Mitte und tragen es aus dem Zimmer. Eine furchtbare Leere neben ihm bleibt zurück. Da setzt er sich auf und ruft: Laßt mich zu Bolko! Und will ihnen nach, fällt zu Boden, stöhnt. Die Schwestern kommen zurück, heben ihn auf, legen ihn wieder ins Bett. Doch wieder beginnt er zu schreien. Laßt mich zu Bolko! Was wißt ihr, wie lang und wie weit ich gefahren bin, um ihn zu finden. Laßt mich zu ihm, ich muß es ihm sagen von der Mutter. Nicht jetzt, sagt die eine der Schwestern, nicht jetzt, und sei wieder ruhig. Die andere schweigt. Und dann schreit er wieder, immer von neuem den Namen des Bruders. Bis der Arzt kommt und ihm eine Spritze gibt. Er ist doch mein Bruder! So klagt er, schon leiser und müder. Schon gut, sagt der Arzt, aber jetzt brauchst du Ruhe. Er ist doch mein Bruder, hört er nochmals sich sagen, laßt mich zu ihm! Er spürt, wie die Ohnmacht der Schwäche über ihn kommt. Er weint. So laßt mich zu ihm, ich muß es ihm sagen, er ist doch mein Bruder. Er war, sagt der Arzt, uns allen ein Bruder. Und das sind die letzten Worte, die er noch hört. Dann stürzt er hart in den schwarzen Abgrund des Schlafes.