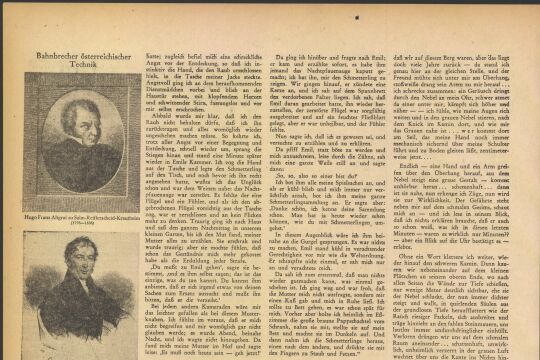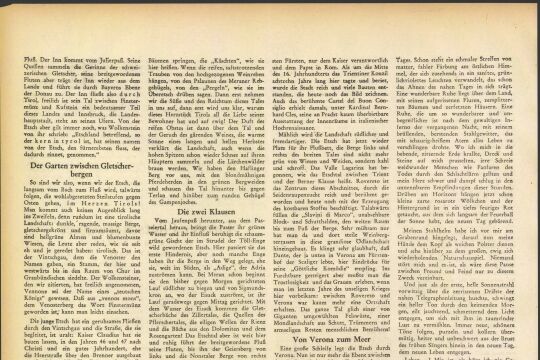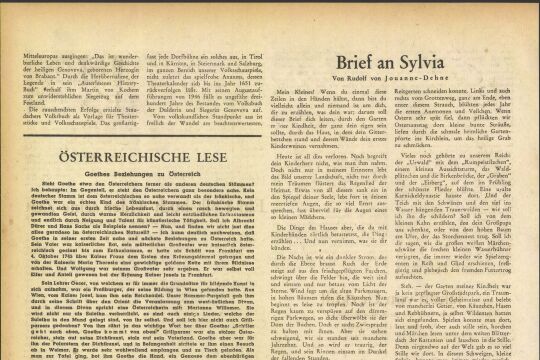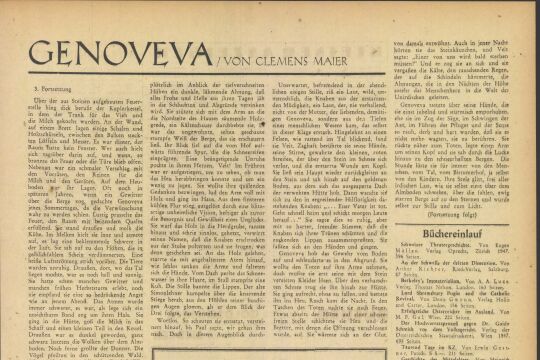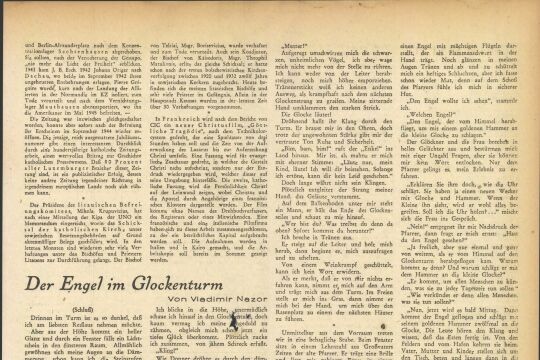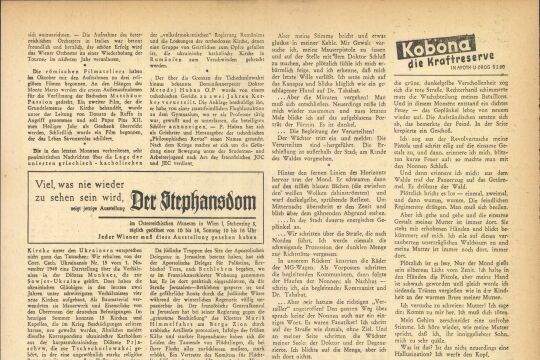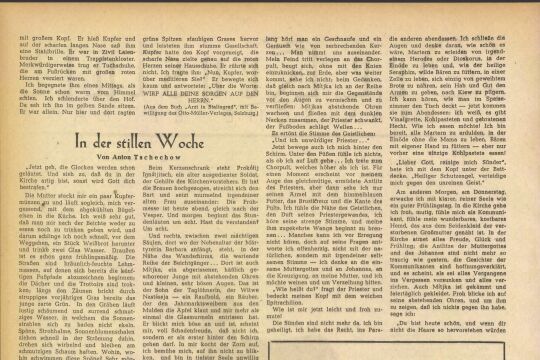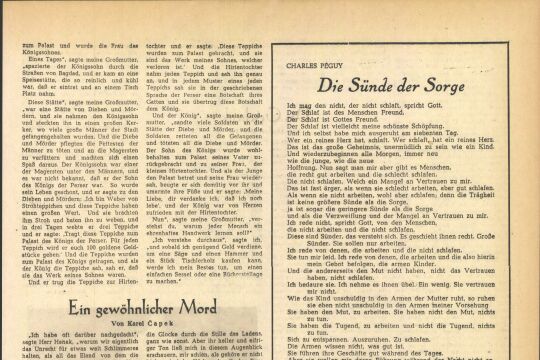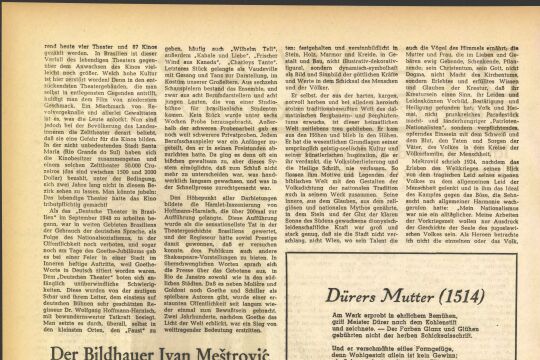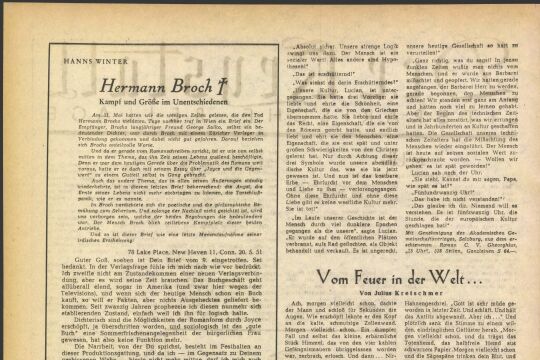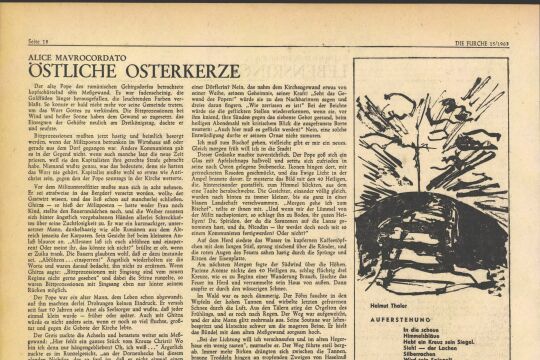Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Fubkreit Erd
Der russische Dicktet Grigorij Baklanow schildert in seinem Roman „Ein Fußbreit Erde“ (in deutscher Übersetzung erschienen bei DVA Stuttgart] das Schicksal einiger Soldaten der Roten Armee in einem erbittert umkämpften Brückenkopf am Dnjestr. Er erzählt, was die Soldaten der Roten Armee dort wirklich gesehen und erlitten haben. Prompt traf ihn denn auch der Vorwurf des „Remarquismus“. weil er es gewagt hatte, in seinem Roman aus einem kleinen Brückenkopf „seine Helden aus der weitgespannten, vielseitigen Verbindung mit der sie umgebenden Wirklichkeit zu lösen“. Baklanow hatte aber nur den Mut, das Leiden und den Tod an der Front ganz unverhüllt darzustellen; er decket keine patriotischen oder weltrevolutionären Fahnen und Ordenszeichen über Todesnot una Schmerzensschreie. Auch die schreckliche Angst der Soldaten wird schonungslos geschildert. Im folgenden bringen wir einen kurzen Auszug aus dem Roman.
Schon in der Dämmerung beginnt unser Gegenstoß. Die hinter den Höhen verlöschende, unruhige Abendröte scheint uns ins Gesicht. Nach kurzer Artillerievorbereitung, von Granatwerfern unterstützt, stürmen wir aus dem Wald, und es gelingt uns, die Deutschen, die sich noch nicht eingegraben haben, zurückzuschlagen. Wir treiben sie über das schwarze, mit Asche bedeckte, rauchende Gelände. Eine Kugel zerstört mir meine MP, ich laufe weiter, nur noch mit der Pistole. Um die verlassenen Artilleriestellungen, zwischen erschlagenen Pferden, Munitionskästen, auf von Granaten zerwühlter Erde entspinnt sich Nahkampf. Eine neue deutsche Welle wälzt sich auf uns zu. Da, ein furchtbarer Schlag von hinten, und alles dreht sich taumelnd vor meinen Augen: die Deutschen und auch der schiefe Streifen des Abendhimmels ... Der harte Aufschlag auf die Erde bringt mir für einen Augenblick die Besinnung zurück, und ich sehe, wie viele Beine in Wickelgamaschen, die eben erst vorwärts gelaufen sind, mit der gleichen Geschwindigkeit an mir vorbei zurücklaufen. Schüsse, Schreie, Rauch naher Einschläge. Ich-versuche hinter ihnen herzustolpern, schreie. Jemand läuft keuchend an mir vorüber, tritt mir mit dem genagelten Schuh auf die Hand. Und ich fühle mit Erleichterung, wie sich Bewußtlosigkeit auf mich senkt.
Noch nie habe ich einen so kalten, leeren, weit entfernten Himmel über mir gesehen -wie in dieser Nacht. Von der Kälte auf der Erde wache ich plötzlich auf. Frost schüttelt mich. Im Mund Blutgeschmack wie nach Eisen. Irgendwo weit weg wird geschossen, rote Kugeln fliegen lautlos fernen Sternen zu und verlöschen. Vorsichtig betaste ich meinen Nacken, er ist geschwollen und naß. Schmerz brennt in den Augen. Ich liege auf der Erde und weine vor Schwäche. Die Tränen laufen mir über die Backen, und das Licht der Sterne bricht sich in den Augen. Später fühle ich mich etwas besser.
Nicht weit von mir erkenne ich die dunklen Umrisse eines toten Pferdes. Das abgeschliffene Hufeisen glänzt bläulich an einem der hochgestellten Hinterfüße. Mir fällt ein, daß hier unsere Artilleriestellungen sind, und ich kombiniere: sie werden hierherkommen. Auf dem Boden stöbere ich nach meiner Pistole. Sie ist nicht zu finden. Mir ist nur eine Handgranate übriggeblieben. Auf allen vieren versuche ich vorwärts zu kommen, muß vor Schwäche oft anhalten, horche. Zwei schwarze Schatten in Helmen heben sich deutlich vor dem Hintergrund des Himmels ab, bewegen sich abseits, geräuschlos. Manchmal bleiben sie stehen, dort, wo Stöhnen zu hören ist. Rotes Feuer, ein Schuß kracht, sie warten einen Augenblick und gehen weiter. Und wieder bleiben sie stehen, neues Aufflammen, Schuß und Weitergehen. Ich warte etwas und krieche dann mit äußerster Vorsicht weiter. An den Händen fühle ich von Zeit zu Zeit warme Asche, irgendwo raucht der Boden noch, und der Wind facht die Asche zu roter Glut an.
Ich krieche über vertrautes Gelände, wo jeder winzige Pfad, jeder Erdhügel mir bekannt ist, erinnere mich, wie wir hier mehr als einmal in Deckung gingen. Hier krochen wir nachts aus Gräben und Unterständen, alle, die noch Lebenden und die inzwischen Gefallenen, lagen auf dem Gras, atmeten tief, massierten die während des Tages angeschwollenen Gelenke. Wie oft trat aus dem Wald ein junger Mond, wurde wieder alt, und die dumpfe Zeit der dunklen Nächte begann — die beste Zeit für die Spähtrupps — und wieder wurde ein neuer Mond geboren. Vor unseren Augen wuchs der Mais und verbarg uns von den feindlichen Beobachtern, dann wurde er gelb, und auch das hatte sein Gutes: wir brauchten unsere Tarnung nicht so oft zu erneuern. Und jetzt — alles Asche.
Was vom Mais übriggeblieben ist, habe ich nun schon dicht vor mir. Dahinter liegt die Straße. Dort ist der Wald. Jetzt kommt es darauf an, sich im Wald zu verstecken. Ich erkenne die Wegbiegung. Hier hat einmal ein Infanteriefahrer im Jeep versucht, bei Tage durchzukommen, wendete zu scharf und kippte seinen Oberst heraus. Den ganzen Tag schickten die Deutschen wie bei einer Zielscheibe Schuß nach Schuß in den umgestürzten Jeep, bis sie ihn in Brand gesetzt hatten.
Plötzlich höre ich ganz nah das Knacken eines Sicherungsflügels. Zitternd drücke ich mich an den Boden. Sehe mich um. Aschgrauer Himmel. Schwarze Maisstiele. Wer mag dort sein? Unsere? Ein Deutscher? Aber ein Deutscher brauchte sich doch nicht zu verstecken? Oder vielleicht ein Verwundeter ... Mir kommt es vor, als höre ich seinen Atem. Oder ist es das Blut in meinen Ohren? Unter mir beginnt der Boden zu zittern. Panzer kommen. Zwei deutsche Panzer und ein Schützenpanzerwagen nähern sich auf dem Weg. Wenn der im Mais ein Deutscher ist, dann ist alles -aus. Er wird rufen. Die Panzer kommen heran, vom Mond beleuchtet. In den Turmluken die Umrisse der Panzerschützen. Im schrägen Licht einer aufleuchtenden Lampe steht Staub wie Rauch. Im Liegen presse ich die Handgranate. Er ruft nicht. Und schon regt sich die Hoffnung: es ist einer von uns. Hinter den Panzern schiebt sich aufgelockert Infanterie. Knobelbecher, den Staub aufwirbelnd, matt schimmernde Helme, aufgeknöpfte Uniformen, hochgekrempelte Ärmel. Einige haben MPs quer vorm Hals, halten sie mit den Händen an Kolben und Lauf. Die Letzten gehen bis an die Schultern im Staub. Den Abschluß bildet noch ein Panzer. Durch das Rollen und Rasseln der Ketten kann man die Schritte nicht hören. Wir liegen, bleiben in Deckung, an den Boden gedrückt: ich und jener im Mais. Es ist einer der Unseren, und wahrscheinlich ist er genau wie ich verwundet. Vorsichtig robbe ich zu ihm.
Der Mann steht auf. Pantschenko!
„Hierher, Genosse Leutnant.“
Er kommt mir entgegen.
„Halten Sie sich bei mir fest.“
Ungeschickt versucht er, meinen Rücken zu umfassen.
„Laß, ich kann selbst.“
Der Staub hat sich noch nicht wieder gesetzt. Durch ihn hindurch springen wir über die Straße, verbergen uns im Wald. Noch außer Atem sitzen wir in den Büschen, im Nebel und flüstern schon wie die Gänse im Schilf.
„Myschkö! Pantschenko!“
Ich rede irgend etwas und betaste wie blind mit den Händen sein Gesicht, streiche ihm über die Backen. Ich fühle, daß ich dem Heulen nahe bin. Aber er krümmt sich: ihm ist das peinlich. Mir wird's auch peinlich, und wir schweigen, sehen uns an und schweigen. Wunderbar wäre es, jetzt etwas zum Rauchen zu haben. Schließlich hätten wir uns beinahe gegenseitig erschossen.
„Myschkö, verfluchter Teufel, weißt du, wie du mich erschreckt hast?“
„Selber bin ich auch erschrocken.“ Und er grinst.
„Du hast mich gesucht?“
Das hat er tatsächlich. Er robbte über das Feld von einem Toten zum anderen, drehte das Gesicht zum Licht und robbte weiter. Ein Infanterist hatte ihm erzählt, er hätte mich fallen sehen, da kam er her. Als einziger hatte er in dieser Nacht nicht an meinen Tod geglaubt; ohne jemandem etwas zu sagen, zog er los, um mich zu suchen. Zu so etwas ist nur der eigene Bruder fähig. Aber der Bruder ist schließlich vom eigenen Blut. Aber wer bist du für mich? Durch den Krieg sind wir blutsverwandt geworden. Wenn wir mit dem Leben davonkommen — nie werde ich es dir vergessen.
Auf einmal schreckt mich gar nichts mehr. Alles, was die Deutschen uns antun können, ist, uns umzubringen. Und das ist schließlich nicht das Schlimmste. Wie viele Jahre sie einen unmenschlichen Krieg führen mögen, die Menschen bleiben doch Menschen.
„Wo ist Ihre Pilotka?“ Pantschenko mustert mich schon wieder kritisch. Die ist weg. Immer habe ich von dir wegen Schlamperei zu hören bekommen. Also schimpf ruhig auch jetzt. Früher habe ich nicht gewußt, daß es sogar angenehm sein kann, gescholten zu werden.
„Und die Reithose ist voll Blut.“ Sieh an, Entschuldigung. Sei nicht böse, Myschkö, wir werden noch neue Reithosen überleben. Und eine neue Pilotka überleben wir auch, wenn nur der Kopf bleibt, um sie drauf-zusetzen.
„Dann sind Sie auch verwundet, wahrscheinlich?“
„Ich werd's nicht wieder tun.“
Vorwurfsvoll sieht er mich mit seinen kleinen, von der Anstrengung des Denkens zerquälten Augen an. Und ich möchte am liebsten seine langnasige,' brummige Visage küssen.
„Kommen Sie, ich verbinde Sie.“
„Gehen wir.“
Und wir gehen, einer in der Spur des anderen, damit es unter unseren Tritten nicht knackt, durch den Wald. Der Nebel hebt sich aus den Büschen. Und es riecht nach dem nahen Fluß und nach Nebel. Er deckt uns. In der feuchten Luft spüre ich den Brandgeruch an meiner Feldbluse und an meinen Händen. Der Wald ist voller Deutscher. Wir hören ihre Stimmen und ihre Schritte, ein paarmal müssen wir in Dek-kung gehen und warten, bis sie vorüber sind.
In deT Nähe stuckert ein MG. Ein deutsches. Mit kurzen Feuerstößen antworten unsere Leute. Durch den Nebel kommt der Klang dumpf herüber. Wir gehen dem Klang nach.
Der Mond ist schon hoch über dem Wald, als wir im Nebel zu den Unseren kommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!