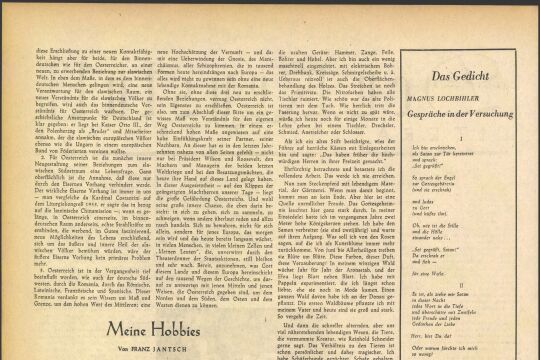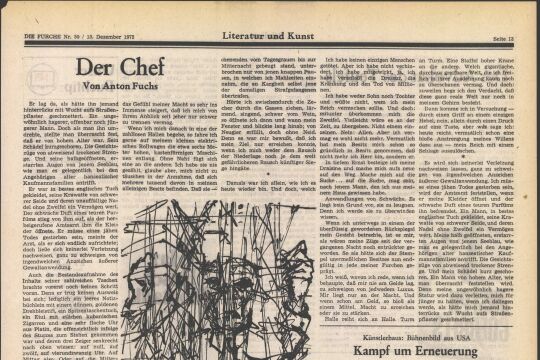Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Versuch in der Acunst
Nun bin ich also allein und hätte das Beste zu hoffen, wenn zu glauben ist, was man von andern Dichtern hört, daß sie, auf einem Steine sitzend, unsterblich wurden. Aber nients Ewiges, nichts Erschütterndes will sich in meinem Kopf einfinden, wie immer währt es nicht lange, bis ich mich im Allernächsten verloren habe. Ich fange an, die Gräser vor meinen Augen genau zu betrachten, ein gieriger Eifer überkommt mich, diese winzige Welt aus Moos und Gestrüpp mit den Augen zu durchdringen und zu entwirren, als könnte ich das Maß der Dinge im Kleinsten und Geringsten finden, das letzte Geheimnis, dem ich zeitlebens nachgetrachtet habe, freilich vergebens. Es ist schon so, die hohen Flüge sind mir versagt. Ich muß auf der festen
Erde bleiben, auf der gemeinen Strafle des Daseins, an ihrem Rande muß ich mein Handwerk üben. Vielleicht, wenn ich mir nur ein gutwilliges Herz bewahren kann, daß es mir doch dann und wann gelingt, etwas Freundliches zu entdecken und etliche im Vorübergehen damit zu trösten, wenn ihnen Staub und Mühsal das Herz verfinstert haben.
Aber, allmählich wird mir dabei die Zeit zu lang. Ich schiele nach dem Meister hinüber, er steht unter einer Föhre und hat es auch nicht leicht, seine ganze Kunst muß er an diesen Hügel verschwenden, dieses Denkmal der Langeweile, das dem Schöpfer aus der Hand gefallen sein mag, als er eben ein Gähnen unterdrückte.
Oft habe ich dem Meister bei seiner Arbeit zugesehen, widerstrebend jedesmal und schließlich doch von diesem wunderbaren Vorgang berückt. Ganz ungeschickt bin ich ja selber nicht. Wenn es zutrifft, daß man die eigenen Fehler und Vorzüge ungescheut den Vorfahren auf ihre jenseitige Rechnung setzen darf, dann verdanke ich wohl meinem Vater ein angeborenes Vermögen, die Dinge im Umriß zu erfassen und in ihren Verhältnissen abzuschätzen. Als der Vater in seiner Jugend bei den Kanonieren diente, hat er mancherlei in ein Buch gemalt, Geschütze und Waffen, auch ein Frauengesicht dazwischen, das ihm gefallen haben mochte. Alles aber mit einer unermüdlichen Sorgfalt, mit dem spitzesten Bleistift und so wunderbar getreu, daß man jede Schraube an einer Lafette und jedes Haar an der Braue seines Mädchens zählen konnte. • Später vergaß er diese Kunst, es geschah nur selten einmal, daß er mir bei meinen kindlichen Versuchen zu Hilfe kam. Dann beugte er sich über mich, der ungefüge Mann mit seinem lauten Atem, und mein Herz klopfte wild, wenn ich sah, wie seine Hand behutsam den Stift führte und, durch einen unbegreiflichen Zauber Form und Ordnung in das Gewirr meiner Linien brachte. Ich hatte etwa ein Schweinchen in den Kalender zeichnen wollen, „was möchtest du marjhen“, sagte der Vater, „was soll das werden?“ Und dann wirkte er das Wunder vor meinen Augen. Was ich selber machte, war ja nur dann ein Schwein, wenn ich es so nannte, aber dem Vater gelang etwas Wirkliches, und auch die Nachbarin erkannte es sofort, wenn ich mit dem Blatt zu ihr gelaufen kam — sieh an, sagte sie, da hast du ein prächtiges Schwein gemaltl
Unversehens glückte dann der Zauber auch meiner eigenen Hand, und das war ein betäubendes Ereignis, als sei ich plötzlich allmächtig geworden. Ich entsinne mich genau des Ortes und der Stunde, aber was mir eigentlich geschah, • weiß ich auch heute noch nicht zu erklären, das ist ein Geheimnis geblieben. Damals lief ich wie im Rausch umher und bevölkerte die Gegend mit meinem Getier, ich besaß ungeheure Herden von Schweinen und Rössern, die Leute konnten sich des Segens auf ihren Hausmauern kaum noch erwehren.
Später gewann ich einiges dazu, aber es vergingen viele Jahre, bis ich einsehen lernte, daß ich doch nicht allmächtig sei. So viele Hoffnungen ich begraben mußte, keiner habe ich länger und bitterer nachgetrauert als der einen, daß ich ein großer Maler werden könnte. Und noch jetzt, wenn sich die Worte nicht fügen wollen, Ist es mir ein wehmütiger Trost zu denken, ich hätte mich eben doch am Anfang im Werkzeug vergriffen.
Freilich, meine geringen Gaben sind mir trotzdem erhalten geblieben, das Glück des Bildens mit der Hand. Noch immer kann es mich sehr erschüttern und rühren, wenn es mir gelingt, einen Käfer geduldig nachzumalen, ein Blumenblatt mit allen Adern und Härchen, obgleich es doch nur ein mühsames Buchstabieren ist, nicht die beschwingte Schrift der Eingebung.
Darum ärgert es mich ja, wenn ich zusehen muß, wie es der Meister treibt. Nichts ist leichter, als Himmel und Erde zu schaffen, alles fließt ihm wie zufällig aus der Hand, und ich kann nie erraten, was ihm im nächsten Augenblick einfallen wird. Dieses schwierig abzuschätzende Dunkel unter dem Wald, dieser zwiefarbene Schein am Himmelsrand — um das zu treffen, würde ich Gelb nehmen, eine Spur von Rot vielleicht, vorsichtig daruntergemischt. Aber nein, grob und ohne recht hinzusehen, stößt der Meister mit dem Pinsel in die Näpfe, einerlei, welche Farbe er trifft, es st doch genau die richtige. Ein rotes Scheunendach, ein blinkender Wasserfaden, ich sehe das alles nicht so und dennoch ist es auf eine rätselhafte Weise wahr, eine neue schönere Wirklichkeit.
Wieder einmal meine ich, dem Geheimnis auf der Spur zu sein. Man muß das meiste dem Zufall überlassen, denke ich, dem Glück, ich bin nur zu zaghaft, das ist der Grund.
Verstohlen suche ich mein Malzeug im Wagen zusammen und setze mich abseits am Ufer eines Wässerchens zurecht.
Anfangs läßt sich die Arbeit nicht übel an. Ich nehme das satteste Blau für den Himmel, und diese Kühnheit lohnt sich auch sofort, denn es bleibt mir eine weiße Wolke darin stehen, wie geschenkt, es ist gar keine Wolke am Himmel. Jetzt den Hügelkamm darunter, ein wenig zu gewagt im Schwung, nicht ganz naturgetreu, aber dafür kräuselt sich ein Wäldchen ganz von selbst ins Feuchte hinein. Das Glück des Gelingens reißt mich fort. Ich kann des Zustroms an Einfällen kaum noch Herr werden. Es ist, als liefen mir Baum und Busch entgegen und stellten sich gefällig zurecht, damit sie auch noch ins Bild kämen. Verschwenderisch teile ich Schönheit aus; soviel in meiner Macht liegt, soll geschehen, um dieser kümmerlichen Gegend ein wenig aufzuhelfen. Ein schmächtiges Bäumchen nah vor mir lasse ich hoch aufschießen, ich schenke ihm auch eine füllige Krone dazu, zierliches Blattwerk in seinem Geäst. Und ganz zuletzt male ich noch einen Feldweg, den habe ich ausgespart, weil ich ihn besonders hübsch machen will, einen blumigen Pfad durch die Wiese. Aber eben dieser Weg wird mir zu einem Wurm des Mißtrauens. Ich muß die Arbeit ruhen lassen und ein wenig zurücktreten, um das Ganze mit einem Blick zu überschauen.
Das Ganze, ach, es ist ja kein Ganzes geworden, wieder nicht. Ich sehe es nun sofort mit einem bitteren Gefühl der Enttäuschung. Was mir in der trügerischen Nähe und im Werden so glücklich geraten schien, wendet mir jetzt sozusagen die Kehrseite zu: die Wolke am Himmel sieht wie ein flüchtendes Gespenst und das Gekräusel über dem Hügel will auch kein Wäldchen mehr sein, sondern eben ein Mißgeschick.
Verdrossen setze ich mich wieder ins zerdrückte Gras und beschaue mein Machwerk voller Unmut. Weil es nun doch schon einerlei ist, was daraus wird, oder um es ganz zu verderben, tauche ich den Pinsel noch einmal in die schwärzeste Farbe und fülle das ganze Blatt mit allerlei sonderbarem Getier. Vorn auf den blumigen Weg stelle ich einen Hirsch. Mit dem absinnigen Blick, der gekrönten Häuptern eigen ist, starrt er vor sich hin. Um ihn ein wenig aufzumuntern, lasse, ich einen Hund nach seiner Kehle springen. Aber den beachtet er nicht, etwas ganz anderes gibt ihm zu denken, ein Nebenbuhler, ein zweiter Hirsch. Dieses unheimliche Geschöpf verbirgt sich hinter dem Hügel, nur das mächtige Geweih ragt hervor, und daraus läßt sich schließen, daß es ein riesengroßer Hirsch sein muß. Wenn die beiden zusammentreffen, kann es kein gutes Ende nehmen. Ich merke wohl, daß hier noch etwas fehlt, der Mensch, die ordnende Vernunft, die aus einer Wolke von Schießpulver spricht.
Während ich also den Jäger male, wie er eben anschlägt und die Kugel fliegen läßt, tritt ein fremder Mann neben mir aus dem Wald. Dieser Mensch erschreckt mich sehr, weniger, weil er eine Asthacke unter dem Arm trägt, sondern weil er stehenbleibt, um mein Bild zu betrachten. Das Malen gehört zu den Geschäften, die ein schamhafter Mensch nicht verrichten kann, wenn er Zuschauer hat. In meiner Beklemmung versuche ich, das Beste zu retten, vielleicht läßt sich der Mann hinter mir versöhnlicher stimmen, wenn ich wenigstens den Jäger recht ansehnlich male, mit einem Bart unter dem Kinn, wie er selber einen trägt. Auf solche Art wäre noch manches gutzumachen, ließe sich nur dieser lächerliche Hirsch hinter dem Hügel verscheuchen.
Eine stumme Weile verharrt der Mann in finsterem Ernst, auf den langen Stiel seiner Axt gestützt, als wollte er die Untat bis zur Vollendung reifen lassen, und mir ist auch wirklich zumut wie einem, dem nur noch ein Vaterunser zu verrichten bleibt.
Aber plötzlich tut der Mann den Mund auf — „schön“, sagt er. Ein guter Hirsch! Der vordere weniger, aber der andere. Er versteht sich nämlich darauf, weil er einmal Wildhüter gewesen ist.
Auf solche Art kommen wir ins Gespräch. Es sei ja leider nicht mein bestes, was er hier sehe, erkläre ich ihm. Wenn das Papier nicht zu klein wäre, oder sonst noch Platz auf dem Bild, wollte ich ihm einen ganz anderen Hirschen malen, einen Achtzehnender meinetwegen, wie er seinerzeit nur dem Kaiser vor die Büchse kommen durfte.
„Wohl“, sagte der Mann und ist willens, mir alles zuzutrauen. Aber es muß einem gegeben sein. Er meint, was ihn beträfe, er würde lieber ein Klafter Holz mit dem Sackmesser kliebea als nur einen kleinsten Hirschen aufmalen.
Inzwischen ist auch der Meister herbeigekommen, die Neugier hat ihn von der Arbeit aufgescheucht. Er schwenkt sein Malbrett in der Hand und lehnt es zum Trocknen an einen Baum, und jetzt ist es wohl Zeit, daß ich Hirsch und Hund und Jägersmann verschwinden lasse, denn nun werden meinem bärtigen Freund erst vollends die Augen übergehen. Der Mann betrachtet auch das neue Bild mit einem wägenden Blick, und dann nickt er dem Meister begütigend zu. „Auch nicht übel“, sagt er.
(Aus dem Erzählungsband „Die Pfingstreise( mit Bewilligung des Otto-Müller-Verlages, Salzburg)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!