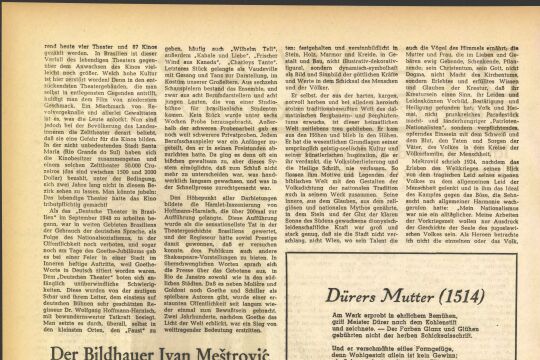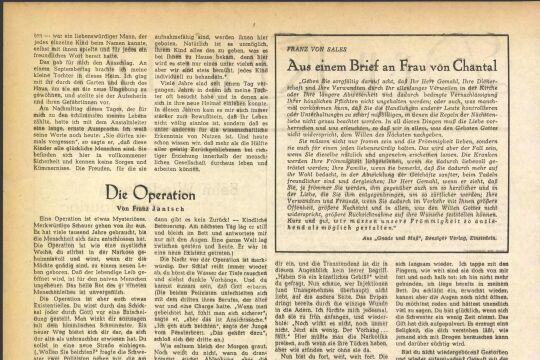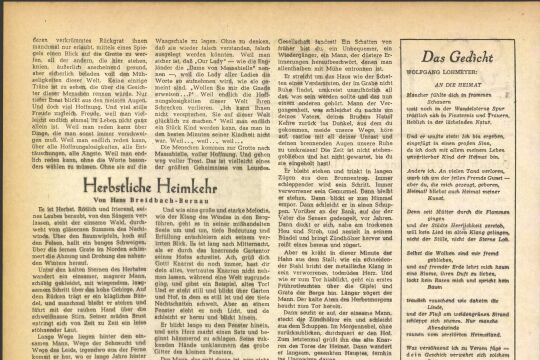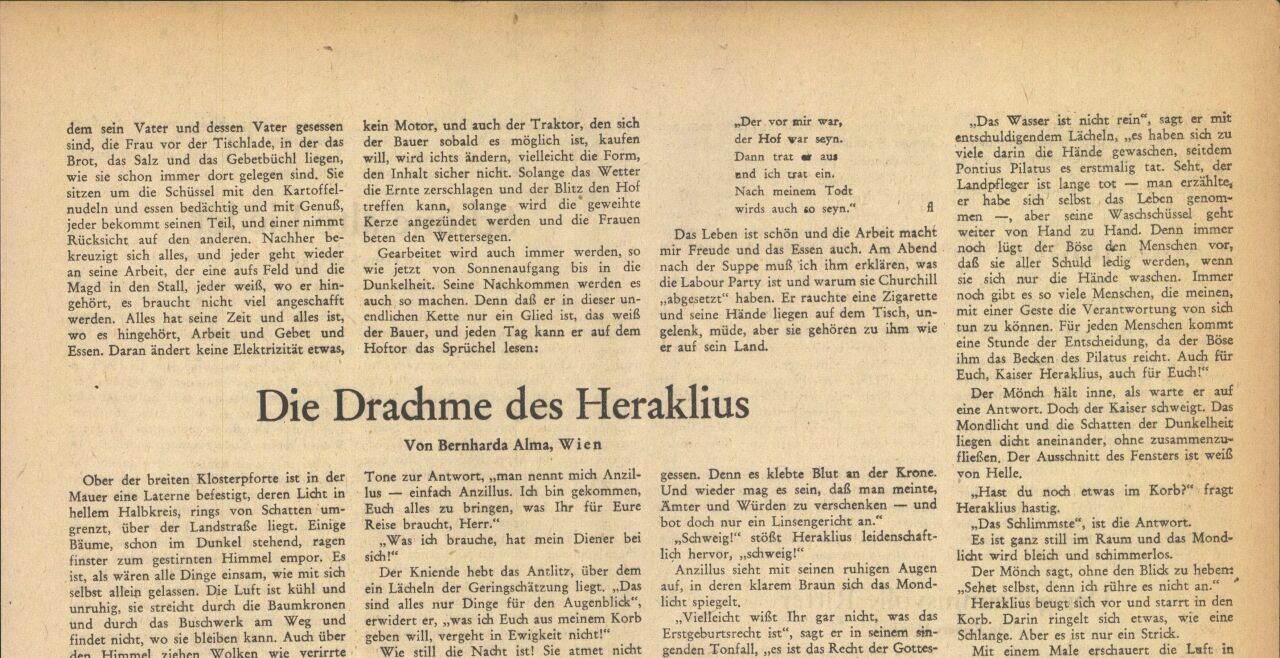
Ober der breiten Klosterpforte ist in der Mauer eine Laterne befestigt, deren Licht in hellem Halbkreis, rings von Schatten umgrenzt, über der Landstraße liegt. Einige Bäume, schon im Dunkel stehend, ragen finster zum gestirnten Himmel empor. Es ist, als wären alle Dinge einsam, wie mit sich selbst allein gelassen. Die Luft ist kühl und unruhig, sie streicht durch die Baumkronen und durch das Buschwerk am Weg und findet nicht, wo sie bleiben kann. Auch über den Himmel ziehen Wolken wie verirrte Schatten.
Zwei Reiter, die über die Landstraße kommen, halten ihre Pferde vor der Klosterpforte an. Das Licht der Laterne fällt über ihre Mäntel mit den tief herabgezogenen Kapuzen.
„Soll ich um Einlaß pochen, Herr?“ fragt der eine, dessen weißer Bart im Licht wie Silber glänzt. Es ist Alexander, der vertraute Diener des Kaisers.
Der andere ist Heraklius selbst. Der Kaiser will unerkannt im Kloster verweilen, um ferne dem Hofgetriebe zu einem Entschluß zu kommen. Die Zeiten sind schwer und es liegt viel auf den Schultern des Herrschers. In Stille und Alleinsein will er mit sich selbst Rat halten.
Er nickt Bejahung auf die Frage des Dieners. Der Alte schwingt sich vom Pferd und klopft mit dem bereithängenden Hammer gegen das Tor. Aufgescheucht flattert ein Vogel aus dem Gebüsch. Dann ist es noch um Vieles stiller als vorher, bis das Tor geöffnet wird. Der Graukopf bittet den Pförtner um Obdach für diese Nacht. „Für meinen edlen Herrn und für mich selbst“, sagt er. „Tretet ein und der Friede Gottes sei mit Euch“, entgegnet der Pförtner. „Ich will sogleich Eure Pferde besorgen lassen.“
Im Klostergang heißt der Prior die beiden Gäste willkommen. Er fragt nicht nach ihren Namen. Er läßt jedem ein eigenes Gemach anweisen und einen Imbiß bringen. Rasch verabschiedet er sich mit einem Nachtgruß.
Der Kaiser ist allein in dem einfadicn, kleinen, durch einen Vorhang von dem Gang getrennten Gemach, dessen einziger Sdimuck ein großes Gemälde ist.
Es stellt die von ihren Nachbarinnen umringte Frau aus dem Evangelium dar, die die verlorene Drachme wiedergefunden hat. Sie hält die Münze in der erhobenen Rechten, während sie mit der Linken eine brennende Lampe trägt.
Heraklius betrachtet das Bild im Schein des öllidites, das den Raum sanft erhellt, ohne die Sdiatten bannen zu können, die Dunkelheit drängt aus allen Winkeln. Vor dem kleinen, hoch angebraditen Fenster hängt ein schleierartiges Tudi, das leise zittert, so, als atmete die Nacht draußen. Der Herrscher läßt den Imbiß unberührt, leert nur den Weinbecher, wirft sich halbentkleidet auf das Lager.
Es ist jetzt ganz still — man hört nicht einmal das Rauschen der Bäume oder sonst irgendeinen verlorenen Laut — und der Kaiser entschlummert.
Langsam schlürfende Schritte wecken ihn und er glaubt, daß der Diener nach einem Wunsche fragen will, und richtet sich auf.
Die Öllampe ist erloschen, aber das ganze Gemach ist vom Silberlicht des aufgegangenen Mondes erfüllt, das die Sdiatten dort, wo sie sich behaupten können, scharf und dunkel durchschneiden.
Neben dem Bett des Kaisers, auf dem im Mondlicht weiß sdieinenden Teppich, kniet ein Mann. Es ist nicht der vertraute Alte, sondern ein Mönch, dem der Kopf tief zwischen hohen, gewölbten Schultern sitzt. Er hat einen Korb vor sich stehen, dessen Deckel er eben herabnimmt.
„Wer bist du?“ fragt der Kaiser verwundert.
„Ich bin ein dienender Bruder“, gibt der Verwadisene demütig, in leise singendem Tone zur Antwort, „man nennt mich Anzil-lus — einfach Anzillus. Ich bin gekommen, Euch alles zu bringen, was Ihr für Eure Reise braucht, Herr.“
„Was ich brauche, hat mein Diener bei sich!“
Der Kniende hebt das Antlitz, über dem ein Lädieln der Geringschätzung liegt. „Das sind alles nur Dinge für den Augenblick“, erwidert er, „was ich Euch aus meinem Korb geben will, vergeht in Ewigkeit nicht!“
Wie still die Nacht ist! Sie atmet nicht mehr, so still ist sie. Und überall liegt weiß und stumm das Licht des Mondes mit seinem hellen, eindringlichen Leuchten.
Bruder Anzillus hat einen einfachen, irdenen Topf hervorgeholt und hält ihn dem Kaiser hin.
„Das ist die Speise, die jedem geboten wird, die jeder weitergibt — nach der jeder verlangt. Auch Ihr, Kaiser Heraklius, auch Ihr!“
„Du weißt also, wer ich bin — und bietest mir eine Speise in einem irdenem Gefäß?“
Wieder lächelt der Mönch, als er antwortet: „Ich biete sie Euch nicht. Andre haben sie Euch gereicht — und Ihr habt danach gegriffen und den gleichen Preis wie Esau dafür bezahlt. Jeder muß diesen Preis zahlen.“
„Ich verstehe dich nicht“, sagt Heraklius; aber vielleicht versteht er die Worte doch.
„Es ist das Linsengericht, das Jakob seinem hungernden Bruder für das Recht der Erstgeburt verkaufte. Immer wieder bietet man solch ein Linsengericht an, immer wieder verkauft man sein heiligstes Recht dafür. Darum kann der Topf nie leer werden, darum steht er auf der prunkenden Fürstentafel und auf dem verfallenen Herd des Armen. Der Böse selbst stellt das Linsengericht vor jeden hin, damit die Menschen sich daran sättigen und nicht nach dem geheimnisvollen Brot verlangen.“
Wieder sagt Heraklius: „Ich verstehe dich nicht!“ Aber ihm ist, als habe er den Topf, den der Mönch unbeweglich emporhält, auf seiner kaiserlichen Tafel stehen gesehen, einmal und noch einmal — vielleicht täglich.
„Es mag sein, daß man eine Krone zu erringen glaubte“, flüstert Bruder Anzillus, „und hat doch nur ein Linsengericht gegessen. Denn es klebte Blut an der Krone. Und wieder mag es sein, daß man meinte, Ämter und Würden zu verschenken — und bot doch nur ein Linsengericht an.“
„Schweig!“ stößt Heraklius leidenschaftlich hervor, „sdiweig!“
Anzillus sieht mit seinen ruhigen Augen auf, in deren klarem Braun sich das Mondlicht spiegelt.
„Vielleicht wißt Ihr gar nicht, was das Erstgeburtsrecht ist“, sagt er in seinem singenden Tonfall, „es ist das Recht der Gottes-kindschaft. Habt Ihr das gewußt?“
„Was hast du noch im Korb?“ fragt Heraklius herrisch.
Der Mönch hebt zwei silberne Rauchfässer empor und schwingt sie ein wenig an der langen Kette, daß sie zwischen der Mondhelle und dem Dunkel spielen.
„Erkennt Ihr sie?“ fragt er und lächelt,
„Sprich deutlicher“, erwidert Heraklius und Qual fällt ihn an.
„Es sind die Rauchfässer des Nadab und Abiu, der Söhne Aarons. Sie braditen darin ein fremdes Feuer zum Opfer des Herrn. Wißt Ihr, was ein fremdes Feuer ist?“
Heraklius antwortet nicht. Er blickt die Rauchfässer an und ihm ist, als habe man sie oft vor ihm entzündet — und als habe er sie selbst geschwungen — einmal und noch einmal.
Sein Blick trübt sich, weil Weihraudi-wolken aufsteigen — Rauch von dem fremden Feuer.
„Gott hat geboten, wie man vor Ihm opfern soll“, flüstert der Mönch, „aber Nadab und Abiu meinten, sie könnten es nach eigenem Willen tun. Sie starben an ihrer Tat, aber die Rauchfässer hat der Böse für die Menschheit aufbewahrt. Sie dienen nidit nur zum Gebrauch im Heiligtum, sie dienen auch dazu, dem Götzen Mensch Weihrauch zu opfern. Der Böse läßt sie vor Menschen spielen — daß sie sich huldigen lassen oder andern wie Göttern huldigen. Vor allen Menschen läßt der Böse sie spielen, auch vor Euch, Kaiser Heraklius, auch vor Euch!“
„Du wagst viel, Anzillus. Was hast du noch in dem Korb? Sag!“
Anzillus hält dem Kaiser ein Becken entgegen, das mit trübem Wasser angefüllt ist.
„Das Wasser ist nicht rein“, sagt er mit entschuldigendem Lächeln, „es haben sich zu viele darin die Hände gewaschen, seitdem Pontius Pilatus es erstmalig tat. Seht, der Landpfleger ist lange tot — man erzählte, er habe sich selbst das Leben genommen —, aber seine Waschschüssel geht weiter von Hand zu Hand. Denn immer noch lügt der Böse den Mensdien vor, daß sie aller Schuld ledig werden, wenn sie sich nur die Hände waschen. Immer noch gibt es so viele Menschen, die meinen, mit einer Geste die Verantwortung von sich tun zu können. Für jeden Mensdien kommt eine Stunde der Entscheidung, da der Böse ihm das Becken des Pilatus reicht. Auch für Euch, Kaiser Heraklius, auch für Euch!“
Der Mönch hält inne, als warte er auf eine Antwort. Doch der Kaiser schweigt. Das Mondlidit und die Schatten der Dunkelheit hegen dicht aneinander, ohne zusammenzufließen. Der Ausschnitt des Fensters ist weiß von Helle.
„Hast du noch etwas im Korb?“ fragt Heraklius hastig.
„Das Schlimmste“, ist die Antwort.
Es ist ganz still im Raum und das Mond-licht wird bleich und schimmerlos.
Der Mönch sagt, ohne den Blick zu hebern „Sehet selbst, denn idi rühre es nicht an.“ *
Heraklius beugt sich vor und starrt in den Korb. Darin ringelt sich etwas, wie eine Schlange. Aber es ist nur ein Strick.
Mit einem Male erschauert die Luft in sich selbst und eine große Trostlosigkeit breitet sich aus.
„Erkennt Ihr ihn?“ fragt Anzillus flüsternd, „erkennt Ihr ihn? Sagt!“
„Ich weiß es nicht“, erwidert der Kaiser gequält,
Anzillus spridit: „Dies ist der Strick, an dem Judas sich erhenkte. Nun hält der Böse damit seine Welt zusammen. Und er spielt ihn vielen Menschen in die Hände, aber zum Glück greifen nur die wenigsten danach, und von denen werfen manche ihn wieder fort. Denn er ist furchtbarer als alles andre. Nur der Böse versucht stets wieder, ihm Schönheit und Verheißung anzulügen. So bietet er ihn den Menschen an — allen. Auch Euch, Kaiser Heraklius, auch Euch!“
„Auch mir —“, murmelt der Kaiser tonlos.
„Seht an Pilatus, wie der Böse über Menschen herrschen kann. Die Stunde, die des Pilatus' Gnadenstundc hätte werden können, ■wurde ihm zum Verderben. Für das Linsengericht der Voiksgunst opferte er den Gerechten, den Gottsohn und brachte das fremde Feuer der Anbetung dem Götzen Tiberius und der sinnlosen Selbstvergötterung. Dann wollte er die Verantwortung in einer Waschsdiüssel von sich streifen — und zuletzt blieb ihm nur der Strick des Judas zu erlogener Rettung. Es ist immer nur ein 'Schritt vom Linsengericht über die Rauchfässer und das Waschbecken bis —“
„Schweig!“
„Kaiser Heraklius! Für das Linsengericht der Krone opfertet Ihr den Adel Eurer Seele — denn das Blut Eures Vorgängers ist an Euren Händen. Dann habt Ihr Euch mit Weihrauch vergöttern lassen und habt Euch ob vieler Schuld zehn Jahre lang immer wieder, wie Pilatus, die Hände gewaschen. Aber Ihr konntet das Blut des Phokas nicht abwaschen und nicht die Verantwortung für die zehn Jahre Eurer Regierung. In dieser Zeit habt Ihr Provinz um Provinz verloren und, was mehr gilt, das heilige Kreuz Christi habt Ihr in die Hände der Perser fallen lassen. Und wenn Ihr den Verführern folgt, die Euch schon nahe sind, und dem Christentum abschwört, dann greift Ihr nach dem Strick des Judas.“
„Du sprichst hart zu mir“, sagt Heraklius, „nie hat ein Mensch gewagt, so zu mir zu reden. Fürchtest du meine Macht nicht?“
Der Mönch lächelt und blickt langsam auf.
„Du hast mir lauter böse Dinge gezeigt“, nimmt Heraklius wieder das Wort, „hast du keine freundliche Gabe mitgebracht?“
Anzillus verschließt den Korb wieder, als er entgegnet: „Das Frohe und Gnadenvolle ist bereits im Gemach.“
Es ist jetzt sehr dunkel, nur über dem Bild an der einen Wand liegt noch Helle, sammelt sich dort, wo die Frau die Münze emporhält, zu leuchtendem Glanz.
Heraklius blickt ergriffen auf die silberne Drachme, die durch die Dunkelheit leuchtet.
„Jeder verliert die Drachme in seinem Leben“, sagt der Mönch, „jeder muß sie suchen. Aber es herrscht Finsternis, wenn man sie verliert, und man kann sie nur finden, wenn die eigene Lampe brennt. Wer erst beim Krämer öl kaufen geht, versäumt zu viel Zeit.“
„Was ist die Drachme?'Sag!*
„Das Verlorene und Wiedergefundene“, erwidert Anzillus und es klingt, als ob er lächelte.
Je dunkler es im Gemache wird, desto heller leuchtet die Münze auf dem Bilde. Halb singend, spricht Anzillus weiter: „Die Menschen müssen nicht nur ihre verlorene Drachme suchen — sie müssen auch selbst die Drachme sein, die sich finden läßt. Und sie müssen darum den Allmächtigen bitten. Alle Menschen. Auch du, Kaiser Heraklius, auch du!“
„Du redest wahr — auch ich!“ flüstert der Kaiser.
Und er fragt mit stockender Stimme: „Wenn ich das Kreuz Christi aus Persien zurückbringe, habe ich dann meine Drachme wiedergefunden? Sag!“
Aber keine Antwort erfolgt. Der Kaiser ist allein. Das Mondlicht ist verblaßt und nur die kleine Lampe schimmert durch das Dunkel.
Andern Tages nimmt Heraklius von dem Prior Abschied. Der hätte gern dem ernsten Fremden längere Unterkunft gewährt. Als der Diener bereits die Pferde in den Klosterhof führt, wendet sich der Kaiser nochmals
an den Prior mit der Bitte: „Ruft doch den Bruder Anzillus.“ „Wen meint Ihr?“
„Den dienenden Bruder Eures Klosters, Anzillus, den Verwachsenen.“
„Wen meint Ihr?“ entgegnet der Priester verwundert,' „wir haben keinen Verwachsenen in unserem Kloster und keinen, der den Namen Anzillus trägt.“ ...
Der Morgen ist klar und sonnig, endlos strahlt das Blau des Himmels über der Landschaft und es ist, als sei alles gut.
„Höre“, sagt Heraklius zu dem knapp hinter ihm reitenden Vertrauten, „ich habe es mir Nachts zurechtgelegt. Ich werde mit meinem Heer nach Persien ziehen und das heilige Kreuz von den Heiden zurückholen.“
„Gott segne diesen Entschluß, Herr!“
„Ich will es fortan bewahren. Man findet alles wieder, wenn man mit brennender Lampe sucht!“
Wie sie eine Anhöhe erreichen, können sie das Meer sehen, das wie eine riesenhafte, flammende Leuchte in Morgenschönheit sich breitet.
Schweigend setzt Heraklius den Weg fort und seine Gedanken sind wie ein Psalm.