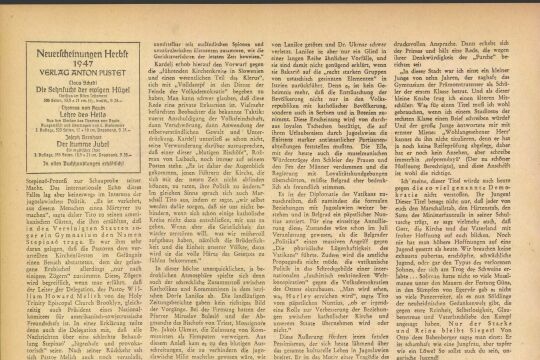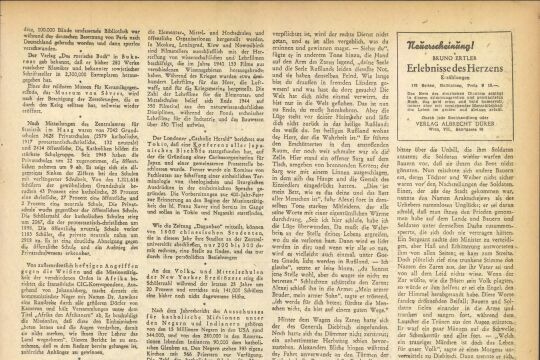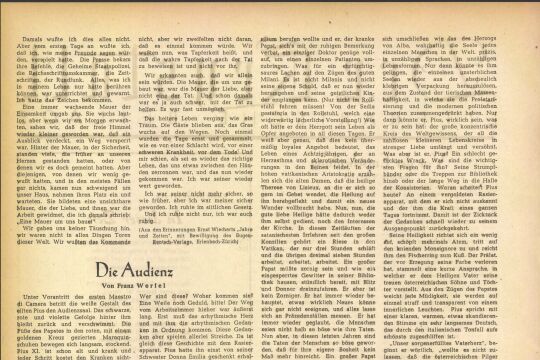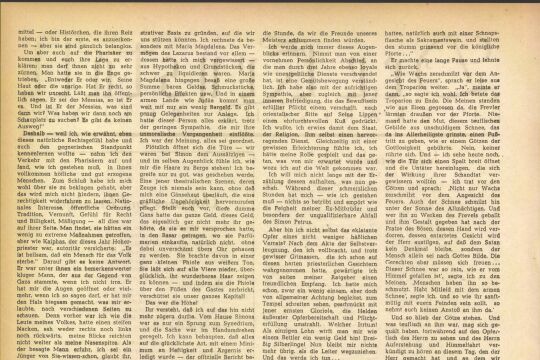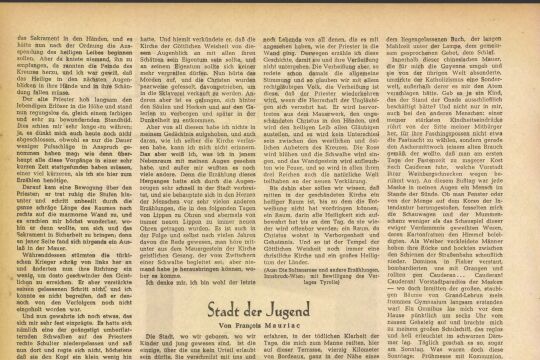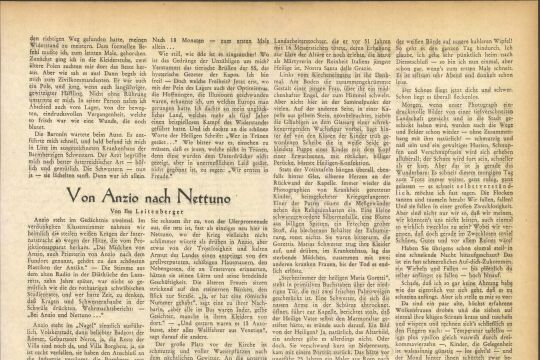ROM, ANNO SANTO 1950. Kaum noch liegt eine Spur des kommenden Herbstes über dem Petersplatz. Wochen werden vergehen, ehe der Wind aus der Campagna die ersten Spuren der vergehenden Jahreszeit über diesen Platz weht. Prall noch wirft die Sonne ihre Strahlen über die Kuppel von St. Peter, über die Kolonnaden Berninis, den Obelisk inmitten der Ellipse, über die beiden Brunnen, die unbekümmert ihr monotones Lied singen. Wirft ihre Strahlen über die vielen Autobusse, die sich parkend dem Oval des Platzes einfügen. Wirft ihre Strahlen über die lange Reihe von Pilgern, die ununterbrochen hinauf zum Dom schreiten. Um sich vor der Porta sancta zu einer Schlange zu formieren. Zu einer Schlange, in der alle Nationen der Welt vertreten zu sein scheinen. Und die doch Lücken aufweist. Als sollten diese Plätze, zumindest symbolisch, für alle jene reserviert bleiben, die noch im Anno santo 1925 nodi 1933 kamen. Die im näselnden Polnisch, im weichen Slowakisch, im seltenen Kroatisch, im harten Tschechisch, in Rumänisch, in Magyarisch ihre Lieder sangen. Die inmitten all der romanischen Lebhaftigkeit mit melancholischen Blicken die Fassade von St. Peter bewunderten oder stumm dem Singen der Brunnen lauschten. Und geduldig warteten, als hätten sie Zeit, endlos Zeit für Jahrhunderte.
So aber wartet jetzt der Platz vergeblich auf diese Völker, streckt vergeblich ihnen wie eine Mutter, die ihre Kinder umfangen will, die Arme seiner Kolonnaden entgegen, läßt vergeblich die Brunnen Tränen weinen. „Wer, wenn ich schrie, hörte mich“ denn“, heißt es in den Duineser Elegien. „Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn“, könnte dieser Platz ebenfalls klagen.
IM DOM VON ST. PETER. Längs der Wände Beichtstuhl neben Beichtstuhl. Dutzende Menschen davor. .Lingua hispanica“ steht auf einem, „lingua bri-tannica“ auf einem andern, „lingua germanica“ auf einem dritten. Und so fort. Jede Nation kann hier in ihrer Sprache ihre Sunden abladen. Dann plötzlich ein Beichtstuhl: kein Mensch davor, kein Mensch, der darin kniet. Nur ein Priester sitzt in dem Kasten, betet mit ununterbrochen sich bewegenden Lippen das Brevier, betet, ohne aufzublicken. „Lingua illyrica“ steht auf dem Beichtstuhl. Es ist der Beichtstuhl der Kroaten.
IN DEN VATIKANISCHEN MUSEEN. In einem der vielen Säle, ein Kolossalgemälde: der Triumph des polnischen Königs Johann Sobieski und des polnischen Heeres nach der siegreichen Schlacht am Kahlenberg. Das Bild: gemalt in der Manier des späten 19. Jahrhunderts. Sehr gut. Aber angesichts der Kunstwerke, die diese Museen bergen, drittklassig. Begreiflich, daß der dichte Strom der Besucher sich achtlos an dem Bild vorbeischieben läßt, kaum einen Blick darauf wirft, geschweige' denn stehenbleibt. Nur polnische Pilger verharrten immer schweigend davor, im stummen Gedenken an jenen großen Augenblick der Geschichte, da ihre Nation einmal nicht Amboß, sondern Hammer war. Warum, die ihr hier vorbeigeht an diesem Bild, warum denkt ihr nicht einen Augenblick an dieses Volk, das einst, an dem Tage dieses Sieges, „Befreier der Christenheit“ genannt wurde, von dessen Verhalten aber heute vielleicht mehr abhängt, als da es sich
.ewigen Ruhm erwarb“, wie Papst Innozenz XL an den König schrieb?
•
SANT ANDREA NELL QUIRINAL. Die kleine Kirche gegenüber dem Vatikan ist vollkommen leer. Nur ein Mädchen kniet vorn in der Bank, im weiß-blauen Kleid. Die gleichen Farben am Hochaltarbild, das den heiligen Andreas in seiner Marter zeigt, angenagelt am Kreuz mit den schiefen Balken. Blau der Himmel, weiß der Körper des Gemarterten. Weiß und blau: die alten Farben Rußlands. Blut fließt aus den Wunden des Apostels, rotes Blut, das langsam die andern Farben überdeckt. So wie die Farben des neuen Rußland die Farben des alten. Ihr Pilger in der Ewigen Stadt, denkt ihr an dieses viele Blut, das ständig vergossen wird? Aber die Kirche ist leer und die Gedanken des Mädchens, vorn im weißblauen Kleid, kreisen sicher um andere Sorgen.
SAN LORENZO FUORI LE MURA. Schief fällt die Sonne in den ruhigen und schönen Raum dieser altrömischen Basilika, die dber der Marterstätte des „Helfers der Armen“ errichtet ist. Links und rechts stehen inmitten der Kirche die Ambonen, Stufen führen zum Altar hinauf, anter dem sich der Sarkophag des
Heiligen befindet. Wie überall jetzt in Rom: auch hier eine Gruppe von Pilgern, eine kleine Gruppe, die sich die Kirche ansieht und dann zum Sarkophag hinabsteigt. Einen Augenblick stehen sie stumm, dann spricht eine fast heisere Stimme: „Wir gedenken hier am Grabe dieses frühchristlichen Märtyrers der Märtyrer unserer Zeit: des Kardinals Mindszenthy, des Erzbischofs Stepinac, der verhafteten Bischöfe von Rumänien, der verschollenen Bischöfe des Baltikums, -des ermordeten griechisch-unierten Bischofs von Munkacs und all der Namenlosen, die heute das Martyrium über sich ergehen lassen.“ Wieder ein Augenblick Stille, dann hängen für kurze Zeit die
Worte eines Gebetes in der Luft. Dann wieder Stille.
DAS KOLOSSEUM. Zehn Uhr nachts. Schatten huschen über die Mauern, verschwinden, tauchen wieder auf: eine kleine Schar von Pilgern schreitet mit brennenden Lichtem durch die Gänge. Drei Vorbeter singen auf lateinisch die Allerheiligenlitanei, dünne und nicht sehr geübte Stimmen singen die Responsen. Ein Strolch, der auf den Steinen übernachtet, 6chrickt plötzlich auf nnd stiert den Pilgerzug an. Mit Augen, wie sie auf den Bildern der Surrealisten wiederkehren. Dann bleibt der Zug stehen, der Gesang hört auf, die Lichter verlöschen. Langsam wachsen aus der Dunkelheit die Konturen des riesigen Kreuzes empor, das inmitten der Arena steht. Eine Stimme hebt leise an; eine reltsome Stimme, denn sie wirft die Worte gebündelt aus dem Mund, so daß fast nur Bruchstücke verständlich sind. „Kreuz“, sagt die Stimme, .Martyrium... wir vielleicht alle... in besonderer Weise... Brüder und Schwestern ... jenseits des Eisernen Vorhanges... ihr Beitrag zum Heiligen Jahr... größer als unserer... Sollen wissen... nie von uns vergessen ... nie von der Kirche verlassen... unser Gedenken.“ Die Stimme bricht ab, dann — einige Sekungen später — beginnt ein monotones Murmeln, wie es Betern eigen ist, die die Gesetze des Rosenkranzes sprechen. Wie ein Block hebt sjch aus dem Gemurmel immer nur der Satz: .Der für uns das schwere Kreuz getragen hat.“ Aber manchmal klingt es, als würden einige beten: „Die für uns das schwere Kreuz getragen haben.“
PAPSTAUDIENZ IN ST. PETER. Schon um halb drei Uhr nachmittag beginnen sich die Massen vor den Planken des Petersplatzes zu stauen. Um vier Uhr wird das Gedränge lebensgefählich. Um fünf Uhr ist der riesige Dom voll. Mit 80.000 Menschen. Vorn, knapp vor der Confessio, ist ein schmuckloser Thron aufgestellt; ohne Baldachin, dafür mit zwei Mikrophonen davor. Lautsprecher rufen in den verschiedensten Sprachen die einzelnen Pilgergruppen auf. Ein Prälat mit prachtvollem Renaissancegesicht steht auf dem Podium und streicht in einer Liste die Aufgerufenen an. Um halb sechs Uhr kommt ein Zug Schweizergarde und nimmt rund um den Thron Aufstellung. Um dreiviertel sechs verstummen die Lautsprecher. Punkt sechs Uhr flammen mit einem Schlag alle Luster des Domes mit ihren Tausenden von Kerzen auf und übergießen das Schiff der Kirche mit einem zauberhaften Licht. Und gleichzeitig steigt ganz rückwärts ein Lärm, wie das Wogen des Meeres auf. Und dann sieht man, gleichsam wie ein kleines Schiff, eine Sänfte über diese Wogen dahingleiten und auf dem Tragsessel die weiße Gestalt des zwölften Pius, die sich immer wieder weit hinunterbeugt, als wollte sie jeden einzelnen begrüßen. Je näher der Zug kommt, desto stärker wird das Tosen. In das kindliche und ganz ungeordnete Rufen der Italiener mischt sich das Toben der Spanier, der frenetische Jubel der Iren. Hunderte von Deutschen fallen präzis und exakt mit ihrem Hoch ein, Briten verlieren die Fassung, Amerikaner werden halb verrückt vor Begeisterung und selbst der Jubel dy Franzosen sprengt den Rahmen aller klassischen Ruhe, die sonst dieser Nation des Esprit und der Logik eigen ist. Eine ungeheure Jubelsymphonie begleitet den Zug des Papstes, eine Symphonie, die so stark ist, daß man ihr gar nicht das Fehlen einiger oder vieler Instrumente anhört.
Der kleine Zug des Papstes geht um den Hochaltar herum, kehrt dann zurück, bleibt vor dem Thron stehen. Mit jugendlichem Schritt schreitet die Gestalt des zwölften Pius von der Sänfte herab, die Stufen des Thrones hinauf. Es wird totenstill. Langsam beginnt der Papst die einzelnen Pilgergruppen aufzurufen, winkt jeder zu, spricht zu jeder Nation in ihrer Sprache. Zuerst italienisch, dann französich, dann englisch, schließlich noch spanisch und zuletzt deutsch. Dann sind die Ansprachen vorbei. Kein slawisches Wort hat sich ihnen angeschlossen, keine Rede an Ungarn oder Rumänen. Alle diese Kinder der Kirche sind in einer tragischen Ferne von diesem „Domus Dei“.
Doch dann ein unvergeßlicher Augenblick: die hohe Gestalt des zwölften Pius erhebt sich vom Thron, scheint zu wachsen, die Hände greifen nach rückwärts, als wollten sie alle Menschen der Welt umfassen, als wollten sie den Himmel auf diese Menschen herunterreißen. Ein schmerzlicher Zug erscheint auf dem römischen Aristokratengesicht, das im Profil so sehr dem Bilde Carlo Borromäus' gleicht, dann hebt sich feierlich die Rechte, macht vertikal den einen Balken des Kreuzes, dann horizontal den andern Balken. Die Hand gleitet von links nach rechts, von ganz weit links nach ganz rechts. Dieser Segen geht nicht nur allein über diese Pilger hier, nicht nur über die Stadt, sondern über die Welt, geht besonders über alle jene, die nicht hier sind, weil sie nicht hier sein können.
Einen Augenblick noch herrscht Ruhe. Dann bridit der Jubel wieder los: in das kindliche und ganz ungeordnete Rufen der Italiener mischt sich das Toben der Spanier und Iren, das exakte „Hoch“ der Deutschen, der fassungslose Jubel der Amerikaner und Briten und die alle Logik und allen Esprit sprengende Freude der Franzosen.
SANTA MARIA DELLA VITTORIA. Wie eine kleine und ärmere Schwester der Kirche gleichen Namens auf der Prager Kleinseite wirkt diese römische Kirche in der Nähe der Fontana Trevi. Das „Bambino di Praga“, das auf einem Seitenaltar aufgestellt ist, wirkt gegenüber dem „Prager Jesulein“ so ärmlich, daß es “direkt Mitleid erweckt. Auch die Fresken über dem Hochaltar, die den Einzug des siegreichen kaiserlichen Heeres nach der Schlacht am Weißen Berg in Prag zeigen, können sich kaum mit der Malerei Roberto de Longins in Prag messen. Einzig die Figur der „Großen“ Theresia von Bernini links vom Hochaltar, bringt etwas Glanz in den Raum.
Es ist Donnerstag und die Kirche tagsüber geschlossen. Weshalb sie leer und verlassen wirkt. Wie es wahrscheinlich in diesem Augenblick ihre große Prager
Schwester wirklich ist. Wenn nicht irgendein Einsamer sich hineingeschlichen hat, um die unvergänglichen Worte zu sprechen: „Prijd' kralovstvi Tve“ — zu uns komme Dein Reich. Oder richtiger übersetzt: Zu uns komme Dein königliches Reich! Unvergängliche Worte, fast hoffnungslos angesichts der täglich stärker werdenden Erbarmungslosigkeit des irdischen Reiches. Aber ein Jahrtausend lang sprachen Lippen in diesem Land diese Worte, sprachen sie angesichts des ewigen brodelnden nationalen, sozialen, religiösen Hasses, sprachen sie inmitten der Verlassenheit, nahe der Verzweiflung, oft mit zerbrochenen Herzen. Warum sollten sie heute nicht gesprochen werden? „Zu uns komme Dein königliches Reich?“ Was hat sich geändert gegenüber andern Jahrhunderten? Warum sollte die jetzige Hoffnungslosigkeit ärger sein als jene, an der ein1' heiliger Adalbert zugrunde ging? „C'est l'amour seul, qui compte“, war eines der letzten Worte der kleinen Theresia, der Schwester der „Großen“ Theresia da drüben. „Nur die Liebe allein hat Gewicht.“ Und sie allein verwandelt. Und wird verwandeln. L'amour seul.
Draußen flimmert die Straße im Licht des späten Tages. Trollybusse hasten vorbei, zum Bersten vollgepfercht mit Fahrgasten. Autoreifen kreischen am Asphalt. Polizisten in weißer Uniform mit Tropenhelm gehen mit der Miene römischer Senatoren vorbei. Kleine schwarzhaarige Kinder balgen sich vor den Häusern. Ein paar Fremde stehen am Rande der Fontana Trevi und werfen Münzen in das tosende Wasser, dem alten Aberglauben frönend, daß jeder wiederkehrt, der dies tut.
Publikum und Kritik
Das Publikum kauft eine Sache, der Kritiker betrachtet sie. Daraus ergeben sich Differenzen. Das Publikum will sich der Sache freuen, für die es Geld ausgegeben hat, der Kritiker sieht sich die Sache an, für die Geld ausgegeben wird. Das Publikum glaubt an den Wert des ausgegebenen Geldes, der Kritiker untersucht diesen Glauben. Es ergeht ihm dabei wie dem Arzt. Dem Arzt, der eine bösartige Krankheit konstatiert, wird ebensowenig Glauben geschenkt wie dem Kritiker, der eine bestimmte Meinung nicht teilt. Das Publikum verlangt vom Arzt eine Diagnose und vom Kritiker eine Rezension, die ihm schmeichelt. Gute Gesundheit und ein ausgebildeter Verstand in künstlerischen Dingen sind Eigenschaften, die vom Publikum als schmeichelhaft empfunden werden. Stellt ein Arzt seine Diagnosen und schreibt ein Kritiker seine Rezensionen nach diesen Gesichtspunkten, so muß er Erfolg haben — wenigstens vorübergehend.
Ein gewissenhafter Arzt jedoch sieht nach der Krankheit und ein gewissenhafter Kritiker nach der Sache. Der eine kümmert sich dabei nicht um die Meinung der Patienten und der andere nicht um die Meinung des Publikums. Ihre Leidenschaft gilt ausschließlich der Sache. Das Publikum verliert dabei an Bedeutung. Dieses Verfahren hat einen Nachteil: es schafft Feinde.
Bei Ankauf eines Hauses v/ird gewöhnlich ein Fachmann zu Rate gezogen; man ist sich wohl über seinen Geschmack im klaren, aber man begreift, daß man nicht versteht, ob der geforderte Preis mit dem Wert des Objekts auch wirklich übereinstimmt. In der Kunst ist das etwas anderes. Hier glaubt jeder, alles zu verstehen. Hier trifft der Laie Entscheidungen, über die sich Fachleute nicht einigen können.
Jeder einzelne weiß, was ihm gefällt. Er hat einen bestimmten Geschmack, und jeder einzelne hat das Recht auf seinen Geschmack. Die Ansicht jedoch, daß dieser Geschmack der einzig richtige sein muß, ist lächerlich. Diese Feststellung gilt für Kritiker wie für Publikum.
Anders verhält es sich mit dem Wissen um die Materie in der Kunst. Hier spielt der persönliche Geschmack eine sehr untergeordnete Rolle. Wird jedoch bei kritischer Betrachtung eines Kunstwerkes vom persönlichen Geschmack ausgegangen, so wird ein falsches oder verzeichnetes Urteil entstehen. Da jedes Urteil aktiv über das Subjekt und passiv durch das Objekt entsteht, besitzt das resultierende Urteil nur bedingten Wert. Ein objektives Urteil gibt es nicht.
Der Wert der Kritik liegt in der Belebung und Anregung, die sie der Kunst zu geben vermag. Sie soll ernst genommen, aber nicht überschätzt werden. Kritik ist der Spiegel einer künstlerischen Leistung. Wenn man sich darin nicht gefällt, soll man ihn beiseitelegen.
Es ist nur wenigen Menschen gegeben, sich kritisch zu betrachten. Künstlern am wenigsten. Wer es kann, ist gewöhnlich einsam. Er weiß, wie wenig die Begeisterung der Menge und der Wert ihres Urteils bedeuten. Er weiß nur, daß das Leben kurz ist und oft ungenützt vergeht. Er weiß, daß im Leben viel Eitelkeit ist. Er sucht sein Wissen zu verbergen. Er steht neben den Dingen, und das wird bewundert oder übelgenommen.Er glaubt an einen höheren Sinn, an eine große Ordnung in den Dingen. Das verleiht dem Herzen einen ruhigen Schlag. Damit sind Eitelkeit und Lärm der Welt gegenstandslos geworden.