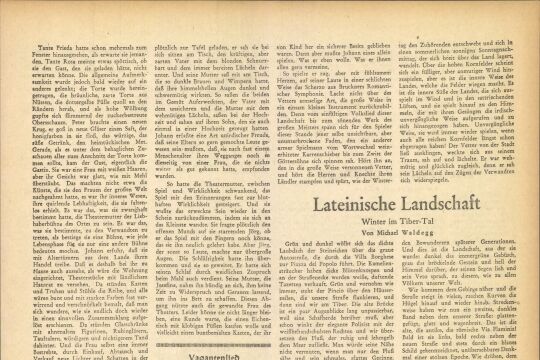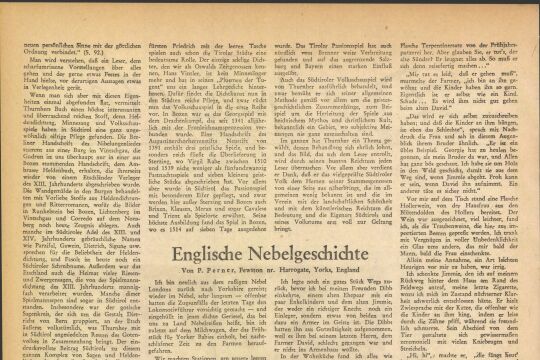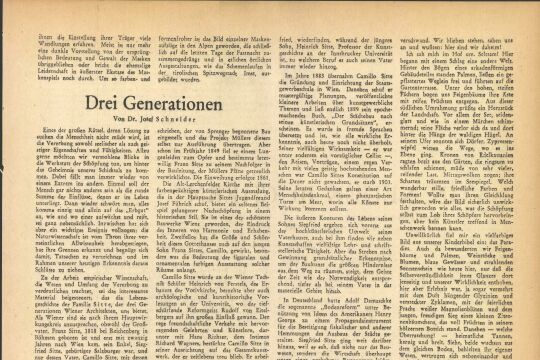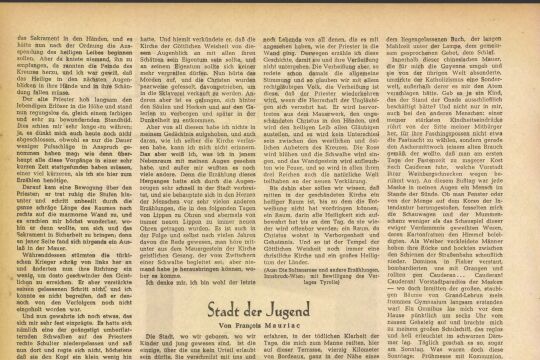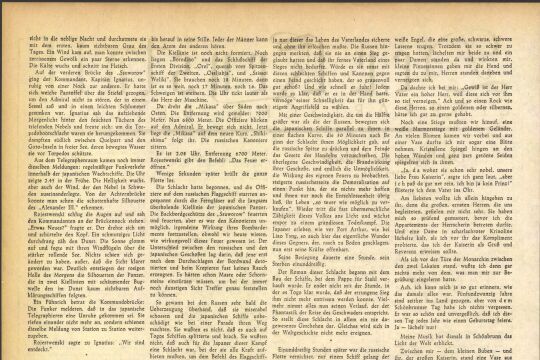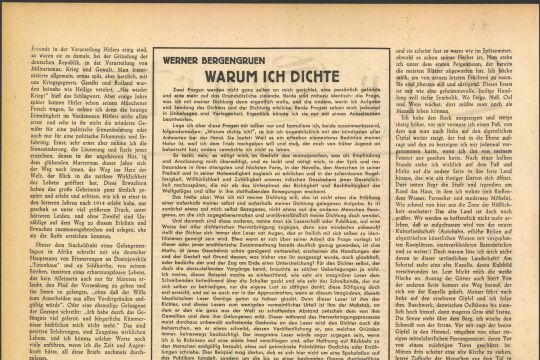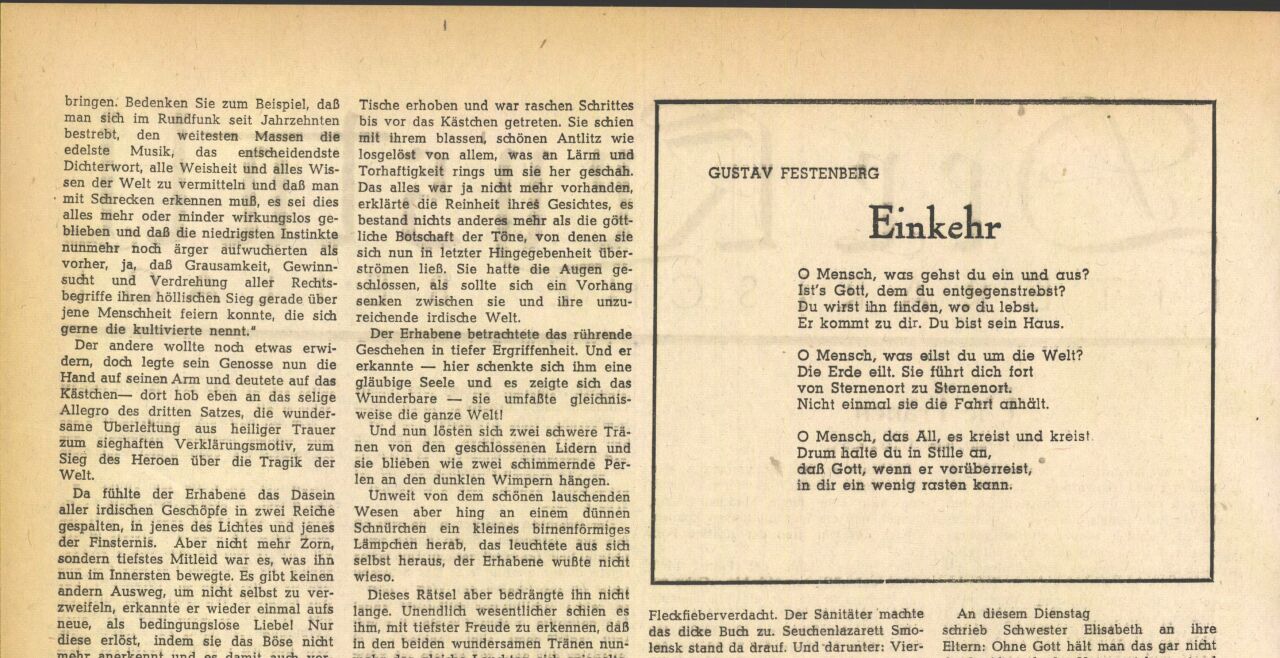
Wenn ich an die schönen, glücklichen Tage von Athen denke, fällt mir immer die Dame ein, die behauptet hat, der größte König von Frankreich sei Ludwig Philipp gewesen. Auf die etwas erstaunte Frage warum, meinte sie: „Parce-que, quand il regnait, j'avais vingt ans“ 4-denn als er regierte, war ich zwanzig Jahre alt. War es wirklich so schön in Athen, oder waren wir alle sehr jung? Als wir nach Athen kamen, waren der Erbprinz, später König Konstantin, und seine Gattin Sophie, Schwester des Kaisers Wilhelm, ein ganz junges Ehepaar, die beiden nächsten Brüder des Erbprinzen, Prinz Georg und Prinz Nikolaus, blutjunge Leutnants. Prinzessin Marie, spätere Großfürstin Michael-Michaelowitsch, war ein Backfisch, und die beiden jüngsten Söhne des Königspaares, Prinz Andreas, der jetzt der Schwiegervater der Prinzessin Elisabeth von England wäre, und Prinz Christo-phoros, noch Kinder. Der Zufall wollte es, daß zu gleicher Zeit mit uns vier junge Sekretärsmenagen zu verschiedenen Gesandtschaften ankamen, und das alles war so lebenslustig, tanzlustig und fröhlich. Die griechische Gesellschaft war ungeheuer gastfreundlich. Ich habe von meinen Kindertagen her in Konstantinopel fließend griechisch gesprochen, was auch sehr dazu beigetragen hat, daß ich mich gleich so heimisch gefühlt habe.
In dem schönen Palais Schliemann, auf dem bescheidenerweise „Iliu Melathron““, die Hütte von Ilion, geschrieben steht, gab die Witwe des berühmten Archäologen für ihre schöne Tochter Andro-mache viele Bälle und Diners. In den Räumen des Hauses, auf blauen Wänden, standen Zitate von Homer. Die Inschrift über dem Schlafzimmer lautete: „Alles zu seiner Zeit.“ Das war auch ein bißchen die Lebensführung in Athen. Während des Faschings jagte ein Fest das andere. Zum Abschluß gab der König immer ein Fest in einem Haus in der Nähe von Piräus, das Themis-tokli hieß. Das war aber auch das letzte — Faschingsende — und ein ganz anderes Leben begann. Von diesem Moment an sahen wir von den Griechen nur wenige intime Freunde und lebten ganz unter uns Diplomaten. Bei dem herrlichen Klima War das die Zeit der Spaziergänge, Ausflüge und kleinen Reisen im Lande. Tyrihs, Mykene, Olympia, Delphi, das alles, sagt man mir, kann man heute mit Autocars erreichen. Zu jener Zeit ging das meist nur mit Maultieren, und ich bedauere es nicht, denn den richtigen Zauber Griechenlands genoß und fühlte man auf diese Weise mehr. Das Maultier bewegt sich in langsam wiegenden Schritt weiter, man saß seitwärts darauf, wie die Heiligen auf alten Bildern, Heß die Gedanken schweifen. Uber uns der tiefblaue Himmel Attikas, unter den Hufen der Tiere jene graugrünen, duftenden Kräuter und Lavendel und Thymian, die das ganze Land bedecken. In weiter Ferne glänzt das Meer. Hinter dem Maultiere geht der Agojate, der Besitzer des Tieres, den Stock quer über die Schulter, die Hände an den beiden Enden, und summt ein eintöniges, sanftes Lied. Ab und zu reitet man an einem alten Brunnen vorbei, oder an irgendeiner Ruine aus der reizenden romantischen fränkischen Zeit, und manchmal unterbricht der Agojate seinen leisen Gesang und zeigt einem in der Ferne Platea, die Straße nach Theben, die schneebedeckte Kuppel des Parnaß oder sonst etwas, wovon man schon als Kind in der Schule geträumt hat.
Unser erster Streifzug in Griechenland ging durch Argolis Achaja, dem Nordabhang der arkadischen Berge. Seit Anfang unserer Reise waren wir im Wirkungskreis des großen Herkules. Schon bei der Station Nemea hatten wir die Bahn verlassen, um die Maultiere zu besteigen. Dort lebte ja weiland der Löwe, den er erwürgt hat. Den nächsten Tag krochen wir mühsam einen Felsenpfad den Stymphalossee entlang. Die stympha-lischen Vögel, die in den Löchern der Felsen hausten, ließen ununterbrochen ihr Gekreisch hören, und manchmal flogen Scharen von ihnen über unsere Köpfe. Der große Herkules ist noch heute entschieden ein sehr populärer Held. Der junge Agojate, der hinter meinem Maultier einherwandelte, wußte mir mehr Geschichten von ihm zu erzählen, als in der Weltliteratur zu lesen sind. Unweit des Ufers sahen wir Trümmer einer Wasserleitung — schon in römischer, später in fränkischer Zeit scheint der Gedanke bestanden zu haben, den See mit Athen zu verbinden —, welches Paradies könnte man da aus dem dürren Attika schaffen!
Unsere Führer waren gewöhnlich alba-nesischen Stammes, hübsche, geschmeidige Gestalten, ungemein graziös in ihren Bewegungen. Untereinander sprachen sie auch albanesisch, doch als ich einen von ihnen fragte, ob sie Albanesen seien, antwortete er sehr erbost: „Nein, nein, wir sind Hellenen.“ Der Nationalstolz der Griechen ist ungeheuer, sie hängen an ihrer glorreichen Vergangenheit, man findet kaum einen Bauer, der nicht davon zu erzählen wüßte. Der Name Homer, das Wort Ilias ist keinem fremd. Da sie heute noch ebenso eitel sind als zu Perikles' Zeiten, glaube ich eben in dieser Vergangenheit den Magnet zu sehen, der sie alle anzieht. Es ist ja so viel mehr hellenisches Blut in den heutigen Griechen, als man oft zugeben will, wie hätten sich denn sonst so viele Charaktereigenschaften und Fehler erhalten und so oft, besonders auf den Inseln, der schöne Typus. Wenn ein Grieche heute alt-griechisch zitiert, ist zwischen Altgriechisch und dem heutigen Idiom kaum mehr Unterschied, als zwischen dem Französisch Villehardouins und dem Französisch von heute.
Während ich all dies bedachte, waren wir quer durch das fruchtbare Tal gekommen und erreichten das Dorf Luka, das Endziel unserer Tagesreise. Der kleine Ort lag so versteckt unter herrlichen Platanen, daß man ihn erst erblickte, wenn man schon vor den ersten Häusern stand. Koch und Dragoman waren uns vorangegangen, um unser Nachtquartier vorzubereiten. Wie gewöhnlich waren die Bauern gleich bereit, ihre schönsten Zimmer auszuräumen und uns zur Verfügung zu stellen. Die größte Schwierigkeit lag beinahe immer daran, daß sie kein Geld dafür wollten.
Den nächsten Morgen zogen wir im Gänsemarsch einen steilen steinigen Berg hinan. Die Landschaft wurde immer schöner, immer dichter die Wälder und häufiger die kristallhellen Quellen. Als wir gegen Mittag den Sattel erreicht hatten, lag zu unseren Füßen der Phonia-see. Das Eigenschaftswort, das mir immer wieder in den Sinn kommt, wenn ich von einer griechischen Landschaft rede, ist „still“. Uber einer griechischen Landschaft liegt immer jene schöne, klassische Ruhe, jene wunderbare Harmonie der Linien, die gewiß die Künstler zur Schaffung ihrer Meisterwerke inspiriert hat. Kein Zwitschern im Walde, ich glaube, ich habe während unserer ganzen Reise außer dem Gekreisch der stymphalischen Geier, keine Vogelstimme gehört. Der See ist ganz von Bergen umgeben, der Wasserstand in dieser Jahreszeit niedrig. Zwischen dem Spiegel des Sees und den ersten Bäumen des Waldes zieht sich ein saftiger, grüner Streifen; der einzige Ton, der durch die warme Luft vibriert, ist die melancholische Stimme einer Flöte, die ein junger, brauner Hirt, im Grase liegend, bläst. Ab und zu klingen dazwischen die Glocken der weidenden Schafe. Arkadien, wie man es sich vorgestellt hatte ... Und immer dieser herrliche, berauschende Duft der vielen kleinen graugrünen Kräuter — sogar die Hasen, die man in Griechenland schießt, schmecken danach. Bei Sonnenuntergang erreichten wir das große Dorf Gura, am Südabhange des Chelmos. Vor der Kirche fanden wir die Dorfbewohner versammelt, und der Geistliche empfing uns mit vielen artigen Reden. Als wir bei Tisch saßen, kam ein Nachbar mit einer gar zu merkwürdigen Nachricht! Der Neffe des Kaisers von Osterreich sei im Dorf, beschäftige sich damit, kleine Blumen zu sammeln. Da fiel es einem Herrn unserer Gesellschaft ein, daß er von Triest nach Patras mit Professor Kaiser aus Wien gereist sei, der nach Griechenland geschickt worden war, um die Alpenflora zu studieren. Am Ende sei er diese hohe Persönlichkeit? Aufs Geratewohl schrieben wir seinen Namen auf einen Zettel und die Bitte, herüberzukommen, mit uns zu essen. Tatsächlich erschien er auch alsbald, und wir mußten viel über das Märchen vom vermeintlichen Prinzen lachen.
Es wurde das Programm des nächsten Tages besprochen, und Professor Kaiser, der seit längerer Zeit in der Gegend weilte, versicherte uns, wir könnten unmöglich schon am nächsten Tag abends das Kloster Megaspilion orreichen und würden auf dem Chelmos übernachten müssen. Wir hatten zwar keine Zelte mit, aber die Aussicht, bei einer herrlichen, warmen Nacht unter freiem Himmel zu schlafen, war nicht erschreckend.
Den nächsten Tag saßen wir alle schon um 5 Uhr früh auf unseren Maultieren. Es sollte ja der schönste Tag der ganzen Reise sein. Nach ungefähr zweistündigem Marsch hörten wir ein hastiges Rauschen und Plätschern, und bald hatten wir einen Nebenfluß des Styx erreicht. Fluß ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck für diesen rauschenden Wildbach, der inmitten der großartigsten Szenerie, zwischen riesigen Felsblöcken und dichten
Wäldern, dem Tale zurast. Die Reisebecher wurden gefüllt, das Wasser war so kalt, daß man es nur schluckweise trinken konnte, und von wunderbarer Klarheit. Nun gingen wir zu Fuß weiter, der Pfad zog sich bald rechts, bald links vom Styx zwischen den Felsen, und oft hörte er ganz auf, und wir mußten im Bett des Gießbachs von Stein zu Stein hüpfen. Als der Steg endlich etwas weniger unbequem wurde, konnten wir die großartige Landschaft bewundern, die uns umgab. Das Tal war eher breit, im Halbkreis von hohen Bergen umgeben, am Rande der Berge und an beiden Seiten des Gießbaches wilde Felsen, die aussahen, als hätte der große Zeus seine Blitze hineingeschleudert. Weit vor uns, wie durch einen dünnen Nebelschleier, sahen wir eine besonders hohe, glatte Felswand, an der zwei glänzende weiße Streifen herunterströmten, die Styxfälle. Das also war der Wohnsitz der großen Göttin, der Tochter des Okeanas und der Thesis, der Mutter der Persephone. über ihren Palast wölbte sich der tiefblaue Himmel Hellas. Von der Glut der Sonne hatte der Stein stellenweise jene herrliche Bronzefarbe angenommen, die an der Südseite der Akropolis zu sehen ist, und überall, wo Erde lag, wucherten Büsche und Blumen, kleine Pinien, mit ihren gewundenen Stämmen, Kaktus, Aloe und hie und da blühender, roter Oleander.
Beim Dorfe Kastanica machten wir Mittagsstation, und mit traurigem Gesicht und gesenktem Haupt meldete der Dragoman, auf den schlüpfrigen Steinen des Styx wäre ein Maultier ausgeglitten, gerade das, welches die Getränke trug, und von allem edlen Naß, das uns laben sollte, war nur eine Flasche Kognak gerettet worden. Nun wurde bei den Wassern des Styx manche ganz unparlamentarische Verwünschung laut, aber es half nichts, und mit großer Philosophie beschlossen wir, Styxwasser mit Kognak sei eigentlich ein sehr hygienisches Getränk.
Nachmittag begann der Aufstieg, die Nichtschwindelfreien hatten böse Stunden. Immer mehr schneebedeckte Kuppen tauchten um uns auf, es wurde kalt, keine Bäume, keine Sträucher waren mehr zu sehen, auf einem großen kahlen Plateau, auf dessen Mitte eine verwitterte Eiche stand, machten wir halt. Wir stiegen auf eine kleine Anhöhe hinauf und sahen ein herrliches Bild. Die Sonne sank langsam ins Meer, und im goldigen Schimmer lag der ganze Peloponnes wie ein großes Feigenblatt auf den blauen Wellen.
Der Morgen auf dem Chelmos war wunderbar schön. Als die Sonne langsam über die weißen Bergspitzen kroch, sah alles so frisch und jung und strahlend aus, als wäre es eben aus des Schöpfers Hand geglitten. Wir konnten uns schwer entschließen, uns von diesem schönen Anblick zu trennen, und da wir bis zum Kloster Megaspilion nur einen kurzen Tagesmarsch vor uns hatten, wurde mit Toilette und Frühstück lange getändelt.
Der Weg vom Chelmos hinunter zum Kloster Megaspilion war unsagbar schön. Das Kloster soll 180 Mönche, wahrscheinlich Novizen mitgerechnet, beherbergen. Der Name Mega Spilion, große Höhle, kommt daher, daß ein Teil des Klosters in eine Grotte eingebaut ist. Im übrigen baut sich jeder junge Mönch, wenn gerade kein Häuschen frei ist, sein eigenes Heim. Wie die Schwalbennester kleben sie am Abhang des Berges um das Kloster herum, mit ihren kleinen, überhängenden hölzernen Balkons.
Der Abt empfing uns sehr liebenswürdig, wie üblich gab es auch bald Kaffee und Rosenkonfitüre. Von letzterer habe ich auf der ganzen Reise unendlich viel vertilgen müssen, man wird immer und überall damit bewirtet, und keiner der Herren unserer Karawane wollte Gefallen daran finden. Ich mußte die Situation retten, damit die liebenswürdigen Wirte nicht beleidigt seien, und tat es sehr gern.
Den nächsten Tag ging's hinunter ins Tal, um uns herum üppige Vegetation, viel blühender blutroter.Oleander. Gegen Mittag erreichten wir den schönen, kleinen Myrtenhain im Lande Elis, aber leider auch Kalabrita, die Bahnstation, von der uns der Zug nach Athen zurückführen sollte. Nun war es zu Ende mit den Tagen, in denen man in Schönheit schwelgen konnte.