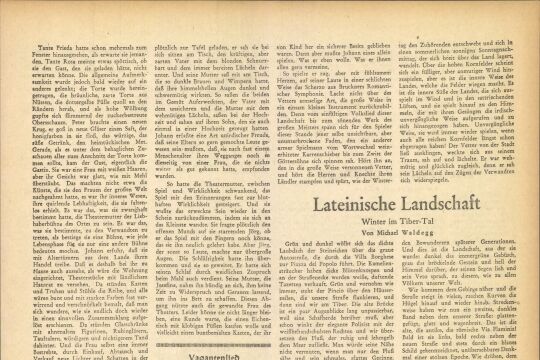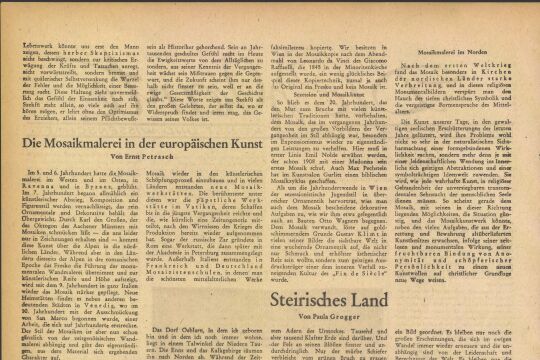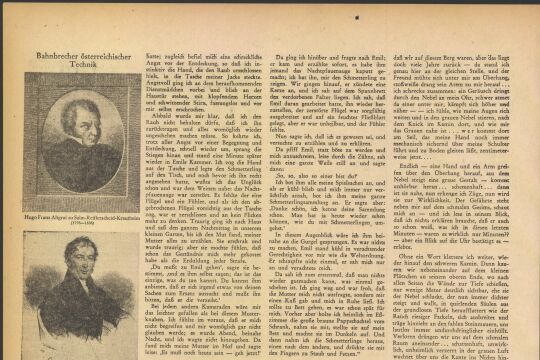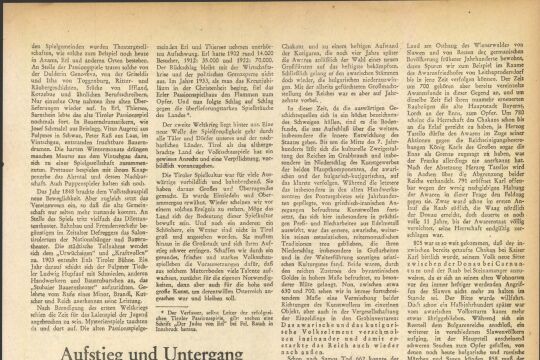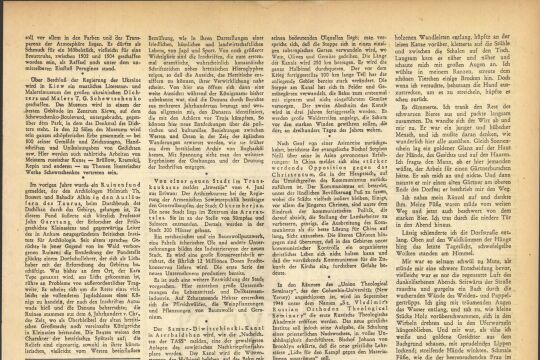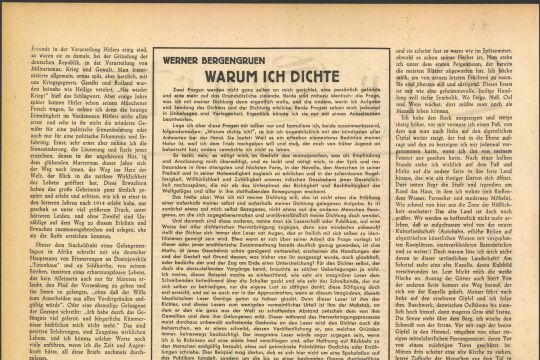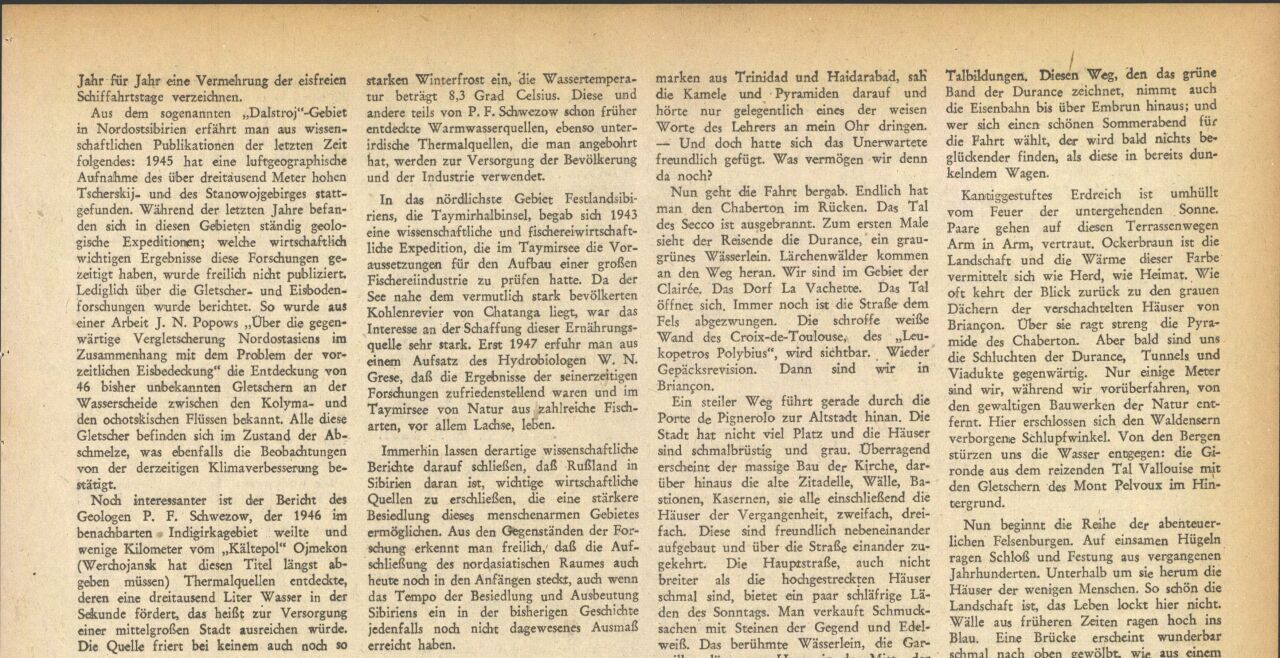
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auf der Hannibalstraße
Straßen haben ihre Geschichte, manche ihre Weltgeschichte. Kein anderer als der Weg über den Mont Genevre erschien mir von Norditalien aus der nächste, zu meinem eigentlichen Ziel nach Arles und an die Rhonemündung zu gelangen. Daß ich die Mont-Cenis-Bahn bei Oulx verlassen mußte und mir eine Wanderschaft auf der Landstraße winkte, war mir gerade willkommen. Am Zusammenfluß der Waldbäche von BardonJche liegt dieser kleine Ort Oulx. Getreidefelder reifen spät ringsum in tausend Meter Höhe.
Langsam geht es aufwärts in vielen Windungen, an ragenden Felswänden und Bergwiesen, an Roggen- und Haferfeldern vorbei. Alle Gipfel der nahen Bergwelt überglänzt der Chaberton, kühn zur Feste ausgenützt. Schroff und unbezwinglich erscheint diese Felsenbastion. Das nächste Dorf an der Straße ist Cesana.
Schön ist es, am nächsten Morgen auf den nahen Hügel zu steigen und Cesana vor sich im Tal zu haben. Die Morgensonne glänzt über den Dächern. Am nächsten winkt mir der Kirchturm einer dieser urtümlichen Gotteshäuser auf dem Lande. In ihm selbst — einem einschiffigen, schmucklosen Bau — halten die plastischen Heiligen die hier frühen Herbstzeitlosen in Händen. Weiterhin gehen Straßen ins Gebirge. Auf einer dieser eilt unser Blick voraus zur Paßhöhe des Mont Genevre.
Das italienische Auto fährt auf der Straße nach Frankreich bis Clavicres an reichbewaldeten Felshängen entlang. Oft sind in den Abhang des Chaberton Tunnels geschlagen oder der Weg ist tief eingeschnitten, um die Straße weiterführen zu können. Drei Kilometer vor der Höhe liegt Clavicres. Herrlich klare und dünne Gebirgsluft, fünf, sechs Gehöfte, Post und Kirche, eine vollbesetzte Schenke, Paßkontrolle und Gepäcksrevision. Das Auto wird gewechselt. Wir sind auf französischem Boden.
Das kleine Dorf Genevre, ebenso unscheinbar, grüßt uns freundlich in 1854 Meter Höhe. Ein Obelisk verkündet, daß Napoleon im Jahre 1802 diese Straße anzulegen begonnen hatte an Stelle der alten, die im Laufe der Jahrhuriderte vom Geröll zerstört worden war. Die Häuser hier, tüchtige. Landhäuser, stehen fest und haben Gewalt. Sie leben fast in einer Wüste. Nur ein paar ärmliche Hausgärten und wenige kleine Äcker zaubern hier noch etwas belebte Natur.
Während ich in dieser kargen Welt sinnend stehe, überkommt es mich wie Erleuchtung. Die Dora Riparia hat mich nur zufällig an die Schule erinnert, aber das Wort „Mont Genevre” weckt mit Gewalt Ahnungen und Erinnerungen in meinen Träumen. Ganz klar ist es mir mit einem Male; ein alter Schullehrer, Regierungsrat Josef Fuchs, hat uns in der Sexta des Wiener-Neustädter Gymnasiums von seinem Lebenswerk erzählt, der Erforschung des Übergangs Hannibals über die Alpen. Die Vorzugsschüler erhielten damals sein Werk über die von ihm in den Jahren 189596 gemachten Studien. Was ging mich damals diese Broschüre an? Ich gehörte keineswegs zu den Vorzugsschülern. Ich hatte genug mit Livius und Homer, wo blieb mir da noch Zeit für Privatlektüre? Gerade, daß mir diese eigene Art der Belobung wenige Minuten nahegegangen war, aber dieser Bruchteil von Zeit mußte genügt haben, um mir die geisterhaften. Zusammenhänge von damals mit dem Heutigen zu erhellen. Es war mir plötzlich deutlich geworden, ich befand mich auf der Hannibalstraße. Diesen Weg, den ich aus reiner Überlegung heraus gewählt hatte, mußte Hanni- bal ohne die Vorteile unserer heutigen Verkehrs- und Orientierungstechnik als den vorteilhaftesten, weil niedrigsten und gleichmäßig ansteigenden Alpenweg erkannt haben. Freilich bedurfte, wie erwähnt, diese Festlegung des Alpenüberganges Hannibals durch die Wissenschaft erst eines lang dauernden Meinungsstreites unter den Gelehrten. Ich stand also auf dieser kleinen Hochfläche, auf der, wenn wir uns nicht alle irren, Hannibal mit seinen zwanzigtausend Mann, seinen Numidern und sechstausend Pferden kampierte, nicht zu vergessen die Elefanten, die zum besondern Schrecken des Feindes dienen sollten. Im Oktober des Jahres 218 v. Chr. lag tiefer Schnee und der Sturm wütete grausam. Am neunten Tage hatte das Heer die Höhe erreicht. Fünfzehn Tage brauchte es zum vollständigen Übergang.
Dies alles weiß ich aus der nachträglichen Lektüre der Broschüre meines Lehrers. Sie war das letzte Exemplar, das er noch besaß, und hatte bereits arg gelitten. Der 75jährige, altersschwache, blindgewordene Greis hat sie mir zitternd vor Freude und Rührung nach meiner Rückkehr in die Hand gegeben, und als mir möglich geworden war, in der Öffentlichkeit auf die frühe Entdeckung des Gelehrten hinzuweisen — es geschah wenige Monate vor seinem Tode —, empfing er diese Ehrung als eine der glücklichsten Stunden des Lebens Ja“, sagte er, „wenn ich noch einmal Schullehrer werden könnte, dann würde ich auch die schwachen und unauffälligen Schüler mit Belobungen auszeichnen. Man kann nie wissen! Sie waren einer meiner verstecktesten.“
Daß mir diese Straße, die der junge Lehramtskandidat Fuchs vor vierzig Jahren ausgiebig mit dem Zweirad bereist hat, in einer solchen Weise bedeutsam sein würde, hatte ich freilich als stumpfer Schüler nie geahnt. Warum haben auch die Geschichtsschreiber Hannibals, Livius und Polybius, nicht vorausgedacht und die Gegend genauer mit Namen bezeichnet? So dachte ich damals sorglos und liebäugelte mit meinen in der Pause eingetauschten Briefmarken aus Trinidad und Haidarabad, sah die Kamele und Pyramiden darauf und hörte nur gelegentlich eines der weisen Worte des Lehrers an mein Ohr dringen. — Und doch hatte sich das Unerwartete freundlich gefügt. Was vermögen wir denn da noch?
Nun geht die Fahrt bergab. Endlich hat man den Chaberton im Rücken. Das Tal des Secco ist ausgebrannt. Zum ersten Male sieht der Reisende die Durance, ein graugrünes Wässerlein. Lärchenwälder kommen an den Weg heran. Wir sind im Gebiet der Clairce. Das Dorf La Vachette. Das Tal öffnet sich. Immer noch ist die Straße dem Fels abgezwungen. Die schroffe weiße Wand des Croix-de-Toulouse, des „Leu- kopetros Polybius“, wird sichtbar. Wieder Gepäcksrevision. Dann sind wir in Brianfon.
Ein steiler Weg führt gerade durch die Porte de Pignerolo zur Altstadt hinan. Die Stadt hat nicht viel Platz und die Häuser sind schmalbrüstig und grau. Überragend erscheint der massige Bau der Kirche, darüber hinaus die alte Zitadelle, Wälle, Bastionen, Kasernen, sie alle einschließend die Häuser der Vergangenheit, zweifach, dreifach. Diese sind freundlich nebeneinander aufgebaut und über die Straße einander zugekehrt. Die Hauptstraße, auch nicht breiter als die hochgestreckten Häuser schmal sind, bietet ein paar schläfrige Läden des Sonntags. Man verkauft Schmucksachen mit Steinen der Gegend und Edelweiß. Das berühmte Wässerlein, die Gar- guille, längst zu Hause in der Mitte der Straße, durchmurmelt die Stadt und weckt niemand mehr auf. Die Glocken des Domes läuten und ein Zug von Gläubigen wandert zur Andacht.
Noch in dieser Stunde lockt es mich weiter in die Landschaft der obern Durance. Bergab geht es wieder, immer mit der Durance, wie ihr verschworen. Die meisten locken die Berge rechts und links. Nicht zu selten sieht man den mächtig ausgerüsteten Bergsteiger von hier den Firnen zustreben. Aber die Romantik dieses Tals kennen nicht viele. Wem sie offen ist, der hat genug an dem Anblick dieser hohen Gesteinsmassen, der grausig canonartigen Talbildungen. Diesen Weg, den das grüne Band der Durance zeichnet, nimmt auch die Eisenbahn bis über Embrun hinaus; und wer sich einen schönen Sommerabend für die Fahrt wählt, der wird bald nichts beglückender finden, als diese in bereits dunkelndem Wagen.
Kantiggestuftes Erdreich ist umhüllt vom Feuer der untergehenden Sonne. Paare gehen auf diesen Terrassenwegen Arm in Arm, vertraut. Ockerbraun ist die Landschaft und die Wärme dieser Farbe vermittelt sich wie Herd, wie Heimat. Wie oft kehrt der Blick zurück zu den grauen Dächern der verschachtelten Häuser von Brianjon. Über sie ragt streng die Pyramide des Chaberton. Aber bald sind uns die Schluchten der Durance, Tunnels und Viadukte gegenwärtig. Nur einige Meter sind wir, während wir vorüberfahren, von den gewaltigen Bauwerken der Natur entfernt. Hier erschlossen sich den Waldensern verborgene Schlupfwinkel. Von den Bergen stürzen uns die Wasser entgegen: die Gironde aus dem reizenden Tal Vallouise mit den Gletschern des Mont Pelvoux im Hintergrund.
Nun beginnt die Reihe der abenteuerlichen Felsenburgen. Auf einsamen Hügeln ragen Schloß und Festung aus vergangenen Jahrhunderten. Unterhalb um sie herum die Häuser der wenigen Menschen. So schön die Landschaft ist, das Leben lockt hier nicht. Wälle aus früheren Zeiten ragen hoch ins Blau. Eine Brücke erscheint wunderbar schmal nach oben gewölbt, wie aus einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht.
Ein Wind hebt sich vor den Fenstern. Fledermäuse schwirren durch das Dämmer. Immer grausiger wird die Fahrt. Wir scheinen aus den Schluchten nicht herauszukommen. Immer kleiner wird das Fleckchen Himmel. Fels, Fels, spärlicher Baumwuchs. Dann endlich wieder ein Nadelwald. Aber fast gespenstisch über der schwarzbraunen Erde. Eine Weile scheint es, als ob ein Männ zu Pferde, von ungeheuren Ausmaßen, eine einzige Spukgestalt, neben uns herzöge. — Um halb zehn Uhr abends erreichen wir Gap, die Hauptstadt des südöstlichen Departements.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!