
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
MENSCHEN AM MONTMARTRE
Auf der Place du Tertre werden die Lichter in den gußeisernen Kandelabern angezündet, ich sage angezündet, wie in alten Zeiten, als die Place du Tertre noch der Marktplatz des Dorfes Montmartre war. Die Szenerie ist erhellt, und aus den Kneipen von Toulouse-Lautrec, van Gogh, Renoir und Picasso riecht es nach Pommes frites, Steaks, Wein, und wenn man es versteht, Erlebnisse zu riechen, spürt man den Qualm aller Tabake, den Duft aller Parfüms, vermischt mit dem ewigen Verlangen der Menschen, den Augenblick ganz zu erfassen.
Ich setze mich vor eines der kleinen Restaurants, blau-grün kariert das Tischtuch, und sehe zu, wie sie an mir vorüberziehen auf dem buckligen Pflaster des Montmartre, langsam, jeder in seiner Welt, mit seinem Gesicht, seiner Hautfarbe, seiner Sprache, jeder ein greifbares Bild seiner Person, und alle dennoch ungreifbar aufgeteilt an Zusammenhänge und Zeiträume, die wir nicht mehr ergründen.
Ein Neger in langhaarigem Pullover schreitet durch den Trubel, groß, die Augen weit zum Nachthimmel geöffnet; in ihrem Weiß schwimmt die dunkle Erde, unser aller Erde, mit ihrer geheimen, uns nie verlassenden Trauer.
Die Maler haben längst ihre Sonnenschirme zusammengeklappt, lehnen ihre Bilder an die nächste Mauer, an einen Laternenpfahl, setzen sich daneben auf einen Hocker, auf Steinstufen, oder lassen ihre Bilder allein, um etwas zu essen, zu trinken, oder nur um von den Stufen des Sacre-Cceur auf Paris zu sehen und sich die Augen zu füllen mit einem Glanz, der den Körper ertrinken und den Geist wandern läßt.
Und immer treiben neue Menschen vorbei: Weiße, Gelbe. Schwarze, eine Inderin im Sari mit dem Kastenzeichen auf der Stirn, ein Rabbiner, ein in sich verlorenes Paar, Studenten aus aller Welt, eine Uralte mit langen grauen Haarsträhnen und einem Stangenbrot in der Hand.
In mein Weinglas ist ein Akazienblatt gefallen; ich nehme es mit der Zunge heraus und vermenge die leichte Kühle des Herbstes mit der Wärme des Weines in meinem Mund. Und ich spüre die Rundung des Glases und die Weite der Nacht, und ich bin in ihr, und all diese Menschen sind wirklich. Von ihren Gesichtern tropfen die Sekunden, die Minuten, tropft die Zeit...
Einer sitzt in der Nähe unbeweglich, schon lange, und die fallenden Sekunden füllen sein leeres Glas.
Am Tisch neben mir läßt ein junger Mann seinen Arm über die rechte Schulter eines Mädchens hängen. Sie hält diesen Arm mit beiden Händen so umfangen, als läge sie in der Umarmung eines Engels, der jegliches Los zu wenden verstünde. Das Gesicht dieses Engels ist häßlich, doch seine Ohren sind wunderschön und so gebildet, als könnten sie das Stumme vernehmen. An der Wand lehnt einer der Maler, die Haare in die Stirn gekämmt, der Rollkragen reicht bis zum Kinn. Er zeigt, daß er hierher gehört. Er raucht, und bei jedem Zug schließt er die Augen und entblößt sein Gesicht. Es ist heimatlos.
Es wild kühler. Ich stehe auf und schlendere weiter. Im Vorübergehen sehe ich einen geöffneten Sonnenschirm, den einzigen in dieser herbstlichen Nacht. Ich höre reden, laut, leidenschaftlich, doch niemand bleibt stehen. Ich gehe ein paar Schritte zurück; unter dem Sonnenschirm lehnt ein Bild auf einer Staffelei, ein Mann steht davor mit dunkelblauer Baskenmütze und weißen Haaren. Er spricht, während seine Hände wie Zaubertiere mitarbeiten, zu einem imaginären Publikum. Ich kann nur immer wiederkehrende Worte verstehen: merveilleux . .. le monde ... Fceuvre ... le diable ... jamais .. . Seine Rede steigert sich zu . höchster Dramatik, doch das Gesicht bleibt dabei leer. Es scheint mir, als hätte sein Geist das Ewige schon betreten und nur die Hände und die Stimme wären noch mit der Qual und der Unruhe des menschlichen Daseins beladen.
Studenten kommen lachend in einer Reihe über die ganze Straße. Sie rufen mir zu und schieben mich weiter. Einer hält eine schwarze Angorakatze auf dem Arm, die mich kalt und hochmütig ansieht. Eine Leine hängt an ihrem Hals. Ich weiche auf eine jener steilen Stiegen aus, die vom Montmartre hinunterführen. Weit drunten sieht man eine schmale Gasse, hohe, enggepreßte Häuser, windschiefe Fensterläden. Am eisernen Treppengeländer lümmeln einige junge Burschen mit ihren Mädchen. Sie tragen Pullover, die ihnen zu groß sind; manche sehen wie Panzerhemden aus. Sie geben sich überlegen, ein wenig sachlich, ein wenig verrucht und schließlich doch verliebt. Und alle sprechen durcheinander.
Da höre ich plötzlich hinter mir singen. Eine Frau kommt langsam die Stufen herunter und bleibt unter der nächsten Laterne stehen. Das Licht fällt auf ihre Haare, sie ist alt und ihre Stimme nicht mehr schön. Doch alle verstummen. Denn sie ist eine Erscheinung, die, solange sie lebt, zum Montmartre gehört. Nacht für Nacht auftaucht, denselben Weg wandert, eine fast schmerzliche Inbrunst ausstrahlend. Sie ist in ihren jungen Jahren ein Modell von Matisse gewesen. Nun geht sie singend die Stufen hinunter, durch die dunkle Gasse und verschwindet. Ihr Gesang bleibt in meinem Ohr...
Ich schaue von den Stufen des Sacre-Cceur noch einmal auf die Seine Ein silberner Dunst steigt aus den zerfransten Lichtsäulen im Wasser, der erste herbstliche Nebel. Er treibt durch die steinernen Brückenbogen, hebt sich über Notre-Dame, durchfließt den Eiffelturm und senkt sich auf den Bois de Boulogne. Vielleicht empfängt ihn dort fröstelnd ein alter Clochard, der unter einer Zeitung schläft! Und im Traum kämpft er noch einmal um sein höchstes Gut: um seine Freiheit.
Die Lichter der Stadt unter mir verlieren im Nebel ihre Beziehung zu Straßen und Plätzen, sie schwimmen verwischt über den Bildern der Erinnerung ...
Im Cafe de la Paix wird man noch im Freien sitzen, den Autos nachsehen, die rote Fäden hinter sich herziehen, warten, ob noch jemand aus der Oper kommt, einander betrachten; im Quartier Latin am Boul „Mich“ sitzen Studenten stundenlang bei einer Tasse schwarzen Kaffees, in den Aschenbechern türmt sich die Erregung ihrer Gespräche, in Saint Germain des Pres wird getanzt bis zur Erschöpfung, kaum getrunken, kaum geredet; durch die langen Gänge des Louvre geht ein Nachtwachtet, und hinter ihm versinken die Madonnen von Lionardo und die Olympia von Manet wieder in Dunkelheit und Stille, und der Engel auf dem Dach der Sainte-Chapelle halt wie vor hundert Jahren sein Kreuz in die Nacht...
In meinen Ohren ist immer noch das Lied. Und bald weiß ich nicht mehr: habe ich es soeben gehört, oder ist es immer hier, über Paris, über der Welt, über wachsenden und zerfallenden Türmen, im Geräusch von Motoren, in Litaneien, dem Tamtam der Savannen und dem Liebesruf eines Jünglings, der die Reise erst antritt?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


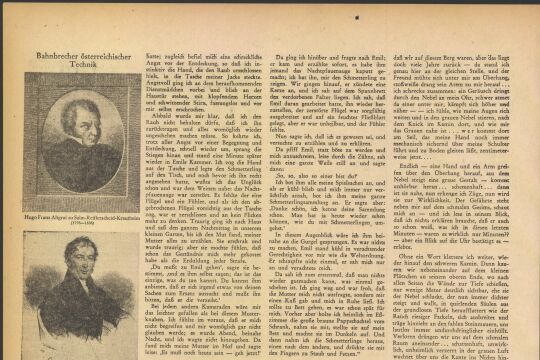




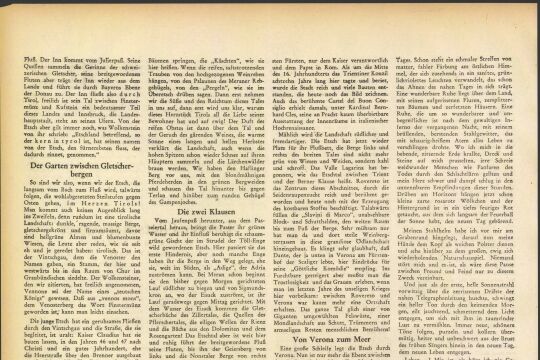
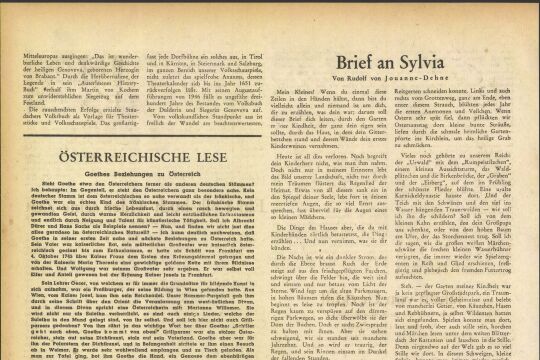
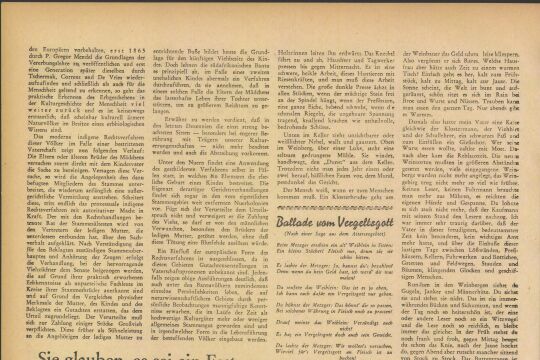





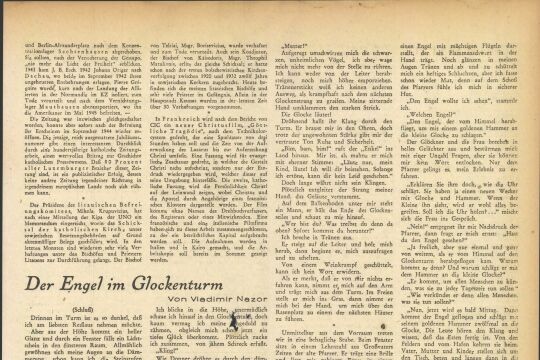
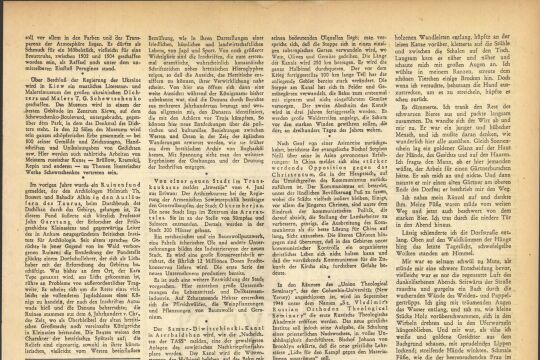









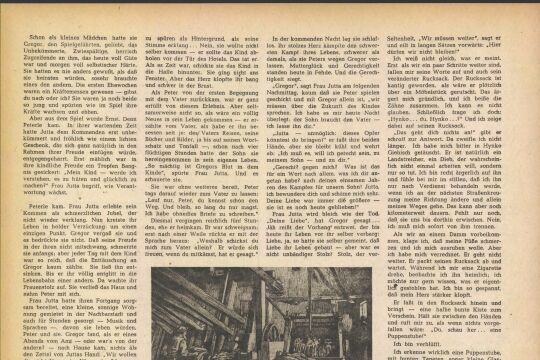

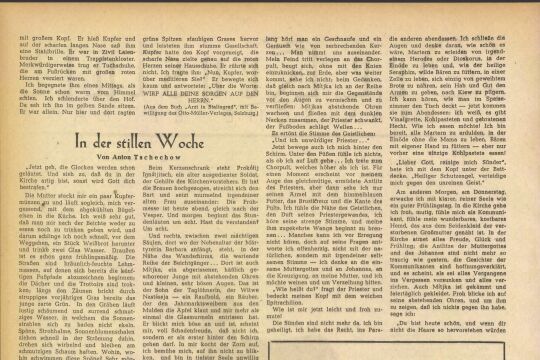








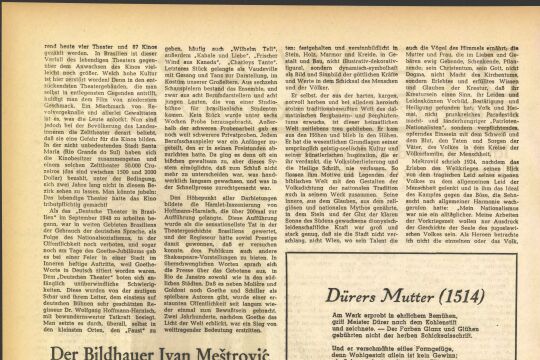



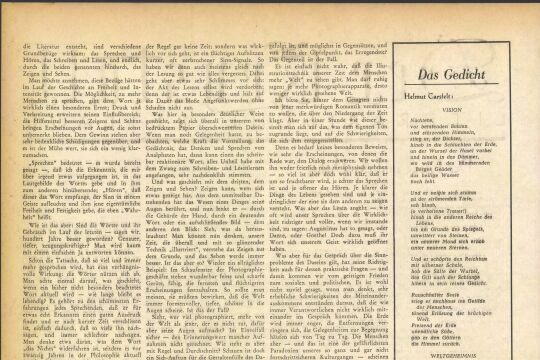











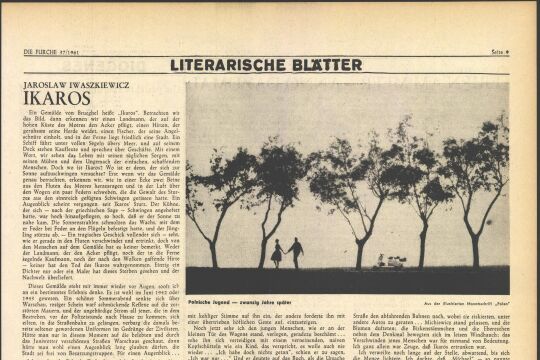

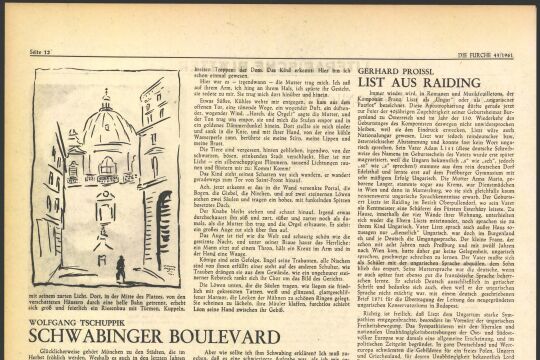






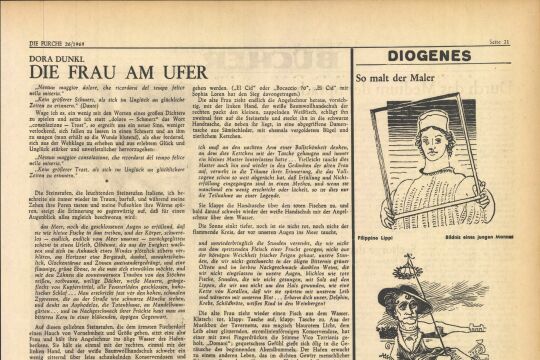


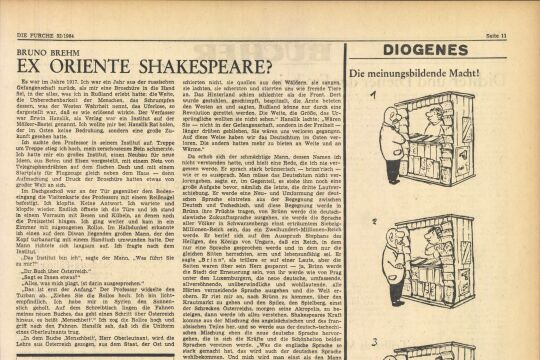


































.jpg)