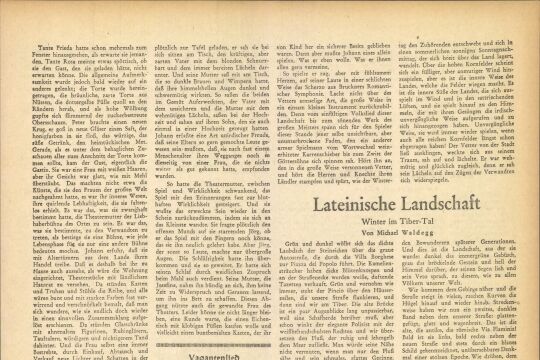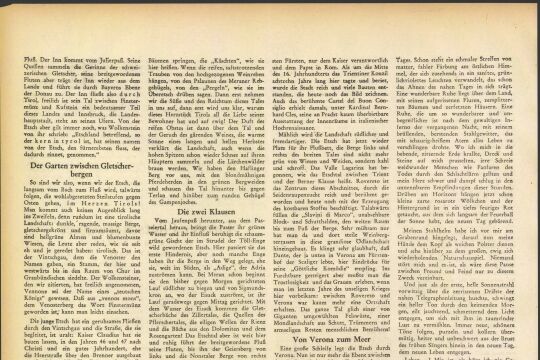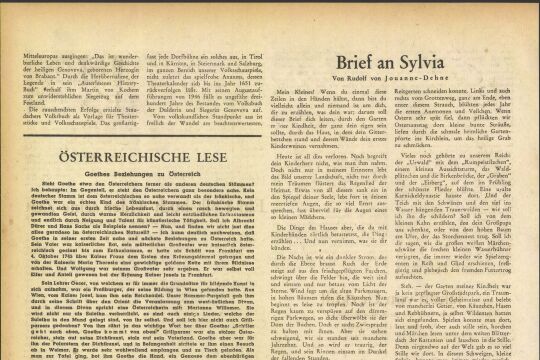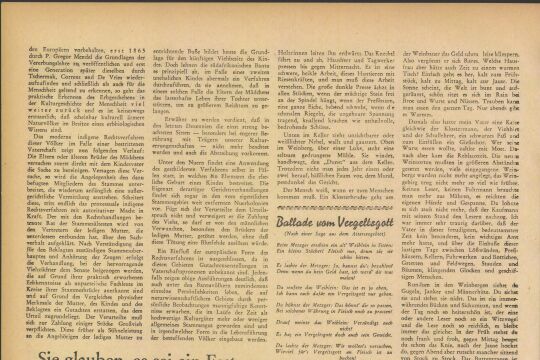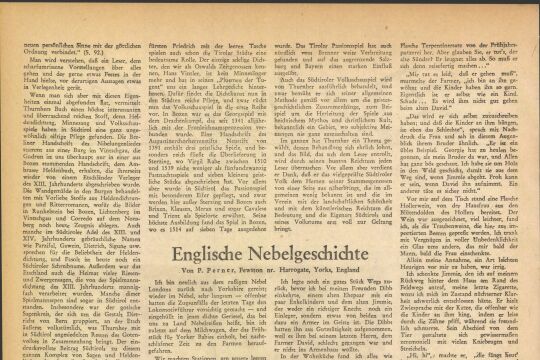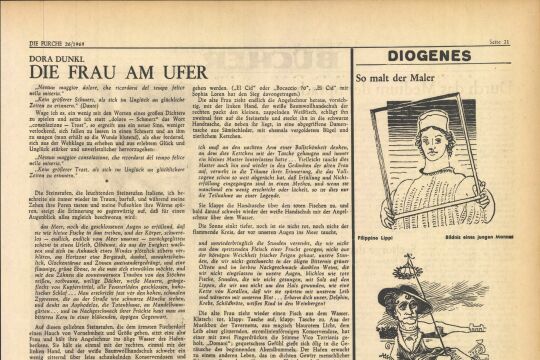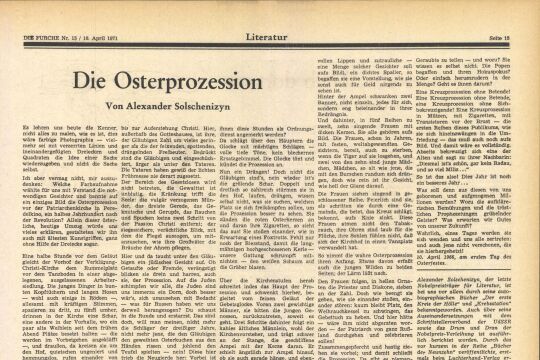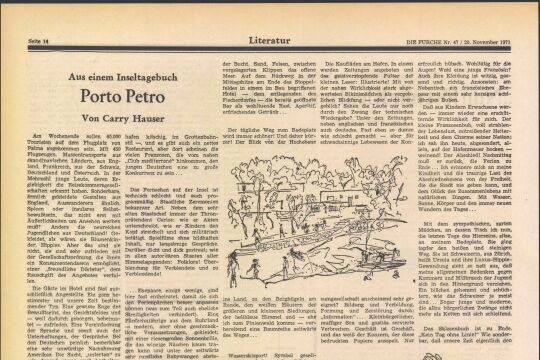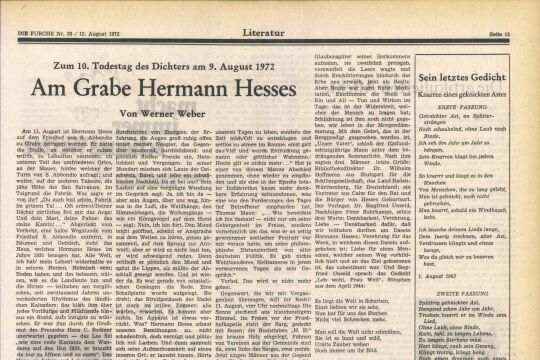Am schönsten ist der Wienerwald dort, wo er aufhört (sprach ein etwa zweiundvierzigjähriger Herr, dessen Magen über dem Gürtel sachte hervorquoll, beruhigend, nicht allzu gewaltig, aber immerhin präsent, der Magen eines Mannes, der für mancherlei kosmische Einsichten die Hoffnung, jemals Mister Universum zu werden, endgültig aufgegeben hat), am schönsten also ist der Wienerwald dort, wo er aufhört, und zwar nicht, weil er aufhört, sondern wegen der Art, wie er aufhört, nämlich, und das ist wesentlich: nicht abrupt!
Das Aufhören eines Waldes . ist (sprach er weiter), für mich wenigstens, immer etwas Erfreuliches, denn zu lange hat man mich in meiner Kindheit mit moosbärtigen Waldgeistern, im Unterholz lauernden felsenfarbenen Gespenstern und unheimlichen goldhaarigen Quellnymphen geplagt, zudem ist meine Heimat nicht die Natur, sondern die Unnatur, also die Stadt, dieses wenn auch organisch gewachsene, aber dennoch durch und durch gekünstelte Gebilde aus Stein und Asphalt und aus Gips, der so aussieht, als wäre er Stein.
Vor den ins Grüne dringenden Keilen des mir vertrauten Stadtgebietes zieht sich der Wienerwald äußerst diskret zurück, zaghaft, zerstreut; der fundamentale Gegensatz zwischen Ordnung und Üppigkeit, zwischen Härte und Weichheit, zwischen gekünstelt und natürlich scheint hier aufgelöst, und ein nicht zu formulierendes Gefühl lichter Balance um-.fängt und durchdringt den Besucher.
Hier, in diesem einzigen großen Park, stehen, vereinzelt, zuweilen auch am Rand eines Weingartens, schattige Villen, deren Erbauer noch an die Ewigkeit glaubten, wie die Schloßherren früherer Zeiten, wenn auch bereits etwas verschämt - denn mit der Straßenbahn war die Aufklärung und mit ihr das Zweifeln in diesen am Stadtrand langgestreckt liegenden Streifen schönen Vegetierens eingebrochen; hier wachsen aus dem Boden die dörflichen Häuser der Weinhauer, im Geiste einer ehrbaren Kleinbürgerlichkeit schlicht und gipsern verziert; hier befinden sich, am Ende mancher Gärten, jene seltsamen Bauten, Salettln genannt, in denen sich leicht angeheiterte Gesellschaften geborgen fühlen können, isoliert von einer von Gemeinheiten strotzenden Welt, sich selbst überlassen, schwebend zwischen harmloser Blödelei und tiefster Einsicht.
Dieser einzigartige Garten, in dem die Villen und die Häuser der Weinhauer und die Salettln stehen, ist wochentags und besonders vormittags still, voll von Spinnweben; Katzen sonnen sich vor dem hellen Gemäuer im gleißenden Licht; alte Weiblein zeichnen mit Reisbesen zittrige Bogen in den Sand des Gartenweges; behäbige Männer begeben sich in den Keller, das träge Gären oder die grünliche Klarheit des Weines zu überwachen; von der Fäulnis frühzeitig befallene grüne Nüsse klatschen mitunter auf Dächern auf; leise, beinahe flüsternd reden die wenigen Touristen, andächtig, obwohl sie den Grund ihrer seltsamen Ehrfurcht angesichts dieser einfachsten Bauten und Bepflanzungen nicht begreifen -so irgendwie verstreicht hier der Tag, beinahe endlos, in großen lockeren Stunden.
Wenn es dann soweit ist, wenn die gegen Nordosten offene Hügellandschaft, nur noch von waagrechten Strahlen beleuchtet, in einer ersten Ahnung von Dunkelheit zu versinken beginnt, wenn die Grenzlinien der Schatten zerfließen und die Hitze des Tages das Aufsteigen der süßen Ausdünstung der Weingärten nicht mehr behindert, wenn es also auf den Abend zugeht, dann wandern die Wiener herbei, pilgern zu Fuß, mit verheißungsvoll duftenden Freßpaketen beladen, strömen aus den Wagen der Straßenbahn, deren rote Farbe hier an das Rot mancher vom Wein erhitzter Gesichter erinnert, fahren mit Autos vor, suchen, nervös noch, Parkplätze, in Gedanken bereits mit der Heimfahrt beschäftigt, mit dem für ansonsten ziemlich anständige Leute einzigartigen Abenteuer, betrunken und dennoch ohne größeres Blutvergießen, die Polizei überlistend, durch die Straßen zu fahren.
Die Vernünftigeren verzichten dann ohnehin auf das Wagnis, nehmen ein Taxi und holen ihr verlassenes Fahrzeug erst am nächsten Tag, entdecken erstaunt, daß ihr Auto in einer Dorfstraße steht, unter Holunder, verlassen, mit brennenden Lichtern. Der aus Reisen gewundene Kranz des Heurigenlokals pendelt im leichten Wind, der Rausch ist verraucht, und die Kellnerin Mitzi, die noch vor ein paar Stunden, das Tablett balancierend, wie eine gütige, wenn auch bereits ein wenig sulzig schwabbelnde Bacchantin zwischen den Tischen schwebte, lugt aus dem kleinen Fenster hervor und ist - bei Tageslicht - bloß dick und neugierig und sonst nichts.
Was sich nun aber am Abend und nächtlich in jenen Gärten der Heurigen abspielt, ist für den Wiener halb Wirklichkeit und halb Theater, in dem die mehrstündige vergnügliche Szene „Der Wiener beim Heurigen" gegeben wird, putzig oder düster, in Begleitung vertieftesten Händchenhaltens oder den Körperteilen des . mitgebrachten kalten Brathuhnes völlig hingegeben, eine Szene, in der die Münder fortwährend beschäftigt sind, mit essen, mit küssen, mit singen und zwischendurch auch mit reden.
Beim Heurigen spielen die Wiener Wiener, so heftig, daß den Ausländern, die da in Horden hereingetrieben, mit einem Viertel Wein bewirtet, von den Heurigensängern in Musik getaucht und dann wieder in ihre Autobusse verfrachtet und weitergeführt werden - Vienna by night, isn't it lovely? -, gar nichts anders übrig bleibt, als sich schleunigst dem von den Wienern - made in Vienna - produzierten Wienerischen anzupassen und, wenn auch sehr oberflächlich, so doch einiges vom Wesentlichen aufzuschnappen, das sich in solchen Nächten zu erkennen gibt, verschachtelt und mittelbar, durch schwer entzifferbare Schnörkel des Benehmens.
Der Wiener, wie er beim Heurigen vom Wiener gespielt wird, schätzt die Natürlichkeit mehr als die Natur; die Gemütlichkeit ist ihm wichtiger als das Gemüt; vor seinen Sorgen flieht er ins Flüchtige - ins scheinbar Flüchtige, wie er zu glauben vorgibt -, und gerne verzichtet er aufs Glück, wenn er nur ein wenig glücklich sein kann.
Am glücklichsten ist dieser von Wienern gespielte Wiener, wenn es ihm erlaubt ist, bei Musikbegleitung ein ganz wenig zu weinen, so wie es vor gut hundert Jahren vom Gruber-Franzi, genannt das „picksüße Hölzl", vorgesehen war: weinen über die Vergänglichkeit, die in Wien freilich eine viel vergänglichere Vergänglichkeit ist als anderswo, weinen
über die eigene, nach Alkohol duftende Leiche, deren Weingeruch, ach, an müden Suff erinnert, an leicht ausgesprochene Schwüre, die man ebenso leicht gebrochen hat, ans neuerliche Händchenhalten, an die Berührungen der Knie unter den Tischen, an die Hoffnung, das Leben würde sich radikal ändern, ohne sich wirklich zu ändern, an glückselig unsichere Schritte, an eine grün angestrichene Tür, auf der „Herren" steht, an die Erleichterungen der Seele.
Weinen über das eigene Unvermögen, über etwas wirklich weinen zu können, weinen darüber, daß das Leben nicht, wie es stilvoll wäre, verpfuscht, sondern in gesunder Kleinlichkeit, in zutiefst unfruchtbarer, von schönem Egoismus durchdrungener Resignation weitergelebt werden kann, weinen über ein Leben, das seinem Stil nach kleinkariert ist wie das Tuch, aus denen ein ganz gewiß hinkender Schneidermeister Jacken genäht hat für die Kellner, die mit der Würde eines Postkutschers und zugleich mit der Demut eines herrschaftlichen Lakaien - und jedenfalls in einer hoch über der sulzenen Mitzi schwebenden Sphäre sich langsam bewegend - Wein bringen und sich zwischendurch mit ebenfalls kleinkarierten Taschentüchern den Schweiß von der Stirn wischen.
Der Wiener beweint sich gerne, am allerliebsten beweint er aber seine eigene, fast orientalisch träge Pfiffigkeit, die ihm letztlich doch alle Ursachen des Jammerns entziehen könnte. Allerdings weint der Wiener grundsätzlich nur in angenehmer Umgebung, von der ein wenig theatralischen Szenerie beflügelt, das Wesentliche stets meidend, zu Recht, da ja, wie er dumpf fühlt, nichts auf der Welt wirklich wesentlich ist außer manchen bescheidenen Freuden des Gaumens und der Haut und der sachte auf die Ewigkeit zuplätschernden Seele.
Darin aber (sprach der zweiund-vierzigjährige Herr weiter) liegt eine seltsame Größe, ein stilles Eingeständnis der menschlichen Hinfälligkeit; ja, beim Heurigen erst kommt der Wiener zur grandiosen Einsicht, daß es völlig vergeblich wäre, eine Verbindung zu suchen zwischen wissen und tun, fühlen und handeln, Tragödie und Katharsis, Hoffnung und Zukunft. Das Leben ist eben eine in anmutigster Dämmerung verlaufende Tragödie, die von keinerlei befreiender Katharsis gekrönt wird. Die Lebenslust des Wieners ist in Wirklichkeit eine angenehme Form von Askese. Beim Heurigen, in der Rolle des Wieners, wird der Wiener von einer heiteren Verklärung erfaßt; mit einem Schlag sieht er, daß er all die
Ehrungen und materiellen Erfolge und hübschen Eitelkeiten missen könnte, wenn er's nur wollte; daß sie belanglos sind, verglichen mit dem pausbäckigen Glück eines einzigen Augenblickes, in dem die Balance zwischen dem Tier, das wir sind, und dem Geist, der wir sonderbarerweise auch sind, erhascht werden könnte.
Dieses Gefühl lichter Balance! Nirgends auf der Welt kann es so leicht entstehen wie gerade hier. Der Lebenskampf kommt zum Stillstand, der Lebenskrampf löst sich wie von selber, und über fettverschmierten leeren Tellern, weinseligen Gesängen, ordinärsten Körperlichkeiten schwebt in Form eines unsichtbaren Brathuhnes, nur ahnbar also, aber dennoch gegenwärtig, ein Hauch Erlösung.
Zuweilen wandert ein buttergelber Mond über die Hügel, die in manchen Nächten, von einer bewaldeten Höhe des Kahlenberges betrachtet, an Kälberrücken erinnern; johlende Männer und kreischende Frauen stapfen heimwärts durch Luftströme, die nach alten, halb schon verfaulten Wurzeln riechen, nach vor dem Aufbruch rasch noch hinter Frauenohren getupftem Parfüm, nach feuchter, modriger Kühle. Im Zustand wohlgesitteter, animalischer Euphorie ziehen sich die weinseligen Frauenspersonen, angeheiterte Greise, trunkenen Bürschlein und besoffenen Famüienväter zurück aus dem Park, um wenig später ruhig und laut zu schnarchen, im Traum noch am Weinglas fingernd und innerlich schon bereit, der Weckeruhr Stille zu gebieten. Der nächste Tag findet nicht statt
Auch die Kellnerin Mitzi schnarcht, es schnarchen die von ihren kleinkarierten Jacken befreiten Kellner, nur die alten Weiblein sind bereits wach, schütten ein paar Tropfen Tee in zahnlose Münder, reiben sich ein paar Tropfen Wasser ins Gesicht und beginnen dann mit der Arbeit. In wenigen Stunden sind die Gärten von den zerknüllten Papierservietten, weggeworfenen Knochen, zerbrochenen Gläsern und unter den Tisch gefallenen Trinkern befreit, und das Idyll kann von neuem beginnen.
So irgendwie (schloß der zweiund-vierzigjährige Herr) spielt sich das alles ab, theatralisch und menschlich, dieser artige Maskenball, diese große Entleerung der Seelen durch Fütterung der Leiber, diese allabendliche Verwirklichung einer etwas ins Wienerische umgebogenen Sage. Der Wiener erinnert an einen wohlbeleibten Prometheus, der nicht im Traum daran denkt, sich zu befreien. Er sitzt gemütlich an seinen Weinberg gefesselt, läßt sich täglich die Leber aus dem Leib reißen, und den fürchterlichen Adler, der das grausame Urteil vollstreckt, nennt er ein Vogerl. Sie verstehen einander leidlich gut, der Wiener und sein Vogerl. Und Ketten drücken ja nicht, wenn man sie gerne trägt.