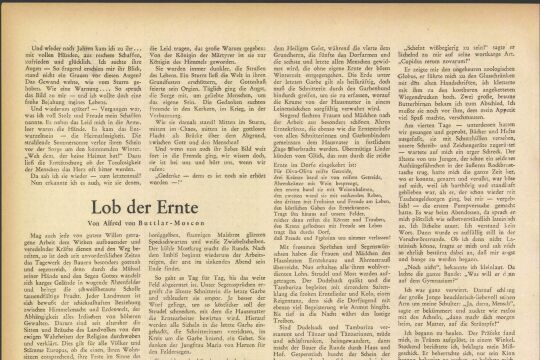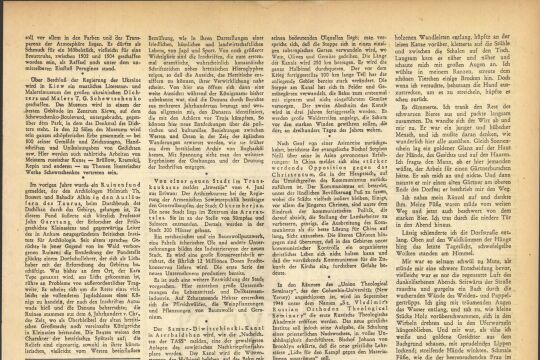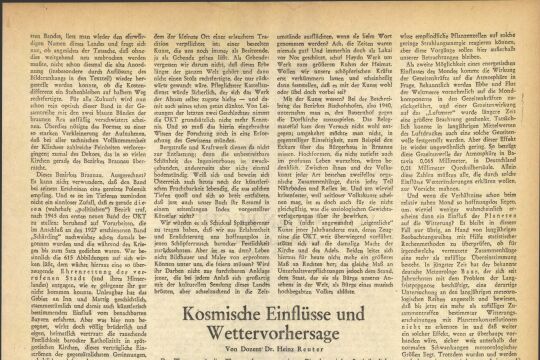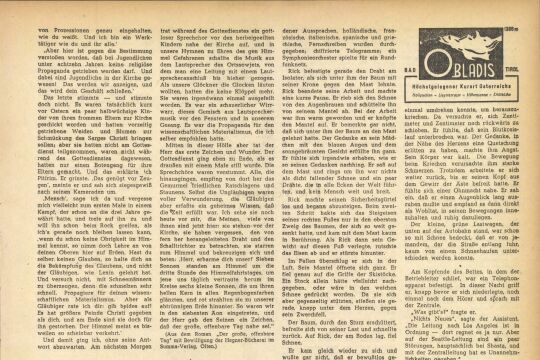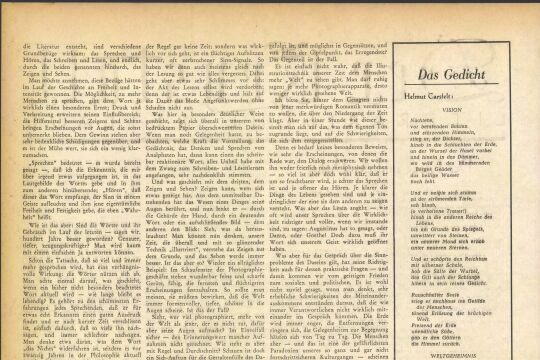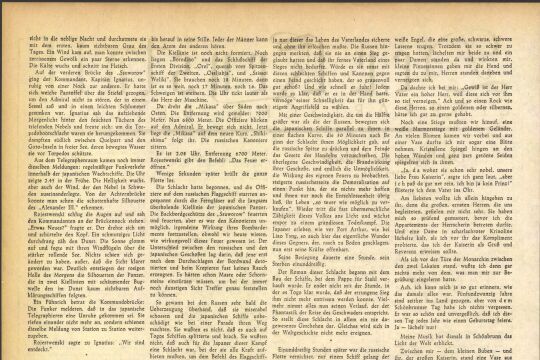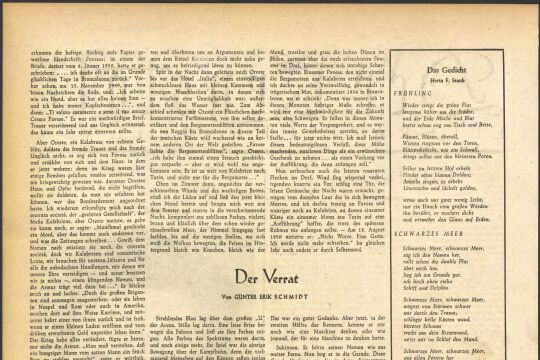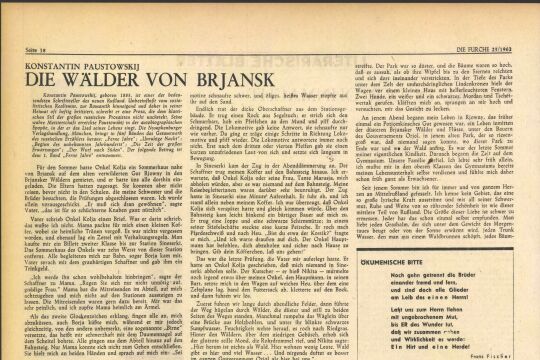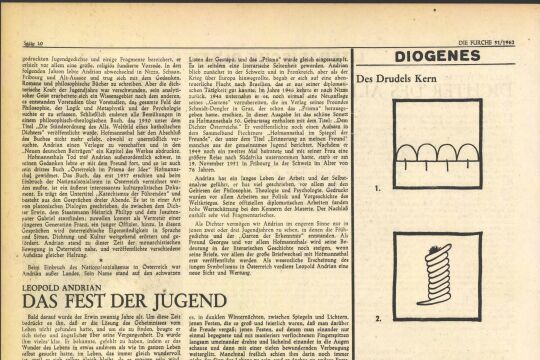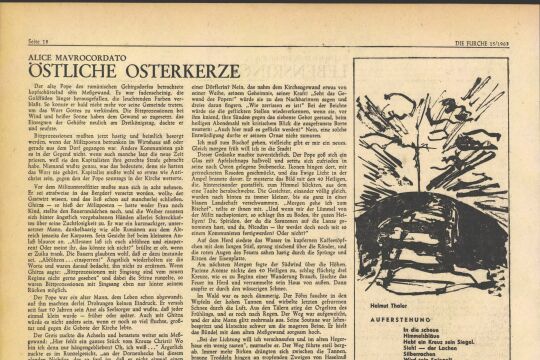Sie möchten, lieber Freund, eine Mitteilung von mir haben, und so will ich Ihnen erzählen, was mich jetzt beschäftigt. Es sind Sonnenblumen. Nicht Gartenblumen, zur müßigen Freude gezogen, auch nicht jene Ölfrüchte der Ukraine mit den schweren Rädern ihrer Samenstände, sondern nur jene kleineren Sonnenblumen, wie wir sie hier in den Hafer einbauen, mit Wicke oder Erbse gemischt, als Viehfutter.
Es ist so, wenn sie erblüht sind, wenn sie ihre Gesichter ganz der Sonne geöffnet haben und den goldenen Staub ihrer Pollen in die Luft schütteln, dann kommt mit Geratter und Gekrach der Traktor an, sie werden gemäht, gehäck-selt, zu kleinen Fetzen grünen und gelben Pflanzenfleisches, sie werden hinaufgeblasen in die Silos, mit Erde beschwert, vergoren wie Kraut und Rüben, und später dann, im Winter, um die Weihnachtszeit vielleicht, werden sie den Milchkühen vorgeworfen zum Fraß.
Jawohl, so geschieht es. Aber ehe es geschieht, gibt es noch einige Tage, und wenn andere Arbeit sehr drängt, ist es auch manchmal eine Woche oder zwei, daß die Felder stehen und atmen in ihrer Blüte. Es ist dann, als wenn sich der Sommer in ihnen sammelte zu einer geheimen Feier, zu einer Feier, die seine hohe Zeit und den Abschluß seiner Herrschaft zugleich umschließt. Das sind Festtage für mich, jedes Jahr, und sie werden begangen mit stillen Wegen zu den Feldern, am Morgen, wenn sie aus der Feuchte des Taues erst erwachen, oder abends, wenn die Sonne über sie hingeht mit den letzten starken Strahlen ihres rötlichen Lichtes, oder auch zu Mittag. Alle Gesichter der Pflanzen sind dem Aufgang der Sonne zugewendet. Jedes Gesicht ist anders. Glauben Sie mir, ich habe stundenlang unter Tausenden zwei gleiche gesucht und habe sie nicht gefunden, und war glücklich darüber.
Am Tag, ehe der Schnitt der Felder beginnt, gehe ich sonst noch einmal hin, wähle und trage dann ein oder zwei Arme der Blumen heim. Sie stehen in hohen Krügen im Haus, ich weiß nie in welchen sie am schönsten sind, aber ich glaube doch in den alten Zinnkrügen, deren kalter Metallton so wunderbar zu dem warmen Leuchten der hellen Blütenblätter kontrastiert. Solange sie im Haus stehen ist es noch Sommer. Dann, wenn sie verblüht sind, dann erst beginnt der Herbst.
Gestern nun hat der Schnitt eingesetzt. Ich hatte den Tag zuvor mit Arbeit versäumt, aber ich dachte, es würde zwei Tage geschnitten werden, ich konnte auf das kleine Feld hinabgehen, während auf dem großen gearbeitet wurde, ich freute mich darauf jede Stunde des Tages. Immer wieder aber schob sich eine kleine Pflicht zwischen mich und den Weg, ich wollte mit gutem Gewissen gehen, und ließ mich immer wieder abhalten. Schließlich begann die Sonne zu sinken, der Garten aber war dürr, erbarmungswürdig dürr, niemand hatte Zeit zum Gießen, ich mußte es selber tun, und das ist eine langwierige Sache, man muß fünfzig, sechzig Schritte mit der Kanne gehen, ehe man die Beete erreicht. Ich vertröstete mich auf den Morgan. Ich würde aufstehen ehe die Schnitter begannen, und im ersten Licht der Frühe die Blumen wählen. -
Im Schein des Abendrots trat ich dann noch einmal vor die Gartenmauer, um nach dem kleinen goldenen Feld hinabzusehen. Ich erschrak. Alles Gold war fortgenommen von ihm, es lag grün und flach da. Ich war traurig, obwohl ich mich schämte über ein so Geringes traurig zu sein. Nun ging das Haus leer in den Herbst hinein, der es schon umstand, nun fehlten die Sommerflammen, nun war das stille Fest versäumt.
Beim Abendessen saß ich allein mit dem alten Herrn, der unser Gast ist, in dem großen Raum. Er ist sechsundachtzig Jahre alt, aber seine Energie und Lebendigkeit ist die eines Sechsundfünfzigers. Er redete und lachte laut, und ich tat, als hörte ich zu. Endlich fiel mir ein, die Dämmerung hielt vielleicht noch so lange, daß ich nach Tisch hinabgehen und im letzten grauen Schein die gemähten Blüten erkennen konnte, zwischen Hafer und Wicke, daß ich, nicht gewählte freilich, aber doch Sonnenblumen aufheben konnte, die geschnittenen, und sie sammeln, wo ich noch heile fand.
Ich stellte dem alten Herrn den Abendbericht ein, entschuldigte mich und hastete aus dem Haus. Es war schon fast dunkel, aber meine Augen sehen ein wenig auch im Dunkeln, vielleicht gelang es. Drüben der rote Schein hinter der Linde, — Feuer? Aber es war nur der Mond. Er kam dunkelrot herauf, groß wie ein Wagenrad, ganz flach gedrückt; so grell hatte ich ihn nur einmal gesehen, damals, ehe der letzte Krieg begann, aber jetzt hatte ich nicht Zeit zu schauen, ich eilte weiter.
Als ich das Feld erreichte, war es wirklich fast Nacht. Vom Boden her stieg der kühle Duft von geschnittenem Grün auf, von Tau und abendlicher Erde. Nur leise, wie eine Erinnerung an den Tag, wehte einmal eine Süße darin, etwas wie von Sonne. Lange mußte ich in das graue Dunkel zu meinen Füßen spähen, ehe ich das erste Gesicht wahrnahm, das aufsah zu mir, und ich hob es auf mitsamt dem langen Stiel, der es trug. Erst allmählich lernte ich sie unterscheiden, und dann später konnte ich auch ihre Verschiedenheit erfassen. Die Bösen und Grämlichen, die Mißtrauischen und Hämischen, ließ ich liegen, wenn sie mir dann nicht plötzlich leid taten, und ich sie aufnahm. Ich wunderte mich, daß ich es gut sehen lernte mit der Zeit, und kam in meiner Vertieft-heit erst spät darauf, daß der Mond nun auch hier über den Hügel gestiegen war, nicht mehr rot, sondern mit einem milden Schein, und daß ich Sonnenblumen im Mondlicht sammalte.
Die Nacht war vollkommen still. Kein Windhauch regte die Luft, nur eine einzige Grille ließ leise einen Triller hören wie von einer winzigen Flöte. Sie wiederholte ihn noch einige Male, dann verstummte auch sie. Das Schweigen über dem geschnittenen Feld dehnte sich groß in die Weite. Ein kühler Schauer zog vom Tal herauf, das Mondlicht wuchs und ich sah die hilflosen Gesichter der gemähten Blumen jetzt deutlich daliegen. Auf einmal war es mir, als ginge ich über ein Schlachtfeld. Ich schämte mich meiner ganzen kindischen Wichtigtuerei und wendete mich heimwärts.
Als ich im Haus bei Licht, allein in meinem Zimmer, meine Beute ordnete, überkam mich die ungehemmte Erregung über ihre Schönheit von neuem. Tags zuvor hatte ich noch über das Wort „Der Schönheit Stachel“ gelächelt, aber jetzt empfand ich sie stachelnd, als müßte es möglich sein, sie tiefer zu greifen, festzuhalten, zu gestalten. Es war nicht möglich, so kam es mir vor, daß dies alles sein sollte, daß die Sonnenblumen nun hier in den Krügen standen und verwelkten. Wenn ich wenigstens Farbe hätte, Pinsel, und das Können dazu, sie zu malen! Wenn ich sie wenigstens malen könnte! Einmal hatte ich einen Maler beschworen, es zu tun. Seit van Gogh, meinte er, sei das Thema Sonnenblume erschöpft. Als wenn nach Giotto oder Perugino das Thema der Madonna erschöpft gewesen wäre, hätte ich wütend geantwortet. Ja, wenn ich sie malen könnte, so wie ich sie sah. mit den behaarten silbergrauen Stielen, den lebendig bewegten Blatthänden, dem starren Schuppenpanzer ihrer Kelchblätter, den gelben Strahlen um die dunkelgoldenen Herzen. Mit der unendlichen Mannigfalt allein der runden Mitte, die bei jeder der Blumen ganz anders war, anders im Verhältnis ihrer Größe zu dem Kranz, der sie umgebenden Blüte, anders in ihrer Stärke und Gewölbtheit, anders in ihrem Bau. Sie konnten dunkelbraun sein und einheitlich wie ein samtenes Kissen, oder hellgrün und wie von einem Geometer rastriert, mit Staubfäden rundum in ausgezirkelten Ringen. Wenn ich sie so malen könnte, wie ich sie sah, mit der ganzen Kraft des Sommers in ihnen, mit der kriegerischen Kraft des Lebens und der Gewalt seiner Sprache, ich wäre bereit gewesen, einen Teil meines Daseins dafür zu geben.
Bis ich die Krüge im Haus gesucht hatte, Wasser geholt, die Blumen geschnitten und geordnet, war es spät geworden. Ich war auf einmal zu müde, sie noch aus dem Zimmer zu tragen, ich ließ sie stehen, alle fünf wo sie standen, nur einen Krug rückte ich noch zu meinem Bett. Eine Hummel schlief in einer der Blumen, sie war ganz dunkelbraun und wie tot vor Schlaf, aber sie würde mich so wenig stören wie ich sie.
Ich schlief schnell ein und träumte zuerst von dem sonnenblumengelben Bändchen des Tschuang Tse. Dann träumte ich in China weiter.
Es war da ein alter Chinese mit einem gefurchten Gesicht und einer trockenen Haut wie Pergament, sein Gewand war aus gelber Seide. Ein Junger trat zu ihm mit der Gebärde der Ehrfurcht, er bat den Meister, ihm zu sagen, was er tun solle auf dem Wege zur Vollendung. Der Alte sah, ihn an, schwieg, und schließlich sagte er, er sprach im Traum chinesisch, aber ich verstand es dennoch, er solle versuchen, die vollkommene Sonnenblume zu malen.
Der Junge wollte wieder etwas fragen, aber der Alte war aus dem Blickfeld des Traumes gerückt. Der Junge kniete auf den Boden, er bückte sich über eine Maltafel und malte. Er malte eine Sonnenblume, eine, die mit bewegten, mit stürmischen Blättern nach dem Licht griff wie in flammender Leidenschaft. Er malte sie und sie war schön und stark, aber da er geendet hatte, neigte er den Kopf und schob sie beiseite. Er hatte eine neue leere Tafel vor sich und malte eine andere Blume. Ihr Herz war groß und dunkel, als strömte ein schwerer Duft aus.ihm.aus, die.Äätter standen darum wie., wartend, leicht geneigt, wie in'Schlaf oder Bewußtlosigkeit- Sie war schön, aber sie war es nicht, ich mußte den Kopf schütteln, ehe er es selber noch merkte und die Tafel fortlegte. Die nächste Blume hatte schmale spitze Blätter, sie standen steif um das Innere, wie in geharnischter Abwehr. Sie war nicht die vollkommene Blume. Dann kam eine, die schien mir erst vollkommen in der Harmonie des Wuchses, aber ihr fehlte die Kraft. Auch sie war es nicht. Tafel kam zu Tafel, jede trug das Bild einer anderen Blume, keine war vollkommen. Es war mir, als währte es ein Leben lang, daß ich dem Malen zusah, und als wären es alle Sonnenblumengesichter, die ich je gesehen hatte, die hier gemalt wurden. Harte und weiche, kriegerische und tänzerische, alte und junge, verlangende und solche, die verzichtet hatten, die ihre Strahlenhlätter hängen ließen wie in letzter Resignation. Keine aber, keine war die vollkommene Sonnenblume. Wie die vielen verworfenen Bilder am Boden lagen, sah es aus, als wäre hier ein Sonnenblumenfeld gemäht worden. Die aufwärts gewendeten Gesichter der Blumen sahen aber nicht hilflos empor, es war über ihnen nicht die Schwere eines unaijfhebbaren Leides, sie waren wie abgeworfene Blätter einer Pflanze, die aus ihnen weiterwuchs, dort wo der Junge malte.
Der Tag ging und wechselte mit der Nacht, die Nacht stieg zu einem neuen Tag empor, der Junge vor mir änderte seine Gestalt und wurde zum Mann, und wurde ein Alter, und malte noch immer, und verwarf das Gemalte. Ich sah zu, ein Leben lang, gestachelt von dem Willen, zu sehen, wie es sei, die vollkommene Schönheit, die vollkommene Sonnenblume. Vielleicht auch war ich selbst der Malende geworden, ich weiß es nicht, der Traum hat nicht immer scharfe Grenzen, er wechselt manchmal das Ich und das Du. Ich merkte nur, daß ein Leben, seines oder meines, einem Ende zuging und spannte meinen Willen zu einer Sammlung der Kräfte, die ist wie ein Schmerz.
Da war es, als wenn einer mir die Hand nahm und sie führte, leicht und sicher, wie ohne Mühe, tat sie ihr Werk. Als malte ein anderer für mich, so sah ich die Blume entstehen.
Ihre hellen Strahlenblätter öffneten sich in leiser Bewegtheit, das Licht floß durch sie und aus der runden Mitte ihres Herzens leuchtete ein tiefes Gold. Es war nicht mehr das Greifen nach dem Licht, die Erwartung des Lichtes allein in dem Bild, wie in allen anderen vorher, es war jetzt das Licht selbst in der Blüte, es bewegte sich und strahlte aus jeder ihrer Fasern. Es war nicht mehr ein leeres Gefäß, das ich malte, es war der durchsichtige Leib des Lichtes.
Im Malen wurde das Licht immer stärker, es war, als wandelte und verzehrte es die Blüte, als würde sie zum Lebensrad und schließlich zur Sonne selbst.
Ich erwachte. Mein Zimmer war erfüllt von einem diffusen Schein, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Ich hatte die Zeit verloren und ging zum offenen Fenster, mich in ihr zurechtzufinden. Der Mond stand noch hoch und hell am Himmel, im Tal lag der Nebel wie ein weißes Meer, und dünne Nebelstreifen waren auch ins Zimmer gedrungen. Von drüben aber, vom Osten, kam schon das Licht der Sonne herauf, und die beiden Lichter, das der Nacht und das des Tages, mischten sich und legten sich hell um die Blumen in den Krügen.
Jetzt ist es Tag. Die Sonnenblumen stehen in seinem starken Licht, schön und lebendig, und die dunkle Hummel krabbelt in ihrem Goldstaub. —