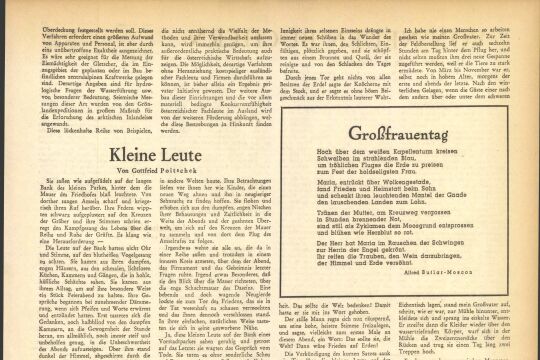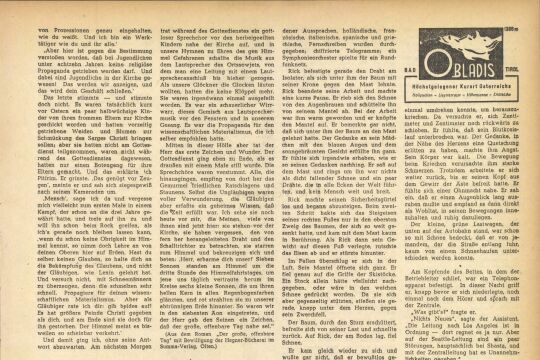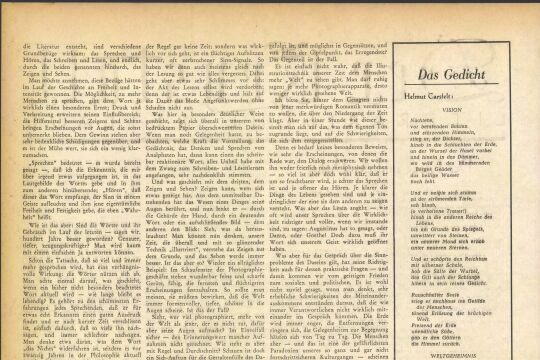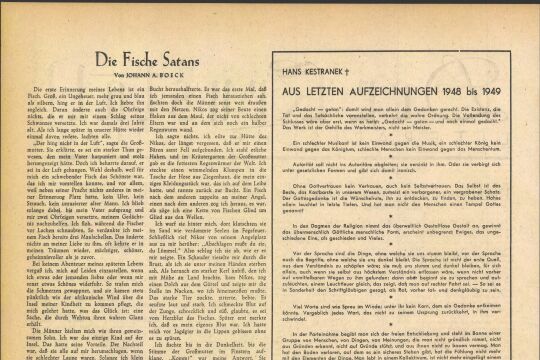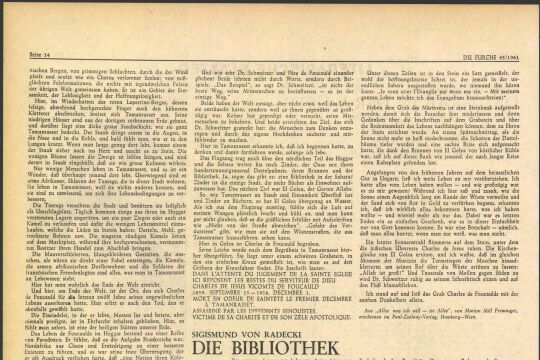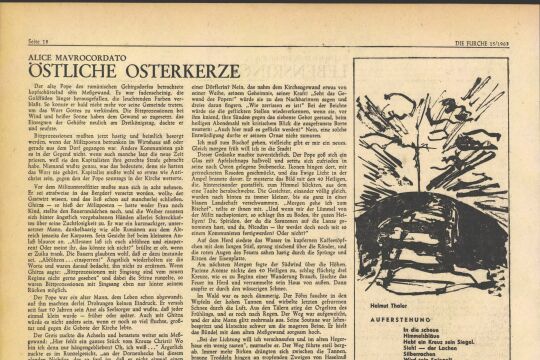Erzählung von EEVA-LIISA MANNER
I](r war auf dem Weg zu den Bergen. Er stammte aus einem kleinen, dem Untergang geweihten Staat und war den Gelben Fluß aufwärts gezogen, der breit wie das Meer dem Mond entgegenströmte, er war auf Schiffen gereist, die unter Segeln fuhren, auf Flößen, die von erschöpften Männern gezogen wurden. Es hatte ihn danach verlangt, ihr Schicksal teilen zu dürfen und mit ihnen zusammen das Floß zu ziehen. Er hatte so lange gezogen, bis das Seil seine Schultern wundgescheuert hatte und der Körper gefühllos geworden war und sein Gehirn Dinge zu sehen begann, die nicht vorhanden waren. Er wußte nun, was ein Sträfling oder ein Pferd empfanden, und ihm war, als sei er selbst ein Sträfling oder ein Pferd.
I](r war auf dem Weg zu den Bergen. Er stammte aus einem kleinen, dem Untergang geweihten Staat und war den Gelben Fluß aufwärts gezogen, der breit wie das Meer dem Mond entgegenströmte, er war auf Schiffen gereist, die unter Segeln fuhren, auf Flößen, die von erschöpften Männern gezogen wurden. Es hatte ihn danach verlangt, ihr Schicksal teilen zu dürfen und mit ihnen zusammen das Floß zu ziehen. Er hatte so lange gezogen, bis das Seil seine Schultern wundgescheuert hatte und der Körper gefühllos geworden war und sein Gehirn Dinge zu sehen begann, die nicht vorhanden waren. Er wußte nun, was ein Sträfling oder ein Pferd empfanden, und ihm war, als sei er selbst ein Sträfling oder ein Pferd.
Da weinte der königliche Bibliothekar bittere Tränen der Ohnmacht und schämte sich der Jahre, die er in Bequemlichkeit gelebt hatte. Es war ihm, als hätte er sie auf Kosten dieser Sklaven genossen unddabeidie Unbemittelten bestohlen.
Und er kam zu dem Schluß, daß es tatsächlich so gewesen war. Das Glück, das nicht davonfloß wie Wasser, sondern in der hohlen Hand blieb und wirklich vorhanden war, fand sich wohl nur in begrenztem Maße in der Welt, und wollte man davon seinen Teil haben, mußte man es jemand anderem wegnehmen. Also beschloß er, sich in die Einsamkeit und Armut zurückzuziehen.
Nachdem er viele Monate in westlicher Richtung dem Flußlauf gefolgt war, trennte er sich von dem Strom und wandte sich gegen die Berge im Norden.
Ejir hatte sie der Wüste vorgezogen. Sein Berg sollte kalt sein wie die Sterne. Nichts machte den Menschen so reif wie die Kälte. Und sein Berg sollte auch stfll sein wie der Schnee und unerforscht wie der Mond. Er hatte noch niemals Schnee gesehen. Was er gesehen hatte, war ein Gemälde: Schwarze Vögel im Schnee. Er hätte auch sagen können: Schwarze Vögel, von Stille umgeben. Damals kam er zu dem Schluß, er brauche den Schnee und die Stille. Er wollte sich damit das Gesicht waschen und die Gedanken läutern.
Er hatte gehört, daß der Schnee aus Kristallen besteht und daß jedes Kristall, auch das winzigste, vollkommen ist. Keines gleicht dem anderen. Er wollte Schnee finden und in ihm Taos Schrift lesen. Vielleicht waren die Schneekristalle gerade jene Filigrane, die das Geheimnis in sich bargen.
Er hatte in der Natur geforscht und aus weisen Erkenntnissen neue Erkenntnisse gezogen, wie ein Kind, das eine Schachtel öffnet und in ihr die nächste entdeckt und so kein Ende findet. Den Kern, das Herz, hatte er nie gefunden. Vielleicht gab es das gar nicht? Nein, sicher gab es das, nur konnte der Mensch es nicht finden -oder wenn er es fand, dann bezahlte er dafür mit dem Leben.
iSchnee war Taos Sprache, wie jede Materie Taos Sprache war. Wenn aber die Kristalle so winzig waren und, wie es hieß, mit dem bloßen Auge kaum wahrnehmbar, dann verbarg sich vielleicht gerade in ihnen das letzte Geheimnis, der Kern, den Tao vor allzu neugierigen Blicken schützen wollte. Und dann gab es vielleicht noch geheimere Geheimnisse, verschwindend kleine, die das Auge gar nicht wahrnehmen konnte, die zarter waren als der spinnwebenfeine Nervenstrang eines Tausendfüßlers. Vielleicht besaß Tao eine schmale Leiter ins unsichtbare Weltall, auf der nur ein kleines Kind emporsteigen könnte oder ein Mensch, dessen Herz selbstlos wäre.
War er so einer? Er wußte es nicht. Wüßte er es jedoch, dann wäre er es schon nicht mehr. Denn auch in seiner Unwissenheit verfolgte er den Zweck, zumindest das eine Ziel, selbstlos zu sein.
Das verdarb ihm alles. Tugend ist nicht durch Wollen zu erreichen; gerade dieses Wollen war das Hindernis auf dem Wege dahin. Die Tugend besteht nur von Natur aus, oder sie ist gar nicht vorhanden. Tugend durch Wollen zu erreichen, das ist furchtbar, bedeutet Lästerung.
Mit solchen Gedanken beschäftigt, war er von Frühjahr bis Herbst gewandert, und jetzt fühlte er sich ziemlich müde. Er folgte dem Mond und der sanft an- und absteigenden Linie der Berge. Oder war es so, daß der Mond mit ihm zog? Denn hielt er an, verharrte auch der Mond. Er lächelte traurig über seine Wahrnehmung. Wenn er also lange und angespannt über seine Wanderung nachdachte, wußte er am Ende nicht, wer von ihnen beiden wanderte -der Mond oder er selbst.
Der Mond, eine große gelbe Mandarine, nahm zu und ab, im gleichen Rhythmus, in dem die Frauen ihre Periode hatten. Daß die Frauen, die auch sonst geduldig waren wie die Tiere, eine solche Uhr besaßen! Die Große Monduhr, die langsam vollgeblasen wurde und sich wieder entleerte, glich einer Fruchtbarkeitsuhr. Nach Meinung einiger Gelehrter war der Mond auch der Gott der Fülle, der seinen Samen in alles Werdende und Wachsende streute. Ohne ihn war kein Leben denkbar. Was auch immer, der Mond hatte, wie alles auf der Erde, seine eigenen Veränderungen und seinen eigenen sich wiederholenden Rhythmus: den Weggang und die Rückkehr, das Todesstreben, das Sich-Füllen und -Entleeren, die Reife und den Samen, den Austritt ins Weltall, das Leerwerden.
Der gleiche Wechsel von Leere und Überfluß herrschte in allem, auch in seinen Gedanken, die sich all der geschriebenen Weisheit bemächtigt hatten und plötzlich wieder leer wurden und flach wie’ ein kleines Gewässer. Wenn er einem Kind begegnete oder einem Greis, der so alt war, daß seine Augen unter den vielen Runzeln nicht mehr zu erkennen waren, dann fühlte er, daß alles Wissen von ihm glitt und daß er leer und leicht wurde wie eine Schale, die nur noch ihre eigene Last fortzubewegen hatte.
War Tao etwa ebenso leer oder noch leerer, während die Welt so voll war?
Auch körperlich wurde er immer leichter auf seiner Wanderung. Er hatte seinen ganzen Reisevorrat den Kindern gegeben, die sich von Raupen und der Rinde von Mammutbäumen ernährten, und alles Wasser an die Durstenden verteilt. Seine Sandalen hatten sich abgenutzt und waren ihm von den Füßen gefallen. Aber sein Geben war keine Tugend, denn er wußte, daß seine Entbehrungen belohnt würden; die Berge im Norden waren freundlich.
Als er sich schon an den Hunger gewöhnt hatte, fand er Pflaumen und Kirschen, deren saftiges Fleisch auch den Durst zu löschen vermochte. An seinen Füßen waren inzwischen neue Sohlen gewachsen. Seine Entbehrungen waren eher Überfluß denn Entsagung und ver-
gönnten ihm ständig kaltes, schwereloses Glück. In dem Maße, wie seine Last leichter wurde und er auf seiner Wanderung vorwärtskam, befreite sich sein Gemüt vor allem Überflüssigen.
Je höher er stieg, desto kälter wurde es. Nachts heulten die Wölfe, und ihr Geheul brach sich als Echo. Wenn ein Wolf heulte, hörte er vier. Wenn hundert Wölfe heulten, hörte er vierhundert. Taos Geist wohnte in den Wölfen, und er fürchtete sie nicht; sie waren wirklich da. Aber ob Taos Geist auch in dem Echo wohnte? Vordem Echo hatte er Angst.
.A Is die ersten Fröste kamen, klang das Echo immer lauter und vielstimmiger. Die Sonne spiegelte sich im grünen Eis wider, und der Mond wurde auf seiner Wanderung gegen Westen immer zarter und durchsichtiger. Morgens nahm er erfrorene Vögel von den Ästen ab. Ihre Augen waren wie künstliche Perlen und blickten ohne Gefühl und Leben. In ihren Kehlen, die voller Fleiß und Freude gewesen waren, klang keine Saite mehr an. Taos Herz und Leber waren tot in ihnen.
Aber Schnee sah er immer noch nicht.
Schnee gab es nur auf den Gipfeln, und er konnte ahnen, wie weiß sie waren. Er sehnte sich jedoch nach nahem Schnee, nach Schriftschnee, nach Taos Tüpfelchen und kleinen Sternen.
Dann kam er an die Mauer und an den Eingangsturm. Der Wächter, ein stiller Jüngling mit dem Gesicht eines Greises, bewirtete ihn mit Tee und führte ihn hinauf auf den Turm, von wo aus er ins Land sehen konnte. Berge, nur Berge, die in der Ferne rot waren wie Blut. Die Erde unten war nicht zu sehen. Nebel füllte die Täler, und die Berge schwebten frei im Raum. Es war noch früh am Abend, und der rote Mond ruhte in einer Bergfalte wie ein Ei im Mutterleib.
Die Mauer schlängelte sich aus dem Nebel heran, ein steinerner Drache, der unterwegs war in die Ewigkeit wie er selbst.
„Weißt du, Wächter, welchem Gott man die Mauer geweiht hat?"
„Ich weiß es nicht, Herr."
„Dem Gott der Langmut."
„Und warum ihm?"
„Damit wir ihn kennenlernen."
„Viele sind beim Bau dieser Mauer gestorben."
„Es ist die einzige Möglichkeit, den Gott kennenzulernen. Man muß sterben, um ihn zu erreichen."
Sie stiegen hinab und tranken wieder eine Tasse starken schwarzen Tee.
„Im Turm lernst du denken. Wenn du so alt bist wie ich, weißt du vieles", sagte der Alte.
Ein Lächeln erhellte das Gesicht des Wächters.
„Wird mich das glücklich machen, Herr?
„Nein. Aber du wirst freier sein."
Sie tranken, und um sie her war alles still. Die Teekanne hatte die Form eines kleinen dicken Drachen und blies Dampf aus den Nüstern.
„Aber jetzt muß ich gehen. Ich habe es noch weit."
„Wo wollen Sie hin, Herr?"
„Dahin, wo die Einsamkeit ist."
Der Wächter sah in ungläubig an, sein Schnurrbart hing herunter. Der Alte trank Tee; er machte ihn leicht und satt zugleich.
„Ich möchte mich nicht länger betrügen. Ich bin alt. Es wird Zeit für mich, daß ich ein Leben in Ergebenheit führe."
„Aber įst denn der Mensch nicht überall einsam?" fragte der Wächter hilflos.
„Das ist menschliche Einsamkeit. Ich gehe in die Einsamkeit, in der ich mich nicht einsam zu fühlen brauche. Ich nenne sie - die Stille."
Und er zeigte auf die Berge.
„Ich will den Schnee erforschen. Der Schnee hat eine andere Zeit als wir."
„So wie die Raupen …?" fragte der Wächter scheu.
„So wie die Raupen. Oder wie die Sterne."
ber bevor er ging, schrieb er in das Tagebuch des Soldaten einige Sätze. Der Pinsel war abgenutzt und steif, und er hatte in dem flackernden Licht der Talgleuchte ziemlich lange zu 4un. Schließlich nickte er, raffte die Schöße seines schmutzigen Mantels zusammen und stieg die in Stein gehauenen Stufen hinunter.
Der Docht der Talgleuchte wurde kürzer. An seiner Länge war abzulesen, daß es Mitternacht war. Ein großer Schatten zuckte auf der Wand, als ob er atmete. Der Wächter nahm nachdenklich das Tagebuch zur Hand, öffnete es und las:
Lehm wird zum Gefäß geformt, doch die Leere in ihm macht den Nutzen
aus. /
Tür und Fenster werden in Wände
gehauen,
das Haus erhebt sich um einen leeren Raum.
Was vorhanden ist, gilt als Mittel.
Wirken tut aber das, was nicht da ist.
Er warf das Buch hin und stürzte hinaus. Es war niemand da. Inzwischen hatte es geschneit. Der Mond war grün. Aber der Schnee war unberührt, es waren keine Spuren zu sehen.
Der Wächter rannte hin und her wie ein. Wiesel. Der Meister blieb spurlos verschwunden. Der Wind hatte seine Spuren erfa ßt, und der Schnee war leer.
In der Ferne am Horizont führte ein Paß über die Berge, dorthin ritt auf grünem Rind Laotse und verschwand.
Deutseh von Rudolf Semrau Aus dem Band „Neue finnische Prosa", Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.