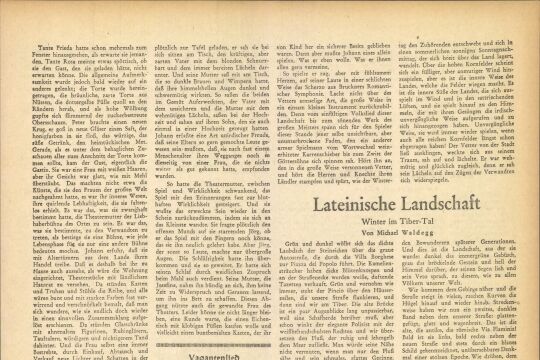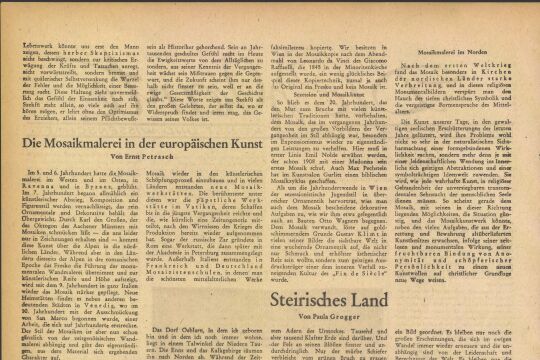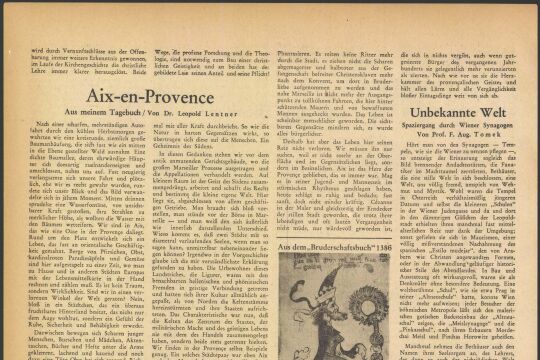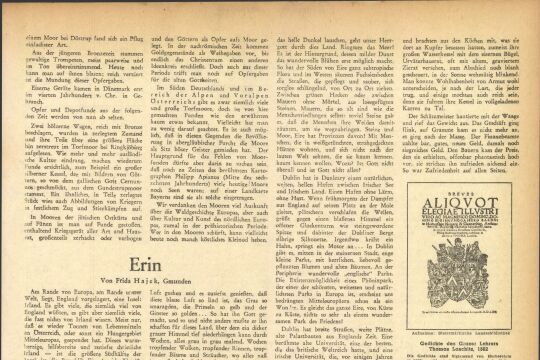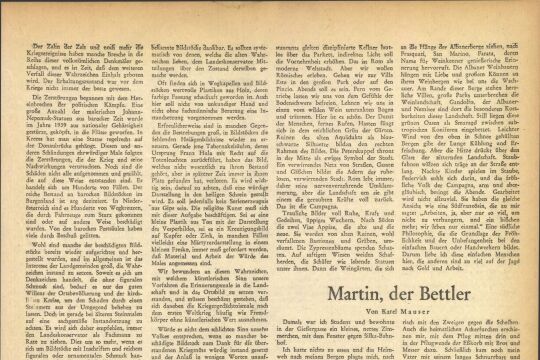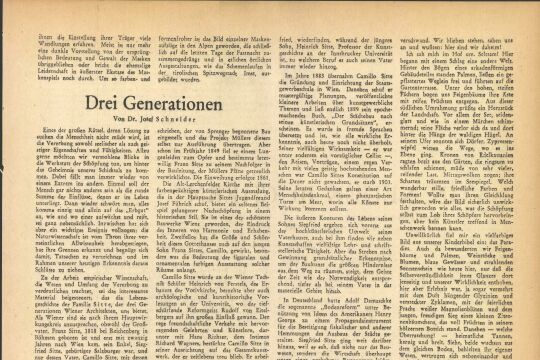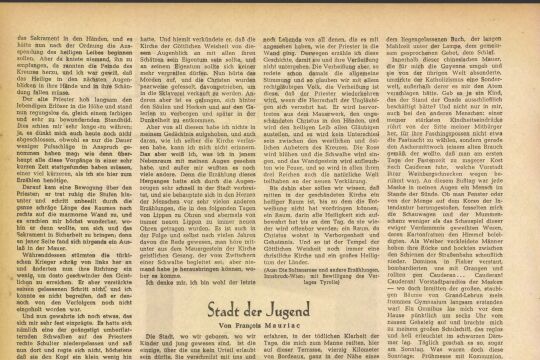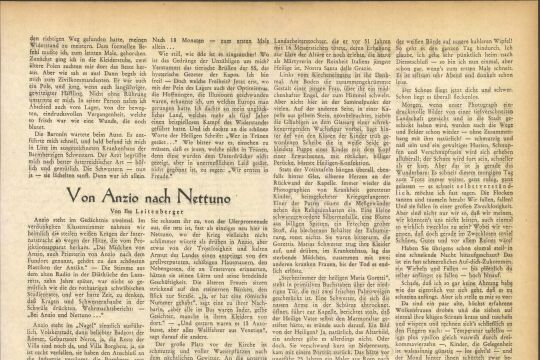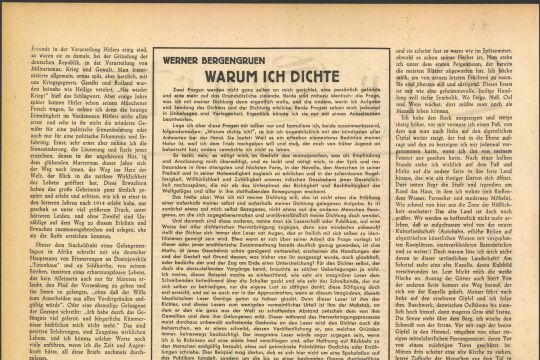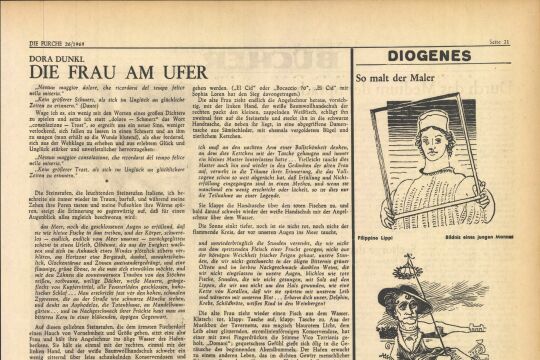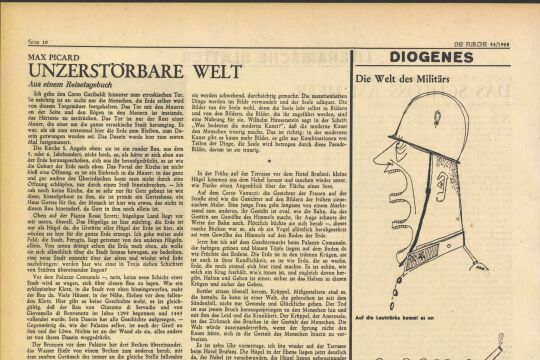Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Rom Brasiliens
KANN EIN REISENDER BRASILIEN VERLASSEN wollen, ohne seine einstige Landeshauptstadt — Bahia — besucht zu haben? Man wird es wohl bedauern, wegen der Größe des Landes nicht weiter ins Innere vorgedrungen zu sein, nicht sich auf den großen Strömen oder den vielen gewundenen Flußläufen gleich den frühen Pionieren des Landes, den „Bandeiran-tes“, in den Urwald gewagt und dabei die grüne Magie dieser so schönen wie gefährlichen Welt aufgenommen zu haben. Auch die berühmten Iguassu-Wasserfälle, deren Ausmaß das der Niagara-Wasserfälle übertrifft, liegen weitab und sind nur mit großen Mühen erreichbar. Die Goldgräberstadt Vila Rica trägt heute den Namen Ouro Preto, sie ist in ihrem einstigen Zustand erhalten geblieben. Eine ganze Stadt mit nur wenigen Menschen gegenüber den Hunderttausenden, die sie einst bewohnten. Bis auf die Einzelheiten, ja bis auf die Zerstörungen vor hundert Jahren ein lebendiges Museum: Natur und Architektur der Vergangenheit mit heutigen Menschen.
Von Kultur zeugen freilich nur die Kirchen dieser Goldgräberzivilisation. Wüßte man nicht, daß der Dienst am Sichtbaren vergänglich ist und nur der am Unsichtbaren bleibt, hier hätte man es deutlich vor Augen. Höchst seltsam, daß in der Herde der Goldgierigen und nur auf sich Bedachten sich einige wenige befanden, die dafür noch Sinn hatten, Künstler und Werkleute ins Land zu rufen, um an dieser Stelle Kirchen mit allem Prunk der Zeit — dem Barock der Jesuiten — aus den Mitteln der Besitzenden errichten zu lassen. Hier war auch Brasiliens Michelangelo, Antonio Francesco Lisboa, geboren, der wegen seiner Gelähmtheit und Krüppelhaftigkeit „O Aleijadinho“ genannt wurde, hier schuf er noch, von der Lepra zerfressen, als ein Siebziger bis zu seiner Erlösung, dem Tode.
MAN MÜSSTE MANAOS, die Stadt am Amazonas, den einstigen glücklichen Mittelpunkt des Gummibooms, gesehen haben, mit seinen Prunkbauten vor fünfzig Jahren und den heute verlassenen Straßen und Plätzen. Aber Bahia ist doch unumstritten, auch für den künstlerisch empfindenden Menschen, der bedeutendste und leichter erreichbare Ort seines Interesses. Denn El Salvador, wie es heute heißt, verbindet eine lebendige Tradition von den ersten Tagen der Entdeckung des Landes bis auf unsere Tage. Hier hat die südliche Halbinsel Amerikas begonnen, hier ist noch viel unverändert erhalten und steht im Glanz der Jahrhunderte. Die Menschen sind voll eines ursprünglichen, ererbten Charakters, und alles, was sich hier vollzieht, entbehrt nicht der Romantik und des angeborenen Künstlertums.
Die erste Station auf dem Flug von Rio ist Vitörio, die Hauptstadt des Staates Espirito Santo. Die Landung glückt trotz starkem Nebel. Mit dem gleichen zweimotorigen Flugzeug des „Cruzeiro do Sul“ geht es bald weiter. Die Wolken hängen tief. Immer wieder durchdringen wir die großen, dichten, grauen Ballen. Regenperlen rieseln unablässig über die Fensterscheiben, und Regen rinnt über die Tragflächen. Wir hoffen, noch über die Wolken zu kommen. Plötzlich — es ist ein Viertel nach fünf — ist Sonne über dem grauen Nebelmeer. Die Maschine hat sich hochgearbetet. Ein breiter, roter Streifen am Horizont begleitet uns bis zum Untergang der Sonne.
PLÖTZLICH WIRD DIE SICHT in die Tiefe frei. Die breiten Schlingen der Flüsse, die zum Meer führen, werden deutlich. Aber es wird kalt, grimmig kalt. Die wenigen Passagiere bekommen drei bis vier Decken ausgehändigt. Ich schlinge einen Schal um den Hals, setze den Hut auf den Kopf, und so eingemummt, versuche ich zu schreiben, nur um nichts von den heftigen Böen merken zu müssen, die das Flugzeug erschüttern.
Endlich müßte man dem Ziele nahe sein, erwägt man. Dichte Finsternis umgibt die Maschine, nur die roten
Lichter an den Tragflächenenden schwanken merklich. „Use cintos“ gebietet die Leuchtschrift. Endlich, endlich Lichter in der Tiefe, ein blitzendes Lichtgeschmeide, es ist der Hafen von El Salvador an dieser am Tage so prächtigen Palmenbucht. Sie war es auch, die einst die ersten Entdecker gerade hier zum Landen verlockte.
Schon die Fahrt von dem fast eine Autostunde entfernten Flughafen San Salvador zur Stadt ist ein Erlebnis, anders als in Rio. Das Licht der Scheinwerfer reißt links und rechts vom Weg zauberhafte Details der großen Landschaft au? dem Dunkel: Bambuswälder, Zuckerrohrplantagen, niedere Eingeborenenhütten.
Durch kleine Vororte, deren Straßen und Plätze nur schwach beleuchtet sind, geht es im Auto zu einem märchenhaften Ziel: zum Hotel „Bahia“. In ihm abends nach mühevoller Fahrt einzukehren ist, wie in einen Traum zu fallen, der alle Wünsche erfüllt. Hier hat die moderne brasilianische Architektur ein Bauwerk geschaffen, das allen Ansprüchen in den Tropen gerecht wird und den Wohnraum aufs schönste mit der ihm umgebenden Natur verbindet. Hier wartet ein Luxus an Komfort und eine reizende Betonung des Einheimisch-Charakteristischen. Mädchen in der schmucken Tracht der Bahiana reichen den Cafe-sinho. Die Bahiana ist der schönste Typus der Brasilianerin. Ein wenig trägt auch ihre schmucke Nationaltracht bei zu dieser Beliebtheit: der Turban, der weitgeschwungene Rock in hellen Farben, die Bluse, die Gehänge von Perlen und Glas. Flitterwerk (Balagandas) und klirrender Aimschmuck.
Ich steige am Morgen auf die Terrasse. Das Meer liegt blau im Sonnenlicht. Es glänzt aus der Tiefe. Auf der anderen Seite prahlt der Stadtpark mit alten, breiten Schattenbäumen. Die Menschen gehen durchweg in Weiß gekleidet. Wir sind in der Oberstadt. Die Fassaden der Häuser tragen das Antlitz der Geschichte: das schmucklose Haus der portugiesischen Kolonisation, die vielen schmalen Häuser mit kleinen Stiegenaufgängen an der Außenseite und den schmucken Kacheln erinnern noch an die holländische Besatzungszeit vor dreihundert Jahren. Heiter und bewegt herrscht das Leben auf der Straße, lustig durchklingelt sie die fensterlose Straßenbahn. Alte Frauen aus dem Volk hocken an den Ecken und halten gewürzte, gebratene
Fischlaibchen feil, sie reichen .sie reinlich auf Palmblättcrn; andere wieder haben ein kleines Tischchen mit Zigarren vor sich, dem Hauptprodukt der Landschaft. Nur das Deckblatt der Zigarren stammt angeblich aus Indo-china.
BAHIA HAT EINE VIELZAHL VON KIRCHEN. Man zählt ihrer so viele, wie das Jahr Tage hat. Das scheint übertrieben, aber viele von ihnen erstrahlen im Innern von Tausenden Goldblättchen, welche die Hochreliefs der Wände in San Francesco
überziehen. Hier ist nicht die kleinste Stelle ohne Gold geblieben. Großartig die vielen Azuleijos, die hellblauen Delfter Kacheln, mit den historischen
Darstellungen, nach holländischen Zeichnungen ausgeführt von portugiesischen Handwerkern. Die bedeutendsten sind im Klausturm und veranschaulichen mit ihren Darstellungen nach Dichtungen des Horaz eine Sittenlehre in Bildern. Sie sind ein Geschenk des Königs von Portugal, Joao V., aus den Jahren 1747/48.
Wir treten auf den Balkon der Sagristia der Kirche Zu Unserer Lieben Frau von Karmel und richten unseren Blick an den leise vom Wind bewegten Palmen vorbei in die Stadt am Meer. Abfallende Straßen, gebuckelt mit Katzenkopfpflaster, führen dahin. Immer wieder begegnen uns Maultiere mit schaukelnden Tragkörben voll Zuckerrohr und Kakao. Sie heißen „burrinho com cacoa“. Der primitive Transport hat hier noch nicht dem Motor' weichen müssen. Das schwarze Element scheint hier vorherrschend. Es sind die Nachkommen der Millionen afrikanischer Neger, die in unendlichen Sklavenzügen über das Meer gebracht wurden. Wir tun einen Blick in die Halle eines neugebauten Hauses. Es gehört anscheinend einer gewerkschaftlichen Organisation. Ein großes Mosaik von Portinari sieht uns bezwingend entgegen.
DIE GERÜCHE DES MARKTES überfallen uns. Wir suchen den „stinkenden“ Aqua de Meninos. Verkaufsstand steht hier dicht neben Verkaufsstand. Alles ist unrein und lärmend. Eine besondere Spezialität: der Verkauf von Töpferwaren der Indios aus dem Inferior. Wir erstehen um billigen Preis eine Unmenge Vasen, Tiere, Pferde samt Reitern und Krokodilen, vielfach nicht gebrannte, aber eigenartige, primitiv geformte Gegenstände der Volkskunst.
Der Mercado Modelo am Hafen, vor den schwankenden, dichtbeladenen ■ Bananenbooten mit weißen Segeln, ist in einer von Menschen erfüllten geschlossenen Halle, dem einstigen Sklavenmarkt. Daher der Name. Nun gleicht er einer unserer Markthallen. Ich erstehe einen eisernen Chebu. einen Dämon mit Speer und Lanze gegen andere Dämone. Er soll mir sie vertreiben helfen. Und dann wieder hinein in das Treiben und Leben am
Hafen. Die Waren, die verladen werden, werden in Säcken auf den nackten Schultern der Eingeborenen getragen. Hier finden wir sie alle, die köstlichen Typen, wie sie Carybe in unvergleichlicher Weise mit seiner Feder gezeichnet hat. Eigenartig die lokalen Tänze in Form eines Zweikampfes, die Musikinstrumente wie ein Bogen. Eine eigene, wirbelige Welt lebt hier in der Unterstadt. Des Abends kehren wir wieder zurück in die vornehme Stille der alten Parks, auf die gläserne Terrasse des Hotels, durch die Luft und Licht, die tropische Pflanzenpracht, ja die ganze Welt flutet. Papageien und Pfeffervögel sitzen, gelassen und oft etwas verwundert über ihre Umwelt, in goldenen Käfigen dort und lassen sich zwischendurch von den für eine Weile wieder zu Kindern gewordenen Gästen bestaunen.
NOCH SIND WIR IN DER UNTERSTADT, aber der Elevador Lacerda führt uns rasch wieder zur Höhe. Unablässig gleiten die Aufzüge. Die technische Anlage ergibt kein ausgesprochen schönes Bild. Aber die Armen und Müden sind dankbar und trösten sich, daß man sich in dem schönen Paris auch an den Eiffelturm gewöhnt hat. Man bezahlt einen geringen Obolus. Wie überall stellt man sich an. Vor mir steht eine blinde Frau. Viele Hände strecken sich nach ihr, ihr den Weg zu weisen. Sie erhält viel mehr der Münzen zugesteckt, als sie für die Fahrt braucht. Dann schwebt auch sie mit uns in der engen Kabine zur Höhe. Für sie ist kein Unterschied zwischen unten und oben. Sie kann nicht teilhaben an dieser erregend schönen Welt von Bahia, der Romantik seiner Häuser und Menschen, dem Zauber der Tropen, diesem Traum von Vergangenheit und Gegenwart als Schönstem in Brasilien. Sie ward auch nicht viel hadern über ihr Schicksal; ob „Christus“, wie man hier sagt, „ein Bahia-ner war“, wird sie nicht bezweifeln wollen und ihm ihre Verehrung darbringen gleich allen denen von oben und unten, Weiß, Braun und Schwarz in gleicher Weise.
Während mich das Flugzeug nach Pernambuco entfuhrt, ist mir fast weh ums Herz. Ich werde wohl kaum mehr nach Bahia zurückkehren. Ein verlorenes Paradies. Ist es nicht wie bei dem unserer Jugend?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!