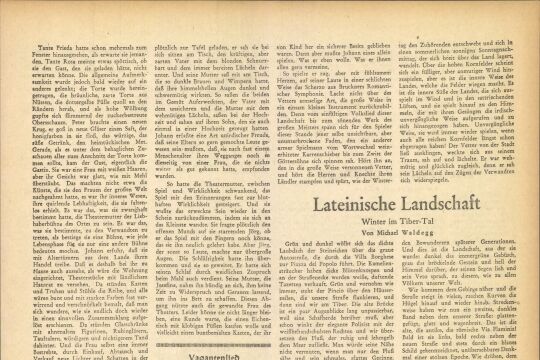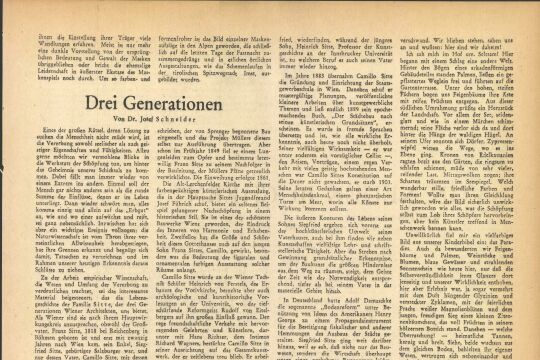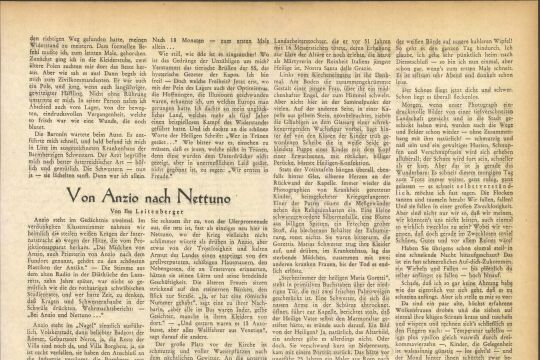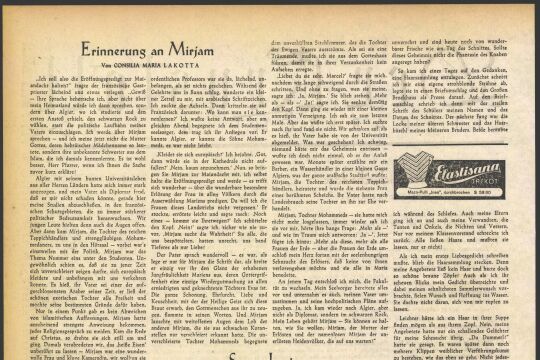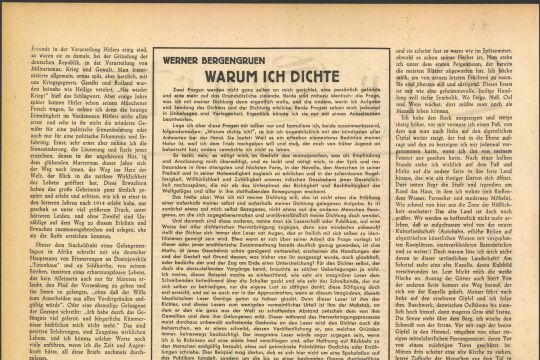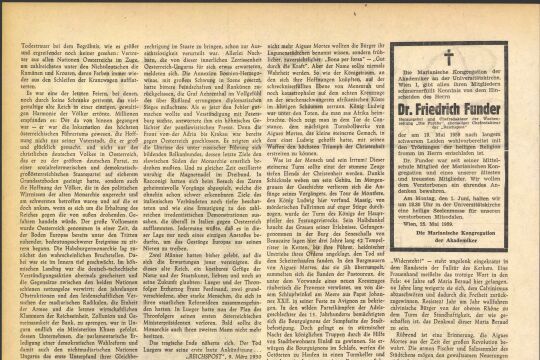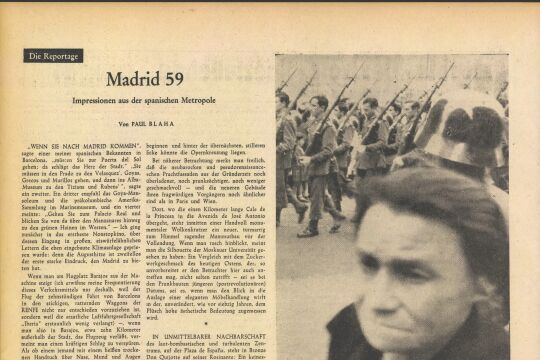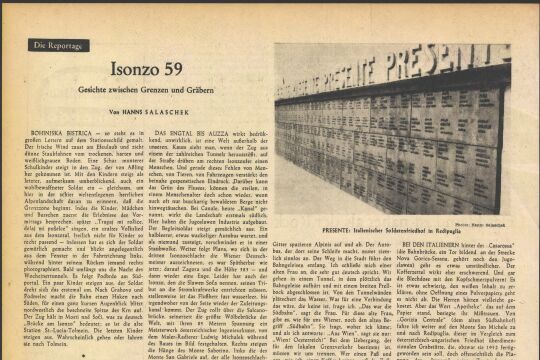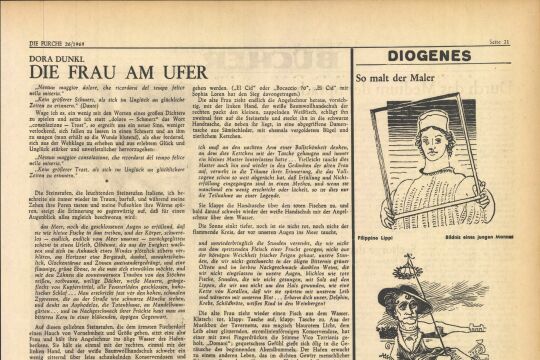Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ist das Leben nichts wert?
Vor Morgengrauen schon sind wir im großen, modernen, peinlich reinen Autobus von Guana-juato, alter Bergwerksstadt und Wiege der mexikanischen Unabhängigkeit, abgefahren. Durch die winterdürre Hügellandschaft des mexikanischen Hochplateaus rollen wir: Silao taucht auf, Irapuato und schließlich Celaya, wohlbekannt für seine kandierten Früchte. Hier erlitt auch der berüchtigte Banditen-„General“ Pancho Villa seine entscheidende Niederlage von den Händen Obregöns. Zweitausend Villistas wurden in die Stierkampfarena getrieben und von den erfolgreichen Regierungstruppen mit Maschinengewehren niedergemäht. Noch ein paar Kilometer und ein breites, fruchtbares Tal breitet sich nun aus, Kuppeln und Türme glitzern im Strahl der Morgensonne in der Ferne: Queretaro.
Durch enge, holprige Gassen, manchmal gerade nur breit genug, um den Autobus durchzulassen, geht es zum Hauptplatz — Plaza Obre-gön. Umschlossen ist die quadratische Plaza von der alten Kathedrale, zwei oder drei Hotels und Arkaden („portales“) mit kleinen Läden und Kaffeehäusern. Im Zentrum liegt ein staubiger Park mit ein paar Palmen, Sträuchern, Kakteen und Steinbänken. Ein Indianer, anscheinend uralt, aber kerzengerade und hochgewachsen, bietet seine Dienste als cargador — Gepäcksträger — an. Er bewältigt die zwei Koffer und das große ungeschickte Paket mit den Sombreros und den Holzschüsseln, das wir nun schon durch halb Mexiko geschleppt haben. Zum „Gran Hotel“. Es ist nicht mehr sehr „gran“ — fadenschlissiger Prunk eines vergangenen Jahrhunderts, es hat sicherlich bessere Zeiten gesehen — aber es ist anscheinend rein und frisch gemalt. Über eine steile Freitreppe geht es zu einem riesigen Zimmer mit wackeligen Möbeln. Unter jedem der beiden Betten steht ein blankpolierter Messingspucknapf und ein Henkeltöpfchen ...
Im leeren Speisesaal nehmen wir ein verspätetes Frühstück ein, dann geht es wieder hinauf auf die Plaza Obregön. Ein altersschwacher Omnibus wartet auf Fahrgäste; „Cerro de las campanas“ steht auf der verbeulten und verkratzten Seitenwand geschrieben. Cerro de las campanas - Hügel der Glocken — dort wurde er hingerichtet, am 19. Juni 1867 standrechtlich erschossen, Maximilian, Kaiser von Mexiko. Laut Reiseführer steht dort eine Gedäohtniskapelle, die die österreichische Regierung (wahrscheinlich richtiger das österreichische Kaiserhaus) im Jahre 1901 hat errichten dürfen. Wir besteigen das altertümliche Fahrzeug, fahren wieder durch enge Gassen, vorbei an den Adobehütten der Vorstadt, bis sich die Stadt im freien Lande verliert. Ein ungeheurer Aquädukt — 74 Bogen, sagt der Reiseführer — zieht sich durch das Hügelgelände; man wird an die römische Campagna erinnert. Eine einzige Mexikanerin steigt aus, setzt den Tragkorb auf den Kopf und wandert auf nackten Füßen hinaus in die einsame Landschaft, Gott weiß wohin. Nirgends eine Spur menschlicher Behausung. Irgendwo singt ein Vogel ein uns fremdes Lied... Der Lenker bearbeitet wieder die ächzende Kupplung, dreht den Bus um, und es geht wieder zurück auf demselben Weg, auf dem wir gekommen sind; den cerro müssen wir irgendwie verpaßt haben. Vor mir sitzt ein würdiger Patrizier mit einem mächtigen gelblichweißen Schnauzbart und in gleichfarbigem Tropenanzug. Ich versuche an ihm mein erbärmliches Pidgin-Spanisch: „iPerdoneme, sefior, donde questa el cerro de las campanas? El lugar donde Maximiliano es fusilado.“ Wie alle Mexikaner, ist er sehr freundlich und hilfsbereit, aber leider kann ich das Schnellfeuer seines spanischen Wortschwalles nicht verstehen. Er sagt, daß es „muy interessante“ ist, und etwas von einer Kapelle, und von einem goldenen Kreuz, aber, wo wir aussteigen sollen oder sollten oder hätten sollen, das kann ich nicht erfahren. Und „Singles?“ Englisch spricht niemand, weder er noch jemand anderer im Omnibus. Mittlerweile sind wir wieder am Ausgangspunkt an der Plaza Obregön angelangt. Da bleibt nichts anderes übrig, als auszusteigen und es irgendwie anders zu versuchen. Aber aussteigen läßt man uns nicht, ein vielstimmiges, lautes, beschwörendes, fast empörtes „No, no“ schallt uns entgegen, sobald wir Anstalten machen, den Bus zu verlassen — und mit großer spanischmexikanischer Beredsamkeit, unterstützt mit Zeichensprache, gibt man uns zu verstehen, doch sitzenzubleiben und weiterzufahren. Durch andere enge Gassen geht es nun, wir durchqueren dann eine andere Vorstadt, und sind wieder im Freien; offenbar beschreibt die Autobusroute eine Achterschleife, deren Schnittpunkt am Hauptplatz liegt. Schnauzbart gibt uns nun das Zeichen, auszusteigen, was wir auch mit vielen „multas grazias“ tun. Uns gegenüber steht ein wuchtiges Steindenkmal, den Helden der Revolution gewidmet, darüber, hoch gegen den stahlblauen Mittaghimmel, flattert die rotweißgrüne Fahne Mexikos.
Wir sind am Eingang zu einem etwas ruppigen Park, der angeblich alle in Mexiko einheimischen Bäume und Sträucher enthält; in der Mitte dieses Parkes befindet sich der Cerro de las campanas, eine ziemlich unbedeutende Bodenschwelle, die Kapelle steht auf der Flanke dieser Erhebung. Ein Backsteinbau im stillosen, sogenannten neugotischen „Stil“, recht vernachlässigt und etwas baufällig steht sie da in der flimmernden Mittagsglut dieses dramatischen, exotischen und unbarmherzigen Landes, so fremd und armselig. Ein Symbol für diesen unglücklichen Mann, Nachfahre Karls V., Opfer der Großmachtpolitik Napoleons III. Genau so fremd war er seinen „Untertanen“, wie dieses pseudogotische Sühnehaus en miniature dieser tropischen Landschaft fremd ist. Und dennoch ist diese kurze dreijährige Episode aus der turbulenten Geschichte dieses bewegten Landes nicht wegzudenken.
Eine Tafel am Tor der Kapelle belehrt uns, daß die historische Stätte zwischen 12 und 2 Uhr geschlossen ist. Es ist jetzt ein Uhr und kein Mensch weit und breit zu sehen. Wir umkreisen das Gebäude: keine Spur menschlichen Lebens. Zwischen Felsbrocken und stachligen Kakteen steigen wir zum Gipfel des Cerro; uns zu Füßen gleißen im Mittagslicht die Kuppeln Queretaros, in der Ferne der lange Rücken des Sangremal und die blauen Berge der Sierra Madre. Zwei Uhr in Mexiko, besonders in einer Provmzstadt, ist nicht besonders ernst zu nehmen, es kann auch halb vier bedeuten, oder „heute überhaupt nicht“. iQuien sabe? — Wer weiß? So wandern wir wieder zurück auf der staubigen Landstraße zur Haltestelle. Nach geraumer Zeit kommt wieder ein womöglich noch älterer Bus angewackelt. Das goldene Kreuz haben wir also nicht gesehen.
Am Nachmittag geht es zum Museo Pio Ma-riano, nebst dem Museo Nacional in der Hauptstadt das bedeutendste Museum des Landes. Es ist in einem aufgelassenen Kloster untergebracht. Die umfangreiche Bibliothek des Klosters vermodert dort langsam, unbenutzt, ungeleseri, nicht einmal katalogisiert. Die Bildergalerie enthält wertvolle Gemälde einheimischer Künstler. Besonders aber interessiert uns der Saal, der Er-mnerungen an den Kaiser beherberg^. In einer Ecke lehnt ein riesiger Sarg aus ungehobelten Brettern, er mußte speziell für die Hünengestalt des Toten angefertigt werden. In den Schaukästen vergilbte Photographien: die Richter des Militärgerichtes, das Hinrichtungskommando, die frischen Gräber. Flinten, die zur Hinrichtung abgefeuert worden waren. In einer anderen Vitrine eine makabre und greuliche Geschmacklosigkeit: die Metallspritze, mit der der Leicff nam einbalsamiert wurde; komplett mit handschriftlichem Attest des Arztes, der diese Prozedur unternahm. Beschriftet sind alle diese Objekte mit fast unleserlichem, verblichenem Bleistiftgekritzel auf Blättern, die offensichtlich aus einem Notizbuch herausgerissen, beileibe nicht herausgeschnitten wurden. Drei einfache rohe Holzkreuze lehnen gegen einen Schaukasten, zwei Kreuze sind mit einem M beschrieben, das Kreuz in der Mitte mit MA. Die Totenmale für die Gräber des Kaisers und der zwei Generäle, die ihm bis in den Tod treu blieben: der brillante Miramon, einst Präsident von Mexiko, und Mejia, vollblütiger Otoml-Indianer. „Aber warum steht M A auf Maximilians Kreuz?* frage ich den Kustos. „Maximiliano Austriaco“ ist die Antwort. Ein Fremder im Leben, ein Fremder im Tod, bis über den Tod hinaus. Austriaco... L'Autrichienne: so nannten sie Maria Antoinette ...
Wir machen einen Rundgang durch die Stadt, sehen die feinen Barockkirchen und Profanbauten, einige Meisterwerke von Tresguerras. In den zahllosen Juwelier- und Souvenirgeschäften kann man Opale kaufen und Ansichtskarten mit Maximiliano und Carlotta, wie man sie hier nennt. Der Markt ist ärmlich und schmutzig. Irgendwie hängt eine melancholische Stimmung über der Stadt — oder nur über uns?
Nach kurzer Dämmerung kommt in den Tropen die Nacht schnell und früh. Ich trete auf den Balkon unseres Fin-de-siecle-Hotels und überblicke die nächtliche Plaza Obregön. Von irgendwo plärrt eine Juke-Box „La vida se vale nada...“ — „Das Leben ist nicht wert“ — oder „Das Leben ist nichts wert“ kann man diesen Schlager übersetzen.
„Ich sterbe für eine gerechte Sache. Ich vergebe allen und bitte, daß auch sie mir vergeben mögen. Möge mein Blut für das Gut dieses Landes fließen. ,Viva Mexico.' “ Das waren Maximilians letzte Worte. £La vida se vale nada ...?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!