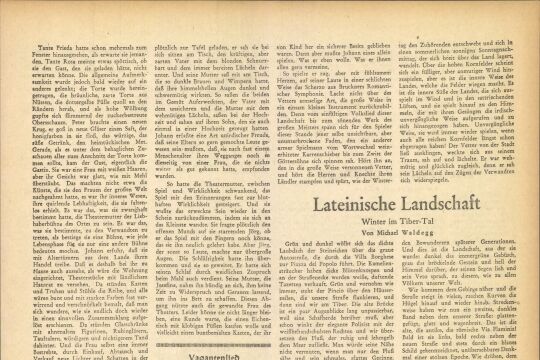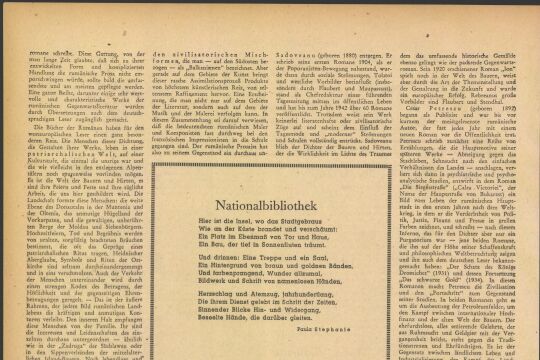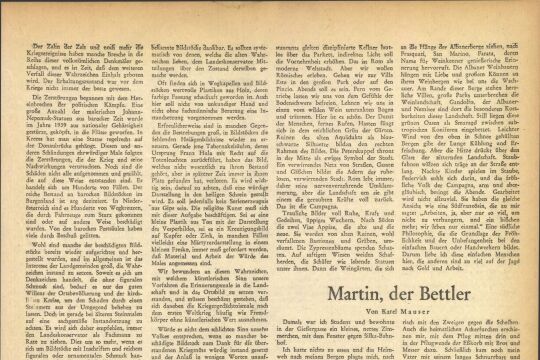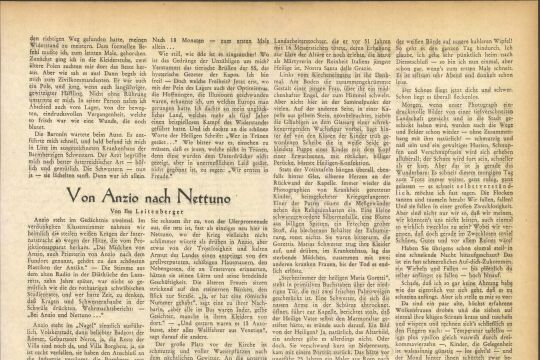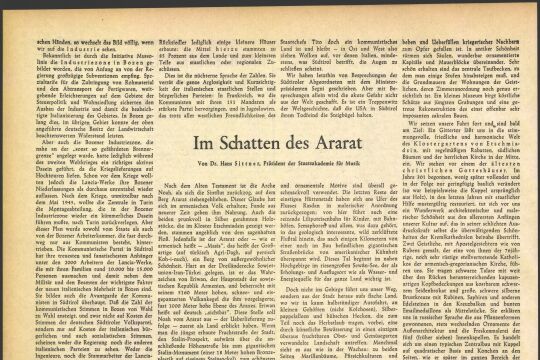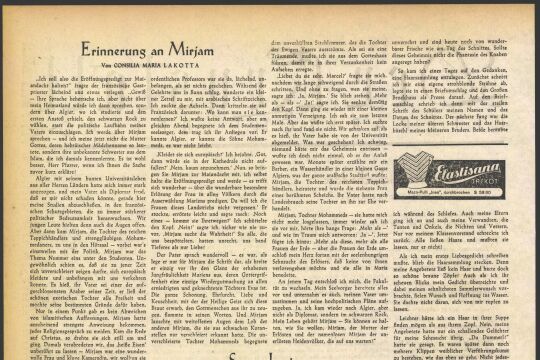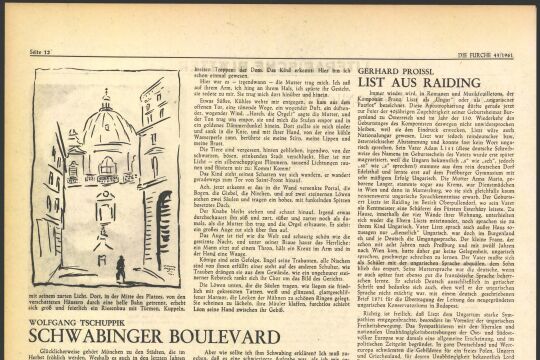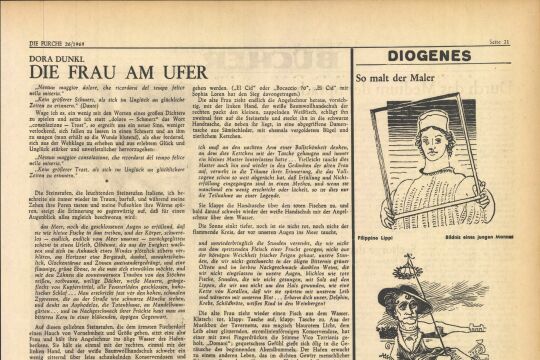DER JUNGE MANN SCHLENDERT, mit dem langen Rohr in der Hand, an dessen Ende ein zittriges Stück glühenden Glases baumelt, von einem Raum in den anderen. Andere laufen umher; ihre Ausweichmanöver angesichts der rot und weiß glühenden Glasklumpen scheinen nicht ungefährlich, aber Schritte und Handreichungen ergeben sich hier wie in einem Ballett, und es passiert nichts. In der Mitte des Raumes bildet ein Ziegelbau mit mehreren hellrot leuchtenden Öffnungen den eigentlichen Schauplatz des Geschehens. Ein Meister hockt da auf einem schmalen Brett, übernimmt flugs das Rohr mit dem Glas aus der Hand des Lehrlings, schiebt es in die Kaminöffnung, zieht es heraus und taucht es in einen Eimer voll Wasser, legt es auf eine Kante und dreht es blitzschnell hin und her, während seine andere Hand mit einer Zange der Vase letzte Formung gibt. Bei alldem fällt kein Wort, nur die Kamine summen und einige Lehrlinge sitzen hoch oben auf einem Podest und baumeln mit den Beinen. Eine gelöste, fröhliche Stimmung weht in diesen kahlen Räumen, obwohl keiner faulenzt, sondern jeder etwas tut, sei es, daß er fertige Vasen, Kristallüster oder Aufsätze noch einmal zurechtschiebt oder daß er dem Meister im passenden Augenblick ein Brett hinhält, an dem die Vase ihren flachen Boden aufgedrückt bekommt.
Durch das schmale Tor sieht man auf die Lagune, die auch hier, auf den Inseln von Murano, durch rötlichbraune Paläste mit weißen Giebelfassungen gesäumt wird. Murano zeigt sich in manchen Teilen als ein rustikales und zugleich kleineres Venedig; in den Barken verschwinden statt der Liebespaare Kisten mit der Aufschrift „Fragile“; an Stelle von amerikanischen Touristen eilen Arbeiterfrauen mit Einkaufstaschen in die Läden, die auch hier, wie überall in Italien, noeh spät am Abend Kunden erwarten. Doch: ein mit mehreren Kameras behängter Amerikaner auf unruhig vorbeieilender Gondel versucht, sein „Motiv“ zu erhaschen. Ein Hupen von allen Seiten, Benzin- und Ölgeruch. Das Museum, das Schätze aus zehn und mehr Jahrhunderten, und alles aus Glas, in seinen Vitrinen beherbergt, ist auf abendliche Besucher nicht vorbereitet. Es brennt kein Licht, und die riesenhaften Glaslüster, Pokale, ja ganze Gärten aus Glas schimmern matt in den dunklen Sälen. Wenn irgendwo, dann in Murano scheint die Zeit stillzustehen: Mit den gleichen Handreichungen, mit der gleichen scheinbaren Unbekümmertheit, die der höchsten Kunstfertigkeit eigen ist, arbeiten hier Venezianer seit Jahrhunderten an Werkstücken, deren Formen zeitlos modern und unverändert kostbar sind.
AUCH DAS IST VENEDIG: grün und grau das Wasser der Lagune, mattgrau der Himmel, am Horizont nimmt man hinter dem leichten Frühnebel schwach die Konturen der Stadt aus, Konturen, die durch die langgezogene Linie der Brücke festgehalten erscheinen. Hier, in der „Porto e zona industriali di Venezia Marghera“, ist Venedigs neues Gesicht erkennbar: Gasometer neben Gasometer, Turm neben Turm, riesengroße Glashallen und dazwischen ein silberglänzendes Gewirr von Rohrleitungen, das so schön ist, daß man gar nicht an seine Funktion innerhalb einer Ölraffinerie denkt. Die Schönheit einer Werkanlage, zumal in Venedig: ist sie nicht schon letzte Zweckerfüllung?
Ammoniak, Sulfate, Aluminium, Blei, siebentausend Arbeiter, Monte- catini, Vego, Breda, Monteponi, ein Hafen, der sich gegen Süden immerfort weiterfrißt, 200 Fabriken, in deren Höfen Glaskäfige für die Raucher (Cabina per fumarc) stehen, und der Markusplatz ist hinter dem gelben Rauch und dem Nebelvorhang weit; nahe und immerfort andauernd ist der Motorenlärm, das Hupen der Motoscafi, der Probealarm der Schriffssirenen. In den Docks liegen Schiffe, die Venedigs Industrieprodukte nach Amerika, China, Japan und Indien tragen werden und nach Rußland Kürz lich weilte der nunmehrige Ministerpräsident der Sowjetunion, Kossy- gin, hier und fand alles ausgezeichnet. Vor 46 Jahren war alles ringsum Sumpfgebiet.
EIN JUNGER GRAPHIKER, der Kinderbücher und Karikaturen zeichnete, kam auf die Idee, daß sich Zeichnungen auf Keramikgegenständen günstiger verkaufen lassen als auf Papier. Der Mann ist Florentiner, und dieser Umstand kam seiner Unternehmung vermutlich in mehrfacher Hinsicht zugute; vor unüberlegter Nachahmung andernorts wird also gewarnt. In Florenz, im Zentrum des toskanischen „Artigianato“, in der Stadt Ghiber- tis und Michelangelos, sieht das so aus: Inmitten einer „biblischen“
Landschaft, in der zwischen graugrünen ölbäumen zu dieser Jahreszeit bereits ins Gelblich-Rötliche hinüberwechselnden Weinreben und dunklen Zypressen mattgelbe Villen den Ton angeben, steht die Halle der Keramikfabrik „Quadrifoglio“, eine von den dreitausend kunstgewerblichen Werkstätten der Provinz. Der junge Inhaber zeichnet alle Entwürfe selbst und gibt sie seinen geschulten Graphikerinnen weiter, räumt aber diesen bei der Bemalung der Einzelstücke weitgehende Freiheiten im Detail ein. So entstehen also Keramiken, deren Originalität auch darin besteht, daß sie auch innerhalb der Serie einander nicht unbedingt gleichen. Es sind dies hauptsächlich Gegenstände für das Kinderzimmer: Sparschweinchen schön bunt bemalt, Tafeln zum Zeichnen, Küchengarnituren, Töpfe und Fässer für verschiedene praktische Zwecke für den anspruchsvollen Käufer, etwa bei dem Londoner Haarrods oder dem amerikanischen Sacks Hier sieht man also etwas, was für das ganze toskanische Handwerk charakteristisch sein soll. Es gibt keinen florentini- schen Stil im Sinne der Folklore; so wie die alten, haben auch die heutigen Künstler und Handwerker — späte Nachfolger etwa der della Robbias — durchweg ihren persönlichen Stil zwischen Moderne und Tradition, und es ist immer der Künstler, der letzte Hand anlegt, mag auch bei der Fertigung die Maschine heute eine gewisse Rolle haben. Das ist so bei der Keramik, bei Stroh, bei Lederarbeiten, bei Spitzen oder Textilien. Und die Florentiner waren immer auch Händler; sie haben die Rohstoffe importiert und nach eigenem Geschmack gestaltet; sie haben kleine Handwerkergemeinschaften gebildet, besonders in Krisenzeiten, aber den Großbetrieb nie gemocht; sie sind Individualisten geblieben. Das war immer schon so, ob Medicis oder „Lothringer“ den Palazzo Pitti bewohnten
EIN KURZES KLINGELZEICHEN und viele hunderte kleine brünette Mädchen und Frauen laufen wie eine aufgescheuchte Gazellenherde den Ausgängen zu: es ist Nachmittag halb fünf, Arbeitsschluß in der Kleiderfabrik Lebole in Arezzo, in einer ultramodernen, erst sieben Jahre alten Fabrik mit zwei großen Hallen, in der zu 99 Prozent junge Frauen beschäftigt sind; der Betrieb erzeugt Herrenkonfektion, aber es ist keine „gewöhnliche“ Konfektion. Der berühmteste Schneider Italiens, Angelo Litrico, der einmal auch für Chruschtschow gearbeitet hat, überprüft die Modelle und instruiert die Zuschneider; die Arbeiterinnen am Fließband singen oder plaudern miteinander, sie können ihre Plätze wechseln, es ist durchaus nicht alles genormt. Und es wird erstaunlich viel mit der Hand, ohne Maschinen gemacht. „Die menschliche Note“ wird, sowohl in der Fabrikation selbst wie in der Behandlung der Menschen, die hier arbeiten, vorgezogen. 3000 Arbeiter und Angestellte stehen da für eine Million Anzüge und Mäntel pro Jahr gerade; 95 Prozent davon bleiben im Land, fünf Prozent werden exportiert. Eine Arbeiterin bekommt 50.000 Lire im Monat, die Suppe zum Mittagessen im riesenhaften Speisesaal umsonst, und ihr Kind bekommt einen Urlaub am Meer. Die Knopflochmaschine näht ein Knopfloch in vier Sekunden, Knöpfe werden in zwei Sekunden aufgenäht. Die Mittagspause dauert eine Stunde, und auch Samstag vormittag wird gearbeitet. Wann gehen die Frauen zum Friseur? Am Sonntag. Wer kauft für sie ein? Die
Geschäfte sind bis am späten Abend offen.
Nach sechs Uhr abend auf der Bastei der Medici-Burg. Liebespaare, eine alte Frau sitzt auf der Bank und ißt Weißbrot mit Paradeisern, an der Wand eines Häuschens eine Marmortafel, auf der das Ereignis verewigt ist, daß ein gewisser Conte Enrico Falciai Fossombroni, königlicher Senator, diese Festung der Stadt Arezzo zwecks öffentlicher Benutzung im Jahr 1893 testamentarisch vermacht habe. Daneben: Carla-Oianni - 31-5-64 - felici, und mit Riesenbuchstaben, rot: HILDA. Ein kühler Wind schlägt Rauch aus den Schornsteinen auf die Felder, über die sich bereits der Nebel breitet. Auf den Bergen rötliche Flecke, das ist herbstliches Laub, sonst dominieren Schwarz, Blaugrau und Blaugrün. Motorengeräusch von überallher. Petrarca steht im weißen Marmor, auf einem hohen Sockel, der mit all seinen symbolischen Nebenfiguren an die Plakate aus der Zeit des ersten Weltkrieges erinnert. Unter Petrarcas Kutte lugt aber ein volles
Frauengesicht hervor. Wieso das? Auf übrigens recht bescheidenen Plakaten steht meistens: Vota comunista! Hie und da auch:
Liberias! Provinzwahlen stehen vor der Tür.
ZWEI KILOMETER LANG IST DER WEG, der auf schmalen Brücken und hohen Stegen über den
Maschinen der beinahe vollmechanisierten Fabrik Perugina führt, unter den Glaswänden der riesigen Hallen. Draußen viele Hunderte von Fahrzeugen der Belegschaft, in einer Nursery nahe der Hauptfront werden 300 Arbeiterkinder betreut. Die Hausbibliothek stellt allen Beleg- sohaftmitgliedern Kunstbücher und Lexikas, Romane und Sachbücher kostenlos zur Verfügung. Unterhalb des Steges wird der Lärm ohrenbetäubend. Arbeiter kippen den Inhalt von Blechformen, die auf dem Fließband in dichter Reihe an sie herankommen, in Behälter und werfen die leeren Formen auf ein höher laufendes Fließband, und das acht Stunden lang! Was macht ein solcher Arbeiter mit seinen Armen nach der Arbeit? Der berühmte Film Chaplins — dessen Memoiren in diesen Wochen in allen Buchauslagen Italiens zu sehen sind — gibt dafür einen Hinweis In allen kleinen und größeren Städten Italiens weisen farbige Neonlichter auf die neuesten Kreationen der Schokoladefabrik Perugina von Perugia, der Stadt Peruginos und Pinturicehios, hin, denn auch das Weihnachtsfest ist schon nahe.
ES WAR MUSSOLINI, der gegen das Ende seiner „brüllenden Jahre“ („anni ruggenti“) auch noch eine Weltausstellung in Rom für das Jahr 1942 plante. Es kam anders, aber die Paläste, die zu diesem Zweck vorsorglich gebaut wurden, stehen da und beherbergen hinter ihren etruskischen und römischen Formen Institutionen des Staates, wie übrigens auch manche der umliegenden, von Nervi oder anderen berühmten italienischen Architekten gebauten Glas- und Metallblöcke. An einem dieser Häuser wird gebaut, hunderte Arbeiter klettern auf Leitern, montieren, streichen an, schieben und ziehen Kisten, legen Fußböden. In diesem selben Haus arbeiten über 1000 Techniker und Ingenieure in einem großen Planungsbüro für Erdölraffinerien. Die Pläne für 150 solche Anlagen wurden bereits geliefert, Amerikaner, Belgier und Italiener arbeiten hier an Reißbrettern, mit IBM- Apparaten in fünf Stockwerken, während das Haus erst nach einem halben Jahr ganz fertig sein wird. Ein junger italienischer Ingenieur erklärt schnell und präzise das Programm eines elektronischen Rechenautomaten für Datenverarbeitung und blickt inzwischen zum Fenster hinaus, sein Blick streift die blauen Albaner Berge, aber man kann nicht wissen, ob er sie sieht. Er gehört nämlich einer Generation an, der man gewöhnlich jede Neigung zur Poesie abspricht. Auch in Rom, 1964.