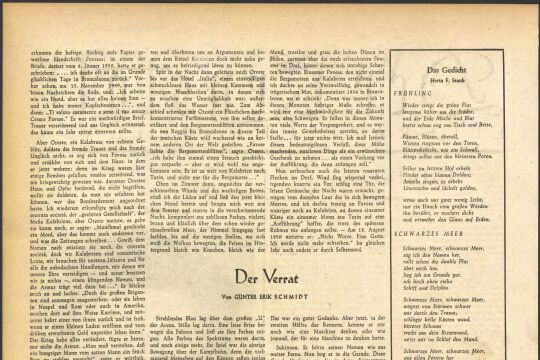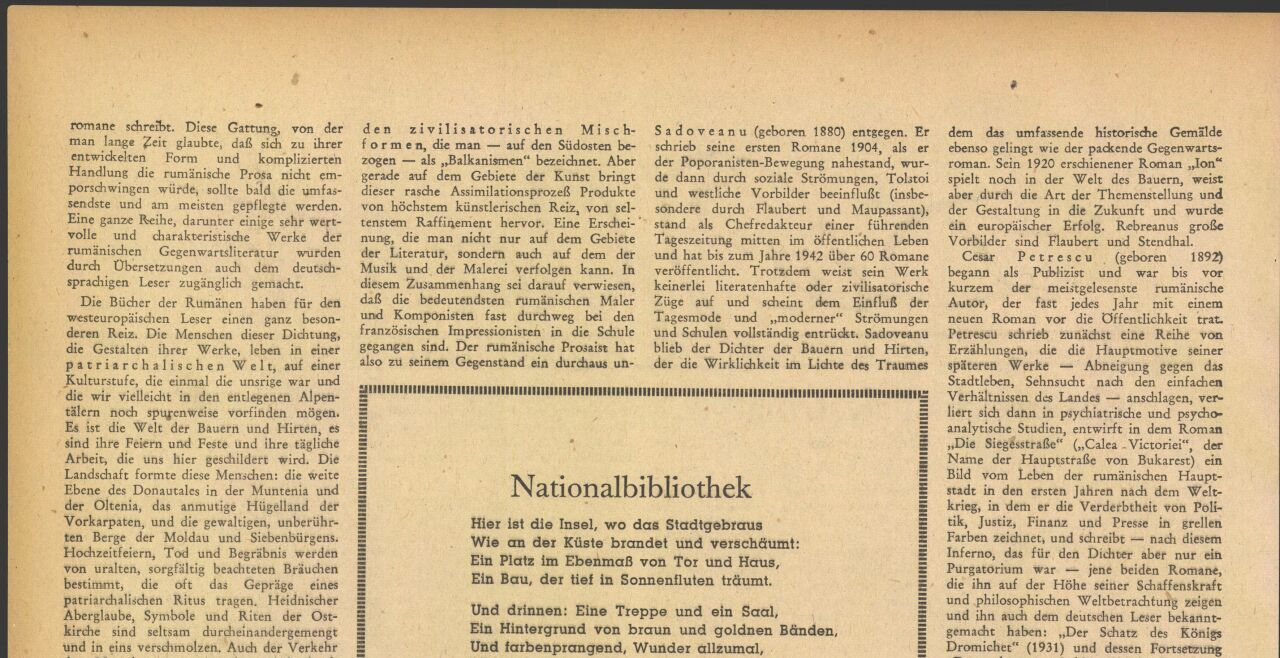
Daß Venedig eine Insel ist und nicht a m, sondern i m Meere liegt, haben wir alle in der Schule gelernt. Es erschien uns damals schon etwas seltsam, aber wir nahmen es zur Kenntnis. Daß man beim Besuch der Lagunenstadt diese Schulweisheit so wundersam bestätigt findet, soll hier weder erneut festgestellt, noch ausführlicher erörtert werden. Aber daß Venedig auch im letzten Krieg, in diesem so umfassenden und alles in seinen Bann ziehenden Krieg, Insel geblieben ist, und zwar Insel des Friedens in jeder, auch in geistiger Beziehung, d a.s ist wesentlich und verdient Beachtung.
Venedig ist schon in friedlichen Zeiten, und selbst für den abgebrühten Reisenden, immer wieder ein Wunder und immer wieder ein Erlebnis. Man mag noch so lächeln, wenn am Markusplatz die berühmten Taubenfotos geknipst werden, man mag die Kanäle übelriechend, die Hitz£ unerträglich und die Gondelpreise unverschämt finden — man bleibt dennoch nicht unbeeindruckt. Wie aber war das im Krieg! Ein Erlebnis mag hier für viele stehen und das Grundsätzliche des „Wunders Venedig“ zu schildern versuchen: Sommer 1944. Der Zug fährt durch Kärnten der Grenze zu. In Tarvis wird es Nacht. Zwei Stunden später — es ist ja Sommer 1944, die Fronten sind bei Florenz, in Griechenland und am Atlantik! — taken Maschinengewehre links und rechts des Zuges: Partisanen! In Udine laden wir Tote und Verwundete aus. Es wird hell. Ein paar Kilometer vor Mestre sind Tiefflieger über uns. Der Zug brennt, wieder fließt Blut. In Mestre ist Fliegeralarm vom ersten Sonnenstrahl bis zum letzten
Dämmerschein. Straßenweit keine lebende Seele, Ruine reiht sich an Ruine. Die Öltanks sind eine formlose Blechmasse in einem bombenzerwühlten Gelände. Die Bahnlinie nach Padua ist bestenfalls einmal in der Woche für einen Tag in Ordnung. Kein Autobus wagt sich über die Dammstraße nach Venedig hinüber. Der Krieg hat das Land in seinen eisernen Fängen und nicht eine Minute lang kann man ihn vergessen oder übersehen. Dann aber, es wird Abend, sind wir „drüben“! Die Gondel gleitet durch den Canale Grande. Form und Farbe wie ehedem. Bunt und belebt ist alles. Die Piazza ist voll von Menschen. Die Tische und Stühle der Kaffees stehen, wie sie immer standen, vor den Säulengängen der Prokurazien. Die Läden sind offen und — voll mit Waren. Die Menschen sind fröhlich und elegant. Draußen, in der Lagune, Boot an Boot. Die Dampfer fahren nach Murano hinüber und zum Lido, wie sie es immer taten. Selten nur eine Uniform, selten ein deutsches Wort. In den Lokalen höfliche Kellner, vornehm wie immer. Man glaubt zu träumen und will den Traum gewaltsam beenden, ihn durch eine Provokation ad absurdum führen: man bestellt einen Whisky. Der Kellner in Frack bringt ihn und es ist wirklich einer. Man traut der Wirklichkeit immer noch nicht und speist bei Quadri. Niemand fragt nach Marken, wohl aber nach den Wünschen. Und von der Antipasta bis zu den Früchten ist alles, wie es immer war, lang vor dem Krieg. Wo aber ist dieser Krieg plötzlich? Lag man nicht noch am Morgen drüben im Maisacker vor Mestre, als die Geschosse der Bordkanonen rundum einschlugen? Sah man nicht
vor zwei Stunden noch die vom Entsetzen und panischer Angst gepeinigten Antlitze der Frauen und Kinder? Das Inferno der Bombardements? Wo blieb das alles? Wo ist die Grenze?
„Für Wehrmacht verboten“
Die Grenze verlief auf der Autostraße, die über den neuen Straßendamm nach Venedig führt. Im zweiten Drittel der Brücke war ein . Schlagbaum errichtet, daneben eine kleine Bretterbude. Hier amtierte die Wehrmachtstreife. Venedig war eine „verbotene Stadt“. Nur mit Sondererlaubnis konnten Wehrmachtsangehörige, auch hohe Offiziere, in die Stadt gelangen. Und stets nur für kurze Zeit. Rom war niemals verbindlich zur „offenen Stadt“ erklärt worden und die Nutzung strategischer Möglichkeiten an seiner Peripherie zog die alliierte Luftwaffe an. In Florenz gab es zwar viele Schilder mit der Aufschrift „Für Wehrmacht verboten“, aber es gab zu jeder Zeit und in allen Straßen mehr deutsche Soldaten, als Florentiner. Padua und Vicenza, Verona und Brescia würden heute nicht so schmerzliche Lücken in ihren unvergleichlichen Straßenbildern zu betrauern haben, wäre dort nicht überall die deutsche Wehrmächt daheim gewesen. Venedig aber blieb nahezu unberührt. Freilich lagen ein paar kleine Marineeinheiten in der Lagune und sah man da und dort ein paar Mann ihrer Besatzungen durch die Straßen bummeln, freilich gab es eine Kommandantur und ein paar mehr oder minder getarnte Stäbe, aber das war auch schon alles. Und die vielen Soldaten, die so gerne der bitteren Verpflichtung, in diesem
Lande Krieg führen zu müssen, wenigstens das freudvolle Erlebnis Venedigs abgerungen hätten, konnten, zwischen zwei Luftangriffen vielleicht, höchstens einen Schimmer der Konturen erhaschen, die, nah und doch so fern zugleich, jenseits des zerbombten Mestre zu sehen waren. Die Absperrung war streng Bnd ausnahmslos. Aber die Sorge um die sthöne Stadt, um die Betonung ihres Charakters als „Citta aperta“ war nebensächlicher Natur. Ganz etwas anderes stand im Vordergrund:
Die gefährliche Atmosphäre
Venedigs unwirkliche Schönheit macht weich. Seine Luft atmet Verträumtheit und Frieden. Ihr Anhauch mußte jeden, der aus dem rundum tobenden Krieg in den Zauberkreis ihrer Bewahrtheit trat, aus dem Gleichgewicht bringen. Die mühsam konstruierte „Grundhaltung“ des deutschen Soldaten, daß Krieg erstens notwendig, zweitens schön und drittens „gesund“ sei, mußte hier in der ersten Brise zerschmelzen und zerfallen. Deshalb blieb Venedig gesperrt. Nur kleine Gruppen und Kommandos, die man für yertrauenswürdig genug oder ohnehin schon hoffnungslos pazifistisch verseucht hielt, durften hier ihren Sitz haben. Die ganze Heeresgruppe beneidete sie und Generale und Stabsoffiziere dachten wochenlang über einleuchtende Gründe nach, um eine Dienstfahrt nach Venedig antreten zu können. Hier war, der Friede nie abgeschafft worden. Bis in die allerletzte Zeit flogen noch Zivilflugzeuge von Venedig nach Wien und nach München. Die Fahrscheine dafür wurden im offiziellen Büro der „Lufthansa“ verkauft und jeder, der ein klein wenig Beziehungen zu den Kreisen des Konsulates hatte, konnte sie bekommen. Denn auch ein Konsulat gab es hier noch und sehr viel diplomatisches Personal dazu. Viel zuviel für ein Konsulat und es gab niemanden, der dran glaubte und nicht auch wußte, daß hier sehr viel „überwacht“ wurde ... !
Hier wurden viele Wehrmachtszeitungen gedruckt. Zwar war das umständlich für den Transport an die Front, zumal Venedig im letzten Kriegsjahr fast ganz von der Außenwelt abgeschnitten war, weil sämtliche Bahnlinien Tag für Tag mit Bomben belegt wurden. Aber immer wieder fanden die Hersteller dieser Frontzeitungen Ausreden und Gründe, um in Venedig bleiben zu können. Hier wurden sie alle zu Defaitisten und Pazifisten! Sie druckten den Wehrmachtsbericht und Fritsches Kommentare zur Lage, aber sie schrieben in ihren Hotelzimmern längst schon andere Sachen! Den Künstlern und Dichtern, die „draußen“ in dem vom Krieg zerwühlten und unterjochten Europa jeden Mut verloren und mit jedem Tag stummer wurden, ging hier das Herz wieder auf, sie spürten das Leben wieder und daß es lebenswert sein konnte. Rudolf Hagelstange, der begabte Lyriker, brachte es im Herbst 1944 zuwege, auf ein paar Wochen nach Venedig- kommandiert zu werden. Er, der damals von sich sagte „Ich habe lange, lange wie ein Stein geschwiegen...“ schrieb sich in diesen wenigen Wochen den so inhaltsschweren Sonettenkranz „Venezianisches Credo“ vom Herzen (siehe „Die Furche“ Nummer 4 und 6).
Lido hinter Stacheldraht
Freilich war vieles verändert, auch auf dieser friedlichen Insel. Vor allem t das Publikum! Zwar hatte sich viel von der guten italienischen Gesellschaft hieher zurückgezogen, aber doch auch mandi fremdes Element dazu: im „Danieli“ wohnten die hohen Stabsoffiziere, die Generale und die „vornehmen“ Zivilisten, die „in Sachen Reidi“ reisten, meist Rüstungsfachleute, Aufkäufer oder Spitzel, sehr oft auch alles in einer Person waren. In der Bar gab es alle Getränke wie einst, aber der Speisesaal wirkte frostig und ernüchtert. Hier waren nur mehr die Ober vornehm, die behutsam und dezent vorlegten und die Bestellung erbaten, während die noblen Gäste dann meist mit schnarrender Stimme ihren Dolmetscher fragten „Was will der Kerl eigentlich ... ?“.
Draußen auf dem Lido war man dem Krieg wieder näher. Zwar wurde unbesorgt gebadet und gespielt, auch getanzt und geflirtet, aber nur an einigen wenigen Stellen konnte man ins Wasser gehen — der lange, weite Strand war von Stacheldraht umgeben, Flakbatterien standen vor den Riesenhotels, in denen zum Teil die Luftwaffe wohnte, zum Teil aber auch noch ein paar Filmstars und ein paar illustre deutsche Gäste hausten. Exerzierende Soldaten vor dem „Exzelsior“, feuernde Flakgeschütze zwischen ruhig am Strand liegenden Badegästen, die sich an die Schießerei längst gewöhnt hatten — es war ein eigenartiges Bild!
Die Invasion der Überlebten
Nach der Befreiung Roms durch die Alliierten war Venedig zur Zuflucht der „Gestrigen“ geworden, der großen und mittleren Faschistenführer und faschistischen Politiker, die auf der Flucht nach dem Norden schließlich auch erfahren hatten, wo keine Bomben fielen und man noch echten Mokka trinken konnte, ohne dreimal mit den Augen zu zwinkern und das Zwanzigfache des Preises an Trinkgeld zu geben. Vor allem im Hotel „Luna“, in friedlicheren Zeiten durch srtnen aparten Tanzsaal bekannt, hatten sich die Journalisten der vormals römischen Blätter, die Unterstaatssekretäre und entthronten Präfekten, die Gauleiter und Milizführer einquartiert. Mit Kind und Kegel und ziemlich viel Angst im Herzen. Zunächst taten sie alles, Jim nachzuweisen, daß sie nur in Venedig „arbeiten“ konnten und sonst nirgends. Als im Winter 1944/45 aber die Lage bedrohlicher, das heißt eindeutiger wurde, entwickelte sich Venedig zur „Mausefalle“ — man brauchte ja nur den Damm zu sperren und alles war gefangen. Als diese Erkenntnis erst Platz gegriffen hatte, setzte eine wilde Flucht aus Venedig ein. Auch die paar deutschen Kommandos, die seit zwei Jahren in Venedig saßen, riefen nach Verlegung. Aber es gab keine anderen „guten“ Plätze mehr: außerhalb war Krieg, erbarmungsloser, harter Krieg. Die Städte der „terra ferma“ waren bereits zerstört und verwüstet, die Alliierten rüsteten zum Sturm auf den Po und in den oberitalienischen Bergen warteten die Partisanen auf die „Stunde X“! Damals verließen auch die Filmschauspieler Venedig, die man mit vieler Mühe dort zusammengerufen hatte. Auf dem Gelände der Internationalen Filmausstellung hatte man bescheidene Ateliers eingerichtet, hier sollte nicht nur die
„Cinecitta“ neu erstehen, die Herrn Goebbels Beauftragte in Rom so erfolgreich ausgeplündert hatten, sondern auch der deutsche Film sollte hier in Ruhe arbeiten können. Aber Schauspieler und Personal machten mit so viel Erfolg passive Resistenz, daß auch die Betriebsamkeit eines Luis Trenker und anderer Größen nichts dagegen machen konnten.
Bomben und Propaganda
Herr Goebbels hatte alle Ursache, mit Venedig unzufrieden zu sein. Die Filmstadtidee klappte nicht, die venezianische Luft verdarb ihm seine besten Leute, der Pazifismus hatte hier eines seiner stärksten Bollwerke und außerdem tat ihm kein alliierter Pilot den Gefallen und ließ eine Bombe auf den Dogenpalast fallen oder auf den Markusdom. Soviel wäre ihm der „Aufschrei der kultivierten Welt“, den er sogleich bestens in Szene gesetzt hätte, wert gewesen. Nur ein Hotel flog in die Luft und eine ganze Gruppe Gestapospitzel und Agents provocateur mit ihm. Das waren natürlich „Banditen“ und Partisanen, die das am Gewissen hatten, aber viel Propaganda ließ sich damit nicht machen. Also stellte man wochenlang ein als Lazarettschiff verwendetes Kriegsschiff in die Lagune, unmittelbar vor den Markusplatz, obwohl es dort wahrlich nichts zu tun hatte. Und endlidi hatte man dann auch die Bomben — gottlob gingen ein paar Scheiben des Dogenpalastes mit in Trümmer und der „Aufschrei“ konnte starten. Aber ganz Italien lächelte und die Venezianer gingen auch nachher nicht in die kleinen Luftschutzbunker, die sie „Familiensärge“ nannten. Sie blieben ruhig bei ihren Geschäften oder beim Aperitif in den Prokurazien sitzen, wenn Alarm war. Denn hier war kein Krieg. Hier war nur: Venedig!