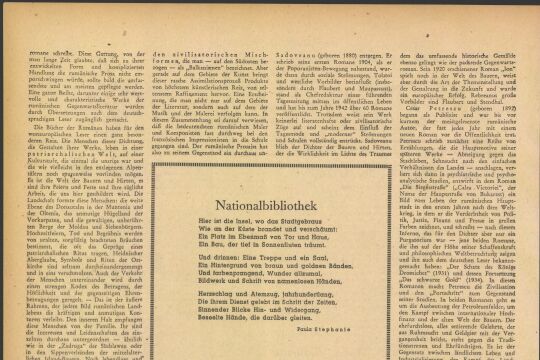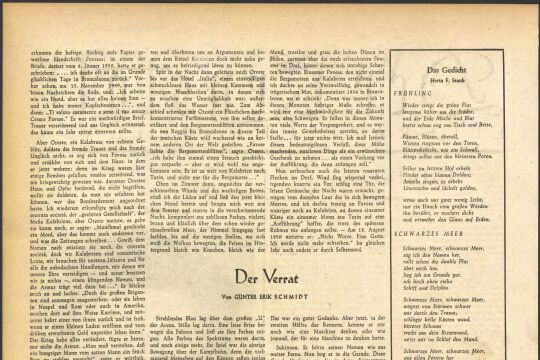Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
DER ALTE HAFEN VON MARSEILLE
Man behauptet, die heutige Generation habe keinen Sinn mehr für das Wunderbare. Vor 120 Jahren stellte sich der kleine Sohn des Vikars von Market Harborough das Meer als ein silbernes Tuch mit goldenen Kronen vor und den Oberbürgermeister von London als eine übermenschliche Gestalt — als eine richtige große Schildkröte, in einen Hermelinmantel gehüllt. Der gleiche Junge würde sich heute kaum solche phantastische Vorstellungen machen: Im Kino sieht er die nördlichen Meere in dunklem Zorn gegen die Küste branden und die tropischen Meere von den Leibern fliegender Fische und Delphine aufleuchten. An Sonntagabenden hört er vor dem Fernsehschirm den Oberbürgermeister die „guten Werke” verkünden, die der Christ in der folgenden Woche tun sollte.
Es ist unvermeidlich, daß die Vorstellungskraft der heutigen Jugend geschmälert ist. Im Film oder im Fernsehen beobachtet sie, wie die Papuafischer unter den Palmen ihre Netze trocknen. Auch das Entfernteste ist ihr vertraut, nichts Ungewöhnliches kommt ihr unerwartet, nichts Unmögliches erscheint ihr mehr unwahrscheinlich. Für sie gibt es zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten keinen Schleier der Illusion mehr.
Auch hier war es der Krieg, der die große Wandlung geschaffen hat: Was wußte der kleine Sohn des Vikars von Liao-Yang, von Magersfontein oder gar von Gheluvelt? Als die Erde unter dem Einschlag von Bomben erzitterte, hätte auch sein Bettchen einen Satz auf dem Linoleumfußboden gemacht und die Fenster wären am Morgen ein Splitter haufen gewesen. Denn wir haben uns alle daran gewöhnt, daß während des Krieges das Ungewöhnliche das Altgewohnte verdrängte, und wir waren nicht weiter überrascht, zu erleben, wie Heime und Gebäude zerstört wurden, die wir seit unserer Kindheit gekannt haben und deren Atmosphäre uns vertraut gewesen war. Aber das war nicht immer so. Selbst mitten im Krieg waren wir noch erstaunt, wenn die Kriegsfurie Gebiete heimsuchte, die zu unserer Vorstellungswelt gehörten.
So erinnere ich mich, wie ich am Anfang des ersten Weltkrieges mit einem Mann in einem braunen Anzug von Sevenoaks in Kent nach London reiste. Er nahm mir gegenüber im Abteil Platz, rückte die rosa Rose in seinem Knopfloch zurecht, stand noch einmal auf, um seinen Hut ins Gepäcksnetz über sich zu legen und entfaltete dann seine Zeitung. Einen Augenblick später machte er einen Ausruf des Ärgers und der Verwunderung. „Das ist ja geradezu unglaublich!” rief er aus. „Ich kann das einfach nicht glauben !” Ich blickte ihn gelassen und höflich fragend an. „Haben Sie das gelesen?” wollte er in ärgerlichem Erstaunen wissen. „Die Deutschen haben Namur besetzt, wo meine Frau und ich. erst letzte Ostern herumgeradelt sind. Ich kann es einfach nicht glauben.” Ärgerlich steckte er die Zeitung unter das Sitzkissen hinter sich. „Unglaublich”, murmelte er mit aufgebracht geröteten Wangen vor sich hin. Während der Zug durch einen Tunnel fuhr, hatte er eine verwirrte und geradezu beleidigte Miene aufgesetzt. Dann begann er von neuem. „Sehen Sie, ich entsinne mich noch genau, als wäre es gestern gewesen. Da waren Klippen, ein Fluß und ein kleines Gasthaus am Ufer, mit einem gestreiften Sonnen dach und grün gestrichenen Blumenkübeln. Und jetzt mögen da, ja vielleicht an dem gleichen Tisch, wo wir unseren Kaffee tranken, die Ulanen sitzen! Ich kann es einfach nicht glauben. Für midi ist das alles unfaßlich.” Der Krieg war für diesen biederen Mann bislang etwas Transozeanisches gewesen. Plötzlich hatte der Begriff Krieg für ihn eine kontinentale Bedeutung bekommen. Er seufzte immer noch, als der Zug London Bridge erreichte.
Schon einige Stunden später waren die Ulanen in andere vertraute Gegenden vorgestoßen: Lüttich, Brüssel und dann Ostende. Ich habe meinen Freund mit der rosa Rose nie wiedergesehen. Vermutlich ist er in Kitcheners Armee eingetreten oder an der Somme gefallen. Aber die Entrüstung, die er an jenem Morgen empfand, ist mir seitdem oft widerfahren. So, als ich an jenem Sommertag des Jahres 1942 durch die Ruinen von Temple Church und Crown Office Row ging und zu mir sagte: „Das ist doch unglaublich. Ich kann es einfach nicht glauben” — genauso wie der Mann im braunen Anzug 28 Jahre zuvor.
Im allgemeinen haben wir uns damit abgefunden, daß das Ungewöhnliche sich mit unseren gewohnten Vorstellungen vermischt. Ich erinnere mich noch, wie wir in jenen Kriegsjahren zum Beispiel Bilder von Hitler sahen, wie er grinsend in der Madeleinekirche stand oder in dramatischer Pose von der Terrasse des Trocadero auf das gewaltige Stahlgerüst des Eiffelturms starrte. Wir fühlten zwar äußersten Widerwillen, waren aber nicht weiter erstaunt. Wir nahmen es auch nicht als verwunderlich hin, daß italienische Karabinieri den Zugang zur Akropolis in Athen bewachten, noch regte es uns irgendwie auf, deutsche Schildwachen auf der Place Vendöme zu sehen. Wir waren bereits abgehärtet gegen Erscheinungen, die der Würde Europas Gewalt antaten. Dann aber geschah plötzlich etwas, was unsere geduldige Hinnahme erschütterte. Wir fühlten einen solchen Zusammenstoß zwischen vertrauten und ungewöhnlichen Dingen, daß es uns den Atem verschlug — wie dem Mann im braunen Anzug an jenem Augustmorgen 1914.
Einer solchen Empfindung erinnerte ich mich beim Durchblättern meines Tagebuches, als ich auf das Datum des 29. April 1942 stieß.
Damals hatte die SS den alten Hafen von Marseille besetzt und die Bevölkerung dieses Viertels aus ihren Häusern vertrieben. Über den Pariser Rundfunk ertönte die Stimme von Paul Creyssel, einem der Propagandagrößen der „Feuer- kreuzler”. Er sagte: „Selbst wenn die deutschen Militärbefehlshaber die Räumung nicht erzwungen hätten, was sie aus Gründen getan haben, die uns unbekannt sind, selbst dann würde die französische Regierung der Zivilbevölkerung den Befehl erteilt haben, die Nachbarschaft des Hafens zu verlassen. Das Gebiet von Marseille ist so dicht bevölkert, daß im Falle eines Luftangriffes Tausende von Zivilisten das Leben verlieren würden.” Ich konnte es damals verstehen, daß die Deutschen vielleicht den Wunsch hatten, den alten Hafen von Marseille in einen bombensicheren Bunker für ihre U-Boote auszubauen. Was ich aber-nicht verstehen, konnte, war, daß es in ihren Augen notwendig gewesen sein sollte, die Zivilbevölkerung aus der Nähe dieses versteckten Unterschlupfs zu entfernen. Ės hätte mich aber-bei” nahe krank gemacht, als ich mitanhören mußte, wie ein Franzose diesen Akt, der dazu noch mit Rücksichtslosigkeit durchgeführt wurde, verteidigen konnte.
„Dieses Stadtviertel von Marseille…” — Creyssel (der später als Kollaborateur hingerichtet wurde) tat gerade so, als ob er von dem Bassin D’Arenc spräche, wo die großen Ozeandampfer vor Anker liegen. Der alte Hafen jedoch bedeutet etwas mehr als bloß 70 Hektar Hafenfläche, umgeben von Kais und belebt durch die Masten kleiner Boote. Dieses alte Hafenviertel war mehr als der sonnigste Platz Europas, wo die Frauen an den Fenstern einander zusangen. Aber Creyssel schien sich nicht der Zerstörung bewußt zu sein, als er von diesen historischen Stätten als einem bloßen Stadtviertel sprach.
Der alte Hafen Marseilles war ein Handelsplatz bereits in einer Zeit, da noch niemand etwas von London oder Paris wußte. Er war älter als 3000 Jahre. Hierher kamen die Insel-Griechen nach der persischen Eroberung der Ionischen Inseln. Sie warfen einen Eisenbarren ins Meer und gelobten, nie mehr nach Kleinasien zurückzukehren, es sei denn, daß dieses Eisenstück auf den Wellen schwimmen würde. Sie kehrten nie zurück. Sie gestalteten den alten Hafen zu einem Außenposten griechischer Zivilisation im Lande der westlichen Barbaren. Sie bauten Tempel, Lagerhäuser und Sportforen. Sie errichteten Zweigkolonien in Nizza und Antibes. Die berühmte Straße, die vom Zentrum Marseilles zum alten Hafen führt, trägt noch ihren griechischen Namen. Creyssel hatte zweifellos von der Cannebiėre gehört und wußte die antike Bedeutung des Wortes zu würdigen. Die alte griechische Siedlung im Gebiet des alten Hafens überstand selbst die von Julius Cäsar befohlene Zerstörung, der erzürnt war, weil die Bewohner von Marseille sich mit Pompejus verbündet hatten. Sie blieb ein Mittelpunkt griechischer Kultur auch dann, als die übrige Gallia Narbonensis wieder in Barbarei versank. Der junge Agricola, der Schwiegervater des Tacitus, kam später dorthin, um die griechische Sprache zu erlernen. Er ging nicht nach Athen, sondern besuchte Schule und Forum des alten Hafens, der noch in römischen Zeiten unter dem schönen Namen Alycidon bekannt war. Und dann, in jener Stunde der Erniedrigung Frankreichs, wagte es ein Creyssel, Parteimitglied der „Feuerkreuzler” und Sprecher von Radio Paris, von diesem Viertel beiläufig als von „diesem Stadtviertel” zu sprechen.
In solchen Augenblicken, da die stolzeste Vergangenheit von einer unwürdigen Gegenwart beschmutzt wird, bemächtigt sich zorniges Erstaunen unserer Seele. Die SS fand es damals nicht einfach, Alycidon zu räumen und zu sprengen. Sie mußte Artillerie auffahren, bevor die Männer sich in Bewegung setzten. Die laut schreienden Frauen und Kinder wurden von der Gestapo aus ihren Häusern geschleift, den Hafenkai und die Cannebiėre entlang. „Massili” — wenn es mir erlaubt ist, einen der ältesten römischen Dichter unrichtig anzuführen — „portabant juvenes de litore tanas”. Hallte kein Wort von Ennius’ Prophezeiung damals in den Ohren jenes Herren Creyssel wider? Doch die Ohren solcher Menschen sind taub — heute wie damals
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!