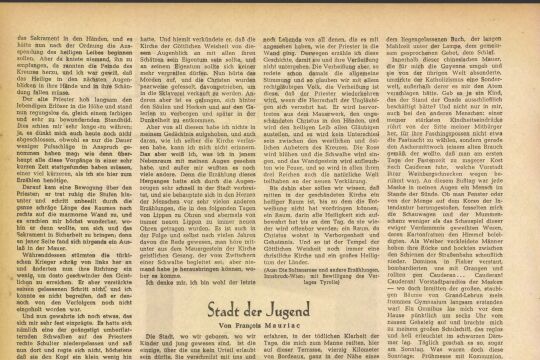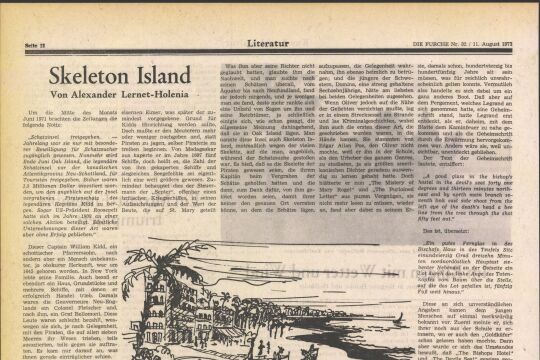Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tramp über zwei Kontinente
VOM STANDPUNKT AUSGEHEND, daß man als junger Mensch nichts verlieren, aber alles gewinnen kann, packte ich — allen Pessimisten zum Trotz — meinen Rucksack, um eine viermonatige Amerikareise zu starten. Von der genauen Reiseroute machte ich mir nur eine vage Vorstellung, da ich von meinen früheren Fahrten wußte, daß man dies als Tramp am besten dem Zufall überläßt und nicht starrköpfig im vorhinein das tägliche „Plansoll“ errechnet. Eines stand jedoch fest: New York als Ausgangspunkt und Rio de Janeiro als Ziel. Das Dazwischen legte ich
In den Schoß einer höheren Macht. Ein Unternehmen also, das leicht ins Auge hätte gehen können! Dessen ganz und voll bewußt, überließ ich jedoch das „Wenn“ und „Aber“ den Pessimisten und stürzte mich, blind vertrauend auf mein Glück, ins Abenteuer.
Per Zug nach Rotterdam, Übernachtung im Seemannsheirn und acht Tage auf einem Ozeanriesen.
Als ich am 15. Mai in New York von Bord ging, war mir, als fiele ich vom Himmel zurück auf den Boden harter Wirklichkeit. Denn unter dem Schlagwort Amüsement rollten acht Tage lang die verschiedensten Bordveranstaltungen ab, jagte ein Fest das andere, und der Freundeskreis wurde gewaltig erweitert. Am Pier von New York erfolgte nun unwiderruflich der Schlußpunkt in Form eines herzlichen und doch kühlen Hände- schüttelns. Als handfeste Erinnerung an diese Schiffsreise blieb mir einzig und allein eine Proviantdose, die ich am Vorabend mit allerlei Leckerbissen gefüllt hatte und die auf lange Sicht die eiserne Ration darstellen sollte.
Das ist also New York, das Symbol der Neuen Welt! Die Wolkenkratzersilhouette von Manhattan, die sogenannte „Skyline“, erschien mir nur als Kulisse zu einer Achtmillionenstadt, in deren hektischem Treiben ich unterzugehen drohte. Ich konnte nicht umhin, „It’s to much and to dirty!“ in mein Tagebuch zu schreiben. Somit eine negative Kritik, die sich aber mit der vieler Amerikaner deckt, die ich auf meiner weiteren Fahrt kennenlernen sollte.
Wie der Eiffelturm und Montmartre, so gehört auch das Übernachten auf Parkbänken zu den Erinnerungen an meine Frankreichreise vor zwei Jahren. Mit einer gewissen Wehmut gedachte ich dieser unbequemen, aber billigen „Einricht-'ngen“ zwischen Paris und Bordeaux, die meine bescheidene Bekanntschaft gemacht hatten. Denn zu meinem Leidwesen mußte ich erkennen, daß es unmöglich ist, dies in den USA fortzusetzen. Einerseits sind es die Neger, die einem dies ganz gehörig verleiden können, anderseits ist es die Polizei, die mehr Interesse an der Person des Schlafenden zeigt, als einem angenehm ist.
Bis auf wenige Ausnahmen übernachtete ich also in den Hotels der „Young Men Christian Association“ — YMCA —, die in jeder größeren Stadt anzutreffen sind. Ich mußte mich damit abfinden, daß ich täglich um jeweils drei Dollars ärmer wurde. Eine Ausgabe, die ich bei meiner Reisevorbereitung nicht einkalkuliert hatte. Dies bedeutete auch, daß ich meine ohnehin schon spärlichen Mahlzeiten noch bescheidener halten mußte, wobei folgender „Speisezettel“ entstand: Frühstück: Applepie (zehn Cents), Mittagessen: Hamburger (40 Cents) und Abendessen: Hot dogs (für 30 Cents). Was mich nun am meisten ärgerte, war die Tatsache, daß mich das Schlafen weit mehr als das Essen kostete.
Über Philadelphia, Washington D. C., Richmond, Charlotte gelangte ich zur Stadt Atlanta im Staate Georgia. Ich wartete durchschnittlich 15 Minuten, um mitgenommen zu werden. Immer begrüßte mich der Lenker mit einem kräftigen Händedruck und dem unvermeidlichen „How are you?“. Daraufhin erfolgte meistens eine Einladung in ein Coffee Shop, und Minuten später saßen wir wie zwei alte Bekannte nebeneinander. Beim Aussteigen erhielt ich immer eine Visitenkarte.
DER ZUFALL WOLLTE ES, daß ich in New Orleans einen jungen Deutschen traf, der sich er- bötig machte, mich in seinem Wagen bis San Franzisko mitzunehmen; diese Strecke kommt der Wien—Lissabon annähernd gleich. Ich hatte vorher keinen Autostopper getroffen, dem ähnliches widerfahren ist, und nur mein finanzielles Untergewicht hinderte mich daran, dieses sagenhafte Glück mit einem kräftigen „Prost“ zu begießen.
Bei 50 Grad Hitze durchjagten wir die texanische Prärie, die durch Abenteuergeschichten, Wildwestfilme und Cowboysongs legendäre Berühmtheit erlangt hat. Während die Bevölkerung des Ostens, des Westens und Nordens neben der
Milchwirtschaft Bodenbebauung betreibt, lebt jene der Prärie vor allem von der Viehzucht.
Auf schmalen unasphaltierten Straßen gelangten wir in die Indianerreservationen von New Mexico und Arizona, deren Bewohner noch das gleiche Leben führen wie vor einigen 100 Jahren.Romantisch veranlagte Karl-May- Anhänger sollten sich aber weiterhin mit der Bücherweisheit begnügen, da ihre Phantasiegebilde in der rauhen Wirklichkeit unweigerlich unter die Räder kommen würden, denn die geschäftstüchtigen Indios gehen raffiniert ans Werk, um ihren Säckel zu füllen. In Taos, einem Indianerdörfchen, zum Beispiel wurde uns ein „Gästebuch“ in die Hand gedrückt, in das wir uns eintragen mußten. Entgeistert starrten wir sodann in das Gesicht des „Bürgermeisters“, als dieser von uns vier heiße Dollars begehrte, da wir uns verewigt hatten. D s ist also der moderne Winnetou! Auf diese indianischen Impressionen hätte ich aber gerne verzichten können …
Tröstlich hingegen wirkt der Grand Canyon. Diese gigantische Schlucht, welche zu den meistgenannten Sehenswürdigkeiten der Welt zählt, stellt ein unvergleichliches Beispiel von Flußerosion dar. Im Laufe der Jahrtausende hat sich der Colorado-Fluß durch ein riesiges Felsmassiv gefressen. Vom Rand der Schlucht blickt man fast 2000 Meter tief in den Abgrund hinunter. Auf der anderen Seite erkennt man die geologischen Schichtungen, die wohl nirgends so vollständig und anschaulich freiliegen. Es sieht aus wie eine riesige, klaffende Wunde der Natur und zugleich wie ein triumphierender Zeuge ihrer Macht.
Als wir schließlich den Hoover Dam, der Welt höchsten Staudamm, passiert hatten, knieten wir im Geist nieder und beteten, der Wagen möge uns auch die letzten 320 Kilometer Wüstendurchquerung bis Los Angeles durchstehen helfen. Denn wir hatten mit dem Chevrolet unsere liebe Not, da er an lebensgefährlicher Altersschwäche litt. Zu Ventilbruch, durchrostetem Auspuffrohr gesellten sich noch Kinderkrankheiten, wie „Reifenplatzer“ und lecke Benzinleitung. Verbittert kämpften wir um die Erhaltung unseres „alten Herren“, um ihm den bitteren Gang zum Autofriedhof zu ersparen …
Am „Memorial Day“, dem US- Gedenktag für die Toten des zweiten Weltkrieges, erreichten wir Los Angeles. Meine Coast-to-Coast-
Fahrt hatte somit nach 13 Tagen ihr Ende gefunden.
ICH BEFAND MICH NUN IN EINEM TRAURIGEN DILEMMA, da die Durchquerung der USA meine Geldmittel fast zur Gänze aufgezehrt hatte. Schon sah ich Rio de Janeiro als schönen Traum entschweben!
„Arm am Beutel, krank am Herzen …“, so ungefähr könnte man den Zustand beschreiben, in dem ich auf Arbeitssuche ging. Es war jedoch überall dasselbe: Ohne Einwanderervisum hatte ich nicht die leiseste Chance, einen Job zu bekommen. Und wieder kam mir der Zufall zu Hilfe. Ich erinnerte mich eines Gesprächs mit einem jungen Burschen, den ich in einer New Yorker Busstation kennengelernt hatte. Wenn ich wollte, so sagte er, könnte ich bei seinem Bruder auf einer Marillenfarm arbeiten, die nur etwa 90 Kilometer von San Franzisko entfernt ist. Nachdem ich nun schon drei Tage lang die Götter erfolglos versucht hatte, gelang mir am vierten der große Wurf. Und mit dem erlösenden „You get the job“ begann ein neuer Reiseabschnitt.
Zwei Tage später wurde ich einem Herrn vorgestellt, der sich brennend für das Wie, Wann und Wo meiner Fahrt interessierte. Ich glaubte, in ihm einen Geheimpolizisten zu erkennen, und dementsprechend fielen auch die Antworten aus. Denn auch auf der Fann ist es verboten, ohne Einwanderervisum Arbeit anzunehmen. Abschließend photographierte er mich und verschwand.
Wie erstaunt war ich jedoch, als ich mich am nächsten Tag in der Zeitung erblickte und einen Artikel unter dem Titel „Apricotfarm has International flavor“ lesen konnte. Das hatte zur Folge, daß ich in der Gegend bekannt und zu Veranstaltungen eingeladen wurde, auf denen ich meine Reiseerlebnisse zum besten geben mußte.
Bis zur Marillenero te arbeitete ich für Kost und Quartier: Rasenmähen, Installationsarbeiten und Schweißen. Es folgten drei Wochen harter Arbeit. Bei 45 Grad Hitze wurden die Marillen eingebracht. Anfangs schien mir Kalifornien als des Teufels Küche, und ich mußte mit nassen Kleidern schlafengehen. Dabei tröstete ich mich mit dem Gedanken, daß diese Hitze nur ein Training für den südamerikanischen Hexenkessel sei.
DIE ENGLISCHE SPRACHE war mir schon sehr geläufig, als ich nach fünf Wochen das Farmleben an den Nagel hängte. Mit 300 Dollar in der Tasche schaute das Leben schon rosiger aus, und die Welt erschien mir freundlicher denn je zuvor. Über San Diego stoppte ich nach El Paso — eineStrecke von ungefähr 1600 Kilometern! Bei Cuidad Juarez überschritt ich die Grenze nach Mexiko. Es wäre verfrüht gewesen, zu frohlocken und meinen Schutzengel, der mich bisher alle Hürden schadlos nehmen ließ, auf Urlaub zu schik- ken. Denn vor mir lag ein Land, in dem die Armut das Zepter schwingt und eine Hochblüte erreicht hat, wie ich sie nirgends zuvor gesehen hatte.
Nachdem ich mich an Mexico City sattgesehen, somit auch University City und die Pyramiden inspiziert hatte, konnte ich mich nicht mehr aufraffen, per Autostopp weiterzufahren. Ich mußte also einen anderen Weg ausfindig machen, auf dem ich nach Südamerika gelangen konnte. Glaubte ich, auf dem Seeweg von Acapulco nach Peru reisen zu können, so wurde ich enttäuscht, weil zwischen Mexiko und Südamerika kein Schiffsverkehr besteht. Da die Eisenbahn und der Autobus zu teuer sind, blieb mir nur noch das Flugzeug. Die Peruanische Luft- fahrtsgesellschaft fliegt alte, komfortlose Maschinen nach Caracas. Dies wirkt sich natürlich gewaltig auf den Flugpreis aus, der um zirka 40 Prozent niederer ist als der einer Düsenmaschine — für mich also gerade das richtige! Alles wäre in bester Ordnung gewesen, hätte mir nicht das zuständige Konsulat einen vernichtenden Streich gespielt, indem es für mein Visum unter anderem auch einen Bankbrief über mein finanzielles „Wohlbefinden“ verlangte; da ich aber beim besten Willen die Mindestsumme nicht hervorzaubem konnte, wanderte mein Antrag in den Papierkorb. Hierauf machte ich kurzen Prozeß und kaufte bei einer anderen Fluggesellschaft ein Flugbillett Mexico City—Rio de Janeiro, wobei ich tief in den Sack greifen mußte. Das brasilianische Visum erhielt ich binnen 24 Stunden, was mir ein schadenfrohes Lächeln entlockte, als ich der „Umstandsmaierei“ gedachte, mit der das venezolanische Konsulat „bloßfüßige“ Touristen abzuwimmeln versucht…
Nach Zwischenlandungen in Guatemala, Panama, Caracas und Sao Paulo landete ich in Rio de Janeiro. Obwohl ich nun mein Ziel erreicht hatte, war ich mit mir selbst nicht ganz zufrieden, da ja das Fliegen nicht zur Fairneß des Autostoppers zählt.
Am 1. August 1963 setzte ich im Hafen von Rio de Janeiro zur Schlußrunde meines Unternehmens an. Und nach einer dreiwöchigen Seereise via Hamburg öffnete sich der Schranken des zivilisierten Lebens zum grauen Alltag.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!