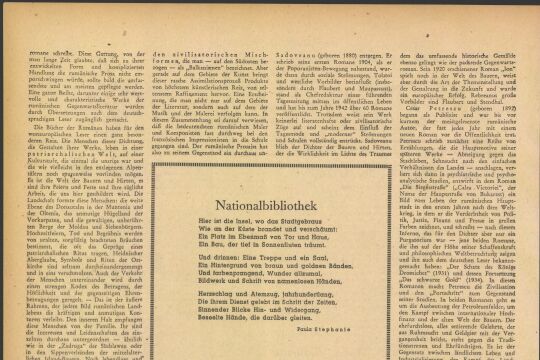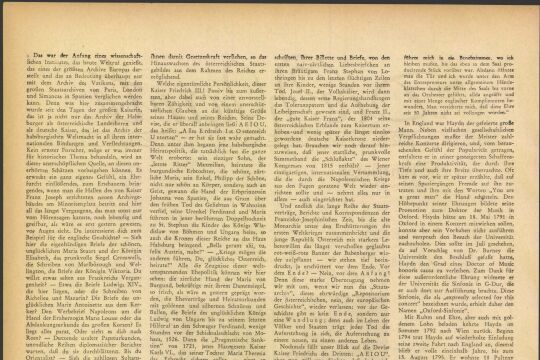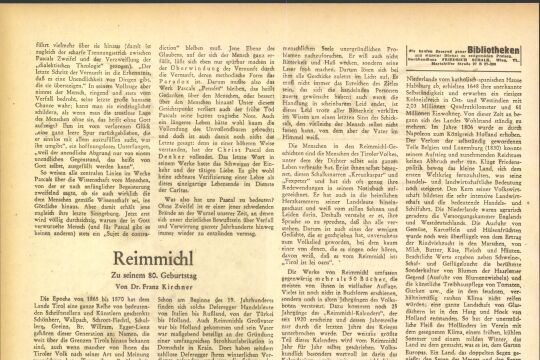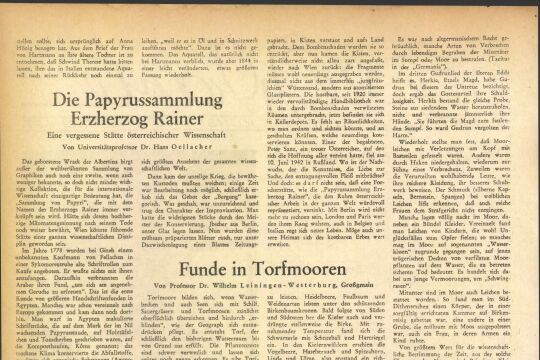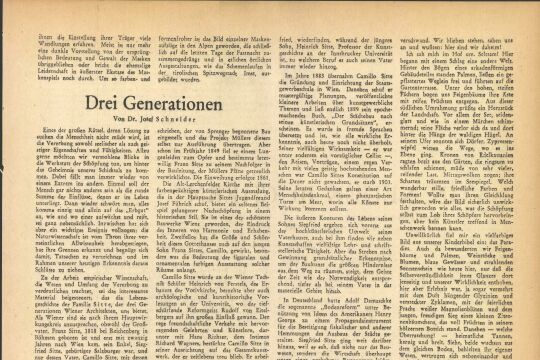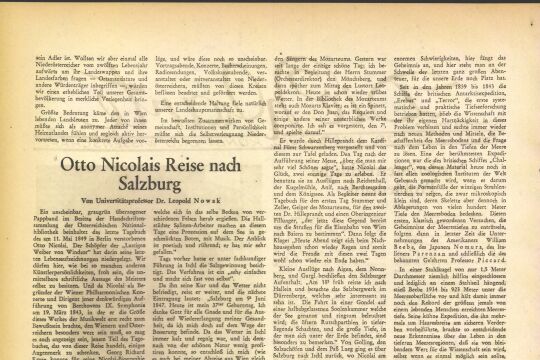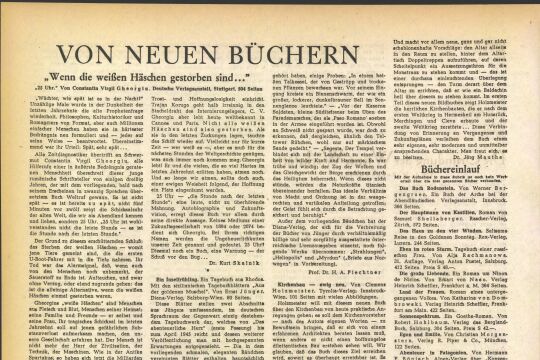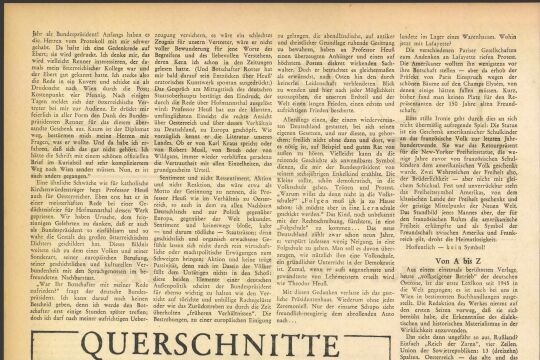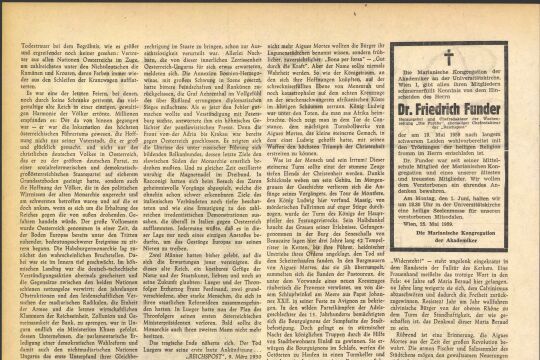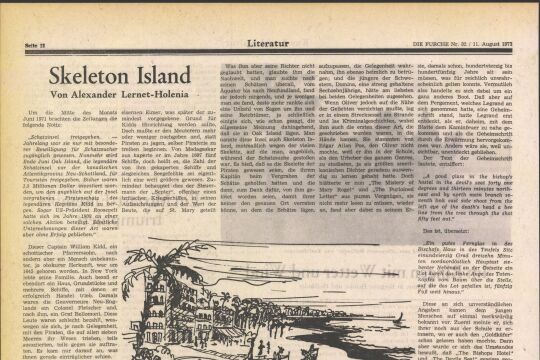Kaum eine Gegend Italiens ist öfter gemalt worden als Nemi, und kaum eine andere stellt die Altertumswissenschaft vor schwierigere Rätsel.
Unweit von Rom liegt im Albanergebirge ein erloschener Vulkan. Oben am Steilhange des Kraters baut sich Nemi auf, ein freundliches Dorf von 1200 Einwohnern, das von der Hauptstadt mit Autobus rasch erreichbar ist. Nemi ist eine verhältnismäßig junge Siedlung. Sie verdankt ihre Entstehung Zisterziensermönchen, die im 10. Jahrhundert den kreisrunden Turm erbauten, der das Schloß der Fürsten Ruspoli überragend schon von ferne dem Orte eine mittel alterliche Note gibt. Ein märchenhafte Panorama breitet sich vor den Augei des Wanderers aus. Unten, 200 Mete tiefer, leuchtet der kleine See aus derr Grunde des Kraters herauf, jenseits des Bergkessels wechseln Hügel mit lieblichen Tälern aber der größte Reiz und eine wahre Ueber- raschung ist die geradezu tropische Vegetation, die, in Terrassen gezogen, vom Rande des Wassers zum Dorf hinaufsteigt. Aber es ist keine täuschende Fata Morgana. Die Kühle des Sees konnte die Glut nicht löschen, die unter dem Boden siedet und brodelt und ihn so durchwärmt, daß auch im Winter, wenn es in Rom friert und die Berghöhen ringsum mit Schnee bedeckt sind, ein duftendes Blütenwunder sich unter unseren Füßen zu einem bunten Teppich verwebt. Täglich vor Abend führen vom Oktober bis in den März Lastautos die von fleißigen Frauenhänden gebundenen Sträußchen großer tiefdunkler Veilchen nach Albano zur Eisenbahn, die sie über die größeren Städte Italiens bis nach Venedig und Triest verteilt; vom hauptstädtischen Aerodrom Ciampino bringen Flugzeuge sie in voller Frische nach Kairo. Den Veilchen folgen im Mai die Erdbeeren, die von einer Gattung bis zu 100 Gramm schwer werden. Anfang Juni findet der Erdbeerkirchtag, die „Sagra delle fragole“ statt, ein schlichtes Volksfest, bei welchem Mädchen in Landestracht Körbe voll Erdbeeren nach Segnung der köstlichen Früchte durch den Geistlichen in einer Prozession durch das Dorf tragen.
Ganz anders mutet die Landschaft an, wenn man zum See hinabsteigt, dessen fast bleifarbener Spiegel zusammen mit der Stille und Abgeschiedenheit einen feierlichen Ernst aushaucht, der sich bedrückend auf die Brust des Besuchers legt. Und doch zog nicht die sonnige Höhe die alten Römer an, sondern die schwermütige Tiefe, die sie zu frommem Schauer erregte. Hier, wo Götter walteten, erbauten sie ein halbes Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung der Diana einen Tempel, von dem noch Reste zwischen den Beeten der Gärtner sichtbar sind. Nach uralter Ueberlieferung brachte Orestes das erste Standbild Dianas her, als er, mit Blutschuld beladen, samt seiner Schwester Iphigenie, aus den taurischen Chersones, der heutigen Krim, nach Italien kam. Ein blutiges Ritual war im Taurus mit der Verehrung der Göttin verbunden, denn jeder Fremde, der dort landete, wurde auf ihrem Altar geopfert. Aber in Italien milderte sich ihr Dienst, denn Diana war nicht nur die Göttin der Jagd, die dem Manne im gefährlichen Kampfe gegen Wölfe und Bären beistand, sie war auch eine Frau und eine Göttin der Frauen. Zu ihr pilgerten von weither mit reichen Gaben Mädchen in Liebeskummer, Frauen, denen Kindersegen versagt war, und werdende Mütter im Bangen vor ihrer schweren Stunde. Der See wurde zum Spiegel Dianas Speculum Dianae und ihr Hain nemus gab Nemi den Namen. Aber noch weiterhin umwitterte Blutdunst den Tempel. Der Priester war, wie die Geschichtsschreibung berichtet, stets ein entlaufener Sklave, der, auf der Suche nach einem rettenden Asyl, seinen Vorgänger im Kampfe getötet hatte, um seine Stelle einzunehmen, bis er selbst einem Stärkeren weichen mußte, der ihm Leben und Amt nahm. Er, der dem niedrigsten Stande angehört hatte, führte nun den Titel eines Rex; aber welche Befugnisse er als König des Hains besaß und welchen Tempeldienst er, der vom Kulte der Göttin nichts wußte, versah, wird wohl ein ungelöstes Rätsel bleiben. Wir können uns schwer einen Priester vorstellen, der auf so blutige Art zu seiner Würde gelangt war und der, in ständiger Furcht um sein Leben, das Schwert nicht aus der Hand legte. Aber die Geschichte vom Todesreigen vor dem Altar der Diana wird von der Fachwelt nicht angezweifelt, und dem großen englischen Gelehrten J. G. Frazer wurde sie zur Anregung und zum Ausgangspunkt für sein berühmtes Werk „The Golden Bough“ „Der goldene Zweig“.
Ueber die Diana nemorensis finden sich zahlreiche Mitteilungen im antiken Schrifttum; aber kein Historiker erwähnte etwas von den zwei Prunkschiffen, die zufolge mündlicher Ueberlieferung im Nemisee versunken waren, und kein Dichter sang ihren Preis. Um ihre Geheimnisse zu ergründen, mußte man zu ihnen selbst gehen. Von Zeit zU Zeit brachten Fischernetze zufallsweise irgendein Stück von ihnen zutage, aber die unzweckmäßigen Versuche, die in den Jahren 1446, 1535, 1827 und 1895 unternommen wurden, um sie ans Land zu bringen, mißlangen und fügten ihnen nur Schaden zu. Erst Mussolini ging daran, den See auspumpen zu lassen, um die Schiffe zu heben. Ein besonderes Verdienst erwarb sich dabei der Ingenieur Guido Ucelli, der in großherziger Weise nicht nur seine Kenntnisse und Erfahrungen, sondern auch Arbeiter, Maschinen und Werkzeuge kostenlos beistellte und dadurch den Ansporn für andere private Beiträge zu dem von der ganzen Kulturwelt mit Interesse verfolgten Unternehmen gab. Ucelli schrieb später sein klassisches Buch „Le navi di Nemi“ „Die Schiffe von Nemi“, das im Jahre 1950 in zweiter Auflage erschien und sich in gleichem Maße durch sein umfassendes Wissen, blendenden Stil und wertvolles Bildmaterial auszeichnet.
Die Bergung der Schiffe war eine technische Hochleistung. Schon die Vorarbeiten waren imponierend. Eine vier Kilometer lange Fahrstraße wurde von Genzano her angelegt, um das Material zuzubringen, und ein alter, verfallener, 1650 Meter langer Abfluß des Sees zum Aricciatale wurde wiederhergestellt. Dann begannen die Elektropumpen ihre Arbeit. Um die Schiffe bloßzulegen, mußte der Wasserspiegel um 22 Meter gesenkt werden; dabei wurden 40 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem See in den .Abfluß gepumpt. Mit großer Vorsicht wurden die Schiffe in den Jahren 1929 bis 1932 aus dem schlammigen Boden gelöst und ans Ufer geschafft, wo für sie eine Doppelhalle als Museum errichtet wurde. Das eine Schiff war 71,3 Meter lang und 20 Meter breit, das andere hatte die Ausmaße 72 zu 30 Meter. Obwohl. beide nur unvollständig erhalten waren, mußte man ihre ausgezeichnete Bauweise, ihre luxuriöse Ausstattung und ihre geradezu moderne technische Ausrüstung bewundern. Das größere Schiff hatte vier Steuer und Außenborde für die Ruderer, das andere besaß nur ein Steuer; man vermutet daher, daß es vom ersten Schiffe nacngezogen wurde. Vom prunkvollen Aufbau auf dem Deck des einen Schiffes waren nur spärliche Reste vorhanden, aber es war klar, daß es sich um kaiserliche Schiffe handelte. Man fand viele Bronzen, darunter ein feines Medusenhaupt mit geflügelten Schlangen, menschliche Vorderarme mit ausgestreckter Hand als Talismane gegen den bösen Blick, wunderbar realistische Löwen-, Panther- und Wolfsköpfe, kleine Hermen, ferner aus Marmor einen Frauenkopf und Säulen, vergoldetes Küchengeschirr, Vasen, Parfümfläschchen, Münzen, Terrakotten, Tonlampen, eine Waage, Reste von Mosaiken und Marmorintarsien, Angelhaken, vergoldete Dachplatten und merkwürdigerweise auch einen Pferdezaum. Vierkantige Tonrohre waren vielleicht Teile einer Heizanlage. Technisch bedeutsam sind auch Reste einer Pümpe und eines kleinen Schöpfwerks zum Heben eingedrungenen Wassers aus dem Kielraume, eine auf Eisenkugeln bewegliche Drehscheibe, bronzene Wasserleitungsschieber und anderes Gerät. In den archäologischen Veröffentlichungen des schwedischen Instituts in Rom aus dem Jahre 1935 führte Axel W. Persson aus, daß die Schiffe im Vergleich mit der hochentwickelten syrakusanischen Schiffsbaukunst des dritten vorchristlichen Jahrhunderts keine technische Ueberlegenheit der römischen Reichsmarine bewiesen, daß sie aber als einzige erhaltene Denkmäler ihrer Art Licht auf die hellenistisch-römische Schiffsbauweise warfen und wertvollstes Anschauungsmaterial zu der insbesondere in technischer Beziehung armen antiken Literatur lieferten.
Aber auch das Studium der Schiffe konnte ihnen ihre Geheimnisse nicht entreißen. Wohl wußte man, seitdem Taucher im Jahre 1895 Bleirohre mit dem Namen des Kaisers Cali- gula 37 bis 41 n. Chr. heraufgebracht hatten, wer sie hatte erbauen lassen, aber man konnte nicht feststellen, wie sie verwendet wurden. Am wahrscheinlichsten ist, daß sie für sakrale Zwecke bestimmt waren; dafür spricht der Charakter der Gegend und der Umstand, daß Caligula ein religiöser Schwärmer und Mystiker war. Vielleicht sollten die Schiffe zu Prozessionen über den See am Feste der Diana an den Iden des August dienen. Aber ich glaube, daß es gar nicht zu ihrer Verwendung kam. Die Erbauung zweier so großer Schiffe und ihre reiche künstlerische Ausschmückung erforderte in jener Epoche lange Zeit, und Caligulas Regierung dauerte nur vier Jahre. Wohl wurden die Schiffe fertiggestellt und vom Stapel gelassen, aber Caligula wurde, wie ich vermute, ermordet, noch ehe er sie benützen konnte. Damit ließe es sich am leichtesten erklären, daß die Literatur von ihnen nichts weiß. Allerdings könnte Ucelli mit seiner Vermutung recht haben, daß in den über diesen Zeitabschnitt verlorengegangenen Annalen des Tacitus etwas über die Schiffe enthalten gewesen sei. Jedenfalls standen sie beim Tode des Kaisers verlassen auf dem See und man glaubt, daß sie schon damals ausgeplündert wurden. Aber wann und auf welche Art sie untergegangen sind, gehört ebenfalls zu den ungelösten Rätseln. Da sie in einiger Entfernung von ihren Ankern lagen, könnte ein Sturm sie zum Scheitern gebracht haben.
Aber die unheimliche Tragik, die seit Urzeiten die Gegend umschattete, senkte sich schicksalhaft auf die Schiffe. Nicht für lange waren sie aus ihrem Schlafe auf dem Seeboden geweckt worden, und was das Wasser durch fast zwei Jahrtausende erhalten hatte, vernichtete im Nu das Feuer, das diese unersetzlichen Kostbarkeiten in den Endphasen des Kampfes um Rom während des letzten Krieges erfaßte. Obwohl das Museum unter dem ideellen Schutz des Oberkommandos stand, postierte ein deutscher Leutnant und Batteriekommandant in der Nacht vom 27. auf den 28. Mai 1944 vier Kanonen neben dem Gebäude und begann die nachdrängenden Amerikaner zu beschießen. Diese erwiderten in der gleichen Art und warfen auch Bomben ab, aber das Museum erlitt nur geringfügige Schäden. Das Museumspersonal wurde von den Soldaten aus den Wohnungen vertrieben und fand in nahegelegenen Kavernen der Kraterwand notdürftige Unterkunft. Obwohl sonst weit und breit kein Trinkwasser da ist, durften die Leute sich dem Museumsbrunnen nicht nähern und mußten heimlich in der Nacht Wasser aus dem See schöpfen, das sie für den Genuß abkochten. Am Abend des 31. Mai führten die Deutschen auf Panzerwagen Kannen mit Benzin zu und schafften sie ins Museum. Aus ihren Verstecken sahen die Italiener, wie die Soldaten beim Scheine tragbarer elektrischer Lampn fast zwei Stunden im Gebäude herumarbeiteten. Offenbar begossen sie alle Teile der Schiffe mit Benzin, denn plötzlich blitzte im ganzen Gebäude zugleich eine Riesenflamme auf. Zwei Tage gloste der Brand. Im rauchgeschwärzten Museum blieben nur die eisernen Gestänge übrig, auf denen die Schiffe geruht hatten, deren Asche nun den Boden bedeckte.
Dann zog die deutsche Batterie ab. Die Museumsbediensteten entsetzten sich, als sie ihre Wohnungen wieder betraten. Es sah darin nicht viel besser aus als im Museum. Die ganze Einrichtung war zertrümmert, jeder Spiegel, jedes Glas, jeder Teller in Scherben, jeder Topf von Bajonetten durchstochen.
Heute ist das Museum wieder , geöffnet, aber es bietet einen herzbewegenden Anblick. Die eine Halle soll für immer in ihrem ausgebrannten Zustande bleiben; wie eine offene, nie heilende Wunde soll sie die Klage und Anklage Italiens ausdrücken. Die andere Halle ist wieder instand gesetzt, aber recht armselig ruhen auf den eisernen Unterfangen liliputanisch verkleinerte Nachbildungen der Schiffe. Zum Glück waren die Bronzen und andere Schaustücke rechtzeitig nach Rom gebracht und so gerettet worden. Nun schmücken sie wieder das Museum am Nemisee.