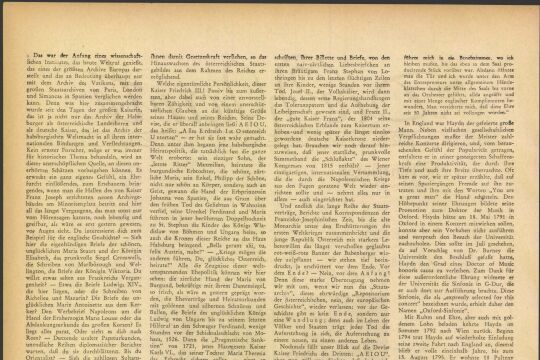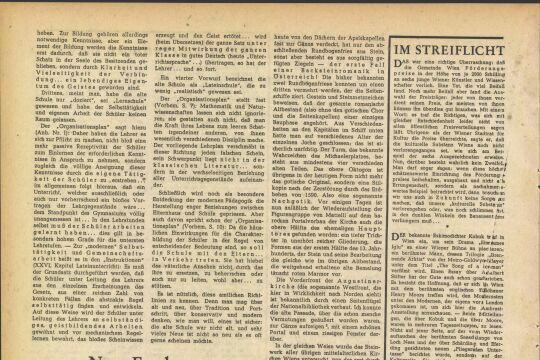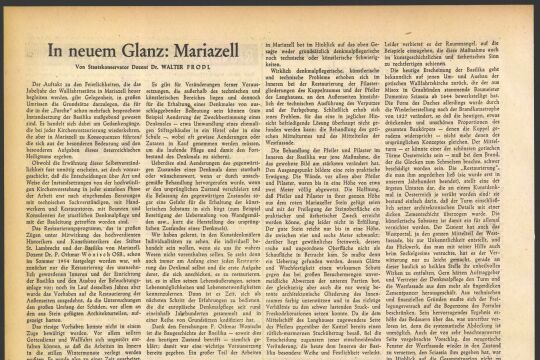Seit mehr als einem halben Jahrtausend steht der Dom von St. Stephan im Herzen der Stadt, im Zentrum Europas. Um seine Mauern rasten Kriege und Seuchen, vor ihnen prallten die Schlachtwellen der Völker aufeinander, die Geschlechter lösten einander in langer Folge ab. Er blieb stehen und seine Spitze glänzt im Licht.
Die letzte Katastrophe, welche die Welt erschütterte, streifte auch ihn. Er überdauerte auch sie. Und sein Turm ragt weiter in den Himmel, ein ungeheurer steinerner Finger, der an vergangene Jahrhunderte mähnt und auf neue hinzeigt.
Und doch war die Katastrophe schwer genug.
Sechs Kriegsjahre hindurch blieb der Dom, abgesehen von Splitterschäden, unversehrt. Wenige Tage — der Krieg war fast schon zu Ende — genügten, um ihn zu verwüsten.
Während des Kampfes um Wien wurde das Dach durch Artillerietreffer an verschiedenen Stellen der schützenden Ziegelschicht entblößt; doch konnten kleinere Brände, die durch Funkenflug am Nord- und Südturm entstanden, noch gelöscht werden. Als aber am 11. April 1945 die Häuser tn der Westseite des Stephansplatzes durch zivile Plünderer in Brand gesteckt und das aufgerissene Dach des Domes mit einem Funkenregen überschüttet wurde, blieben alle Rettungsversuche einer tapferen kleinen Schar vergebens; die Wasserversorgung der Stadt funktionierte zu dieser Zeit nicht mehr und die Geräte der Feuerwehr waren von den abziehenden deutschen Truppen mitgenommen worden.
Der Dachstuhl, ein unersetzliches Meisterwerk gotischer Zimmermannskunst, brannte alb. Der Glockenstuhl des Nordturmes wurde •vorn Feuer ergriffen, brennende Balken brachen in das Kircheninnere durch und das dort hängende riesige Wimpassinger-Kreuz von 1278 war unrettbar verloren. Am 14. April sprang das Feuer auf den Glocken- uhl im Südturm über, dort stürzte die Riesenglocke, die „Pummerin”, bis in die Erdgeschoßhalle des Turmes ab und zersprang. Zwei Tage vorher war die große Orgel, wohl durch Funkeneinflug im Westfenster, zerstört worden, ohne daß die Flammen glücklicherweise in das Kircheninnere weiter vordrangen.
Am 15. April glaubte man das Innere — denn die Gewölbe hielten immer noch stand — gerettet; aber da fiel im Morgengrauen die südliche der beiden fünfzehn Meter hohen Mauern, die den Dachstuhl des Chors stützen, zusammen; die Gewölbe des Mittelchors und des südlichen Chorschiffes, des Friedrichchors, wurden zerschlagen. Glühende Massen von Dachbalken brachen durch und ließen unter sich das prachtvolle Chorgestühl, das Wilhelm Rollmger um 1486 geschaffen hatte, und das barocke kaiserliche Oratorium verkohlen. Durch diese Brände wurden vier von den Pfeilern des Mittelchors schwer beschädigt.
Außerdem wurden durch das Feuer Maßwerkteile an den Türmen, die romanischen Kapitelle des Westteiles ziemlich schwer, leichter durch das Gewicht des einstürzenden Daches einige der Langschiffgewölbe angegriffen. Kleinere Schäden erlitten, teilweise auch schon bei früheren Fliegerangriffen, die vielen Epitaphe an den Außseiten der Kirche.
Glück im großen Unglück: die Brände blieben auf verhältnismäßig kleine Stellen lokalisiert, der weitaus größte Teil des Dominneren zeigte nicht einmal Rußspuren, der konstruktive Bestand und das Mauergefüge des Doms wurden weder durch Erschütterungen noch durch die Brände ernstlich in Mitleidenschaft gezogen. Nichts von den Kunstschätzen, außer den erwähnten, ging verloren, weder Statuen noch Bilder oder Grabsteine.
Wenige Tage nach der Katastrophe begann man mit den Aufräumungs- und Aufbauarbeiten; sie stellen ein Ruhmeskapitel in der Geschichte Wiens dar.
Schwierigkeiten, nichts als Schwierigkeiten: Mangel an allem, nur nicht an Helfern, die freiwillig von allen Seiten herbeikamen. Mit primitivsten Mitteln wurde in den ersten Monaten der Schutt, etwa dreieinhalbtausend Kubikmeter, aus der verwüsteten Kirche entfernt; da keine Transportmittel zur Verfügung standen, mußte er zunächst an der Nordseite des Doms abgelagert werden, ehe man ihn, viel später, wegschaffen konnte. Einige entschlossene Arbeiter trugen die im Winde hin- und herschwankende und die Reste der Chorgewölbe gefährdende nördliche Dachstützmauer ab. Als weitere Schutzmaßnahme wurde eine doppelte Trennungswand zwischen Querschiff und dem zerstörten Chor errichtet, um das Langhaus vor den Unbilden der Witterung zu bewahren.
Der Materialmangel verhinderte die Aufstellung eines provisorischen Daches; alle Verhandlungen und Bemühungen blieben erfolglos. So faßte man endlich den Entschluß, zum Schutze der Langhausgewölbe, die durch das Wetter besonders gefährdet waren, eine Flachstahlbetondecke zu errichten, die gleichzeitig als Dachboden für den kütiftigen Dachstuhl dienen konnte. Sie war im Jahre 1946 fertig. Im selben Jahre begann man mit der Aufstellung des stählernen Dachgerüstes. Diese Arbeit wurde durch verschiedene Schwierigkeiten — ein Teil der mit ihr betrauten Firma war von einer Besatzungsmacht beschlagnahmt worden — lange hinausgezögert, konnte aber in diesem Jahre im großen und ganzen vollendet werden.
Die Chorpfeiler mußten der ganzen Höhe nach ausgewechselt werden, was umfangreiche und schwierige Vorarbeiten voraussetzte. Dann legte man über die zerstörten Gewölbe der Chöre ebenfalls eine Betondecke, so daß auch hier Witterungsschäden ausgeschlossen sind.
Die Arbeiten im Langhaus sind nun beendet. Der Boden wurde mit Steinplatten aus Salzburger Marmor neu belegt; Gewölbe, Maßwerke und andere Architekturdetails wurden restauriert oder ausgewechselt. Hier ist zu erwähnen, daß alle Verantwortlichen den Steinmetzen hohes Lob zollen, und es scheint wirklich, als ob von den Bauhütten rund um den Stephansdom eine neue Renaissance dieses Handwerks ausginge; die Wirkungen kann man überall und auch bei profanen Bauarbeiten bemerken, wenn man aufmerksam durch die Straßen der Stadt geht.
Die erwähnten Arbeiten sind zum größten Teil Restaurierungsarbeiten, das heißt sie suchen den ursprünglichen Zustand mit größter Genauigkeit wieder herzustellen. Ähnliche Restaurierungsperioden sah der Dom im vergangenen Jahrhundert, aber es herrscht zwischen den Ausbesserungen und Erneuerungen jener und unserer Zeit ein Unterschied, der Beachtung verdient. Was damals trotz aller Bemühung entstand, war nur eine oft peinlich flaue und kühle Kopie des ehrwürdigen Vorbilds; heute versucht man nicht bloß das Maßverhältnis zu wiederholen, sondern dem Stein Leben und Wärme zu verleihen, indem man die Vorbilder nachzuschaffen, nicht nachzuahmen bemüht ist. Ob dies Erfolg hat, werden wohl erst spätere Generationen sagen können; uns scheint es, daß die Ergebnisse der jetzigen Restauration befriedigender sind als alles, was in dieser Hinsicht je zuvor geschah.
Gleichwohl sollte man bedenken, daß seit mehr als hundertfünfzig Jahren am Dom nur restauriert und ausgebe’ssert, daß aber an seinen Kunstschätzen nichts gemehrt wurde; fünf Jahrhunderte haben an ihm gearbeitet, die steinerne Architekturlandschaft erweitert und die Schiffe, Kapellen und Chöre mit Andachtsbildern, Altären, mit Holzschnitzerei und Skulpturen, mit Gestühlen und Steinbaldachinen geschmückt. Dann kam nichts mehr hinzu — nur Arbeiten, die dem Schutz und der Erhaltung dienten. Das kann wohl nachdenklich machen. Da aber nun unverkennbar die Kunst unserer Zeit nach einer langen Periode der Säkularisation wieder Bindungen, und zwar auch religiöse Bindungen an die Gemeinschaft anzustreben beginnt, der Dom aber stets eine Angelegenheit der Gemeinschaft war und wieder ist — sollte man es nicht wagen, auch den Künstler unserer Tage zur Arbeit heranzuziehen?
Nunmehr wird das Langhaus, das viertausend Personen Platz bietet, dem Gottesdienst wieder geöffnet sein. An der Fren- nungswand, die den zerstörten Chor von den Langschiffen scheidet, steht der schöne Wiener-Neustädter Altar von 1447; der Altarraum wurde durch eine elf Stufen hohe Estrade, die zu beiden Seiten des Altars die unbeschädigt gebliebenen Domherren- chorgestühle von 1647 trägt, in seiner Bedeutung kenntlich gemacht. So entstand — ähnlich dem Salzburger Dom — eine sehr saubere und den Verhältnissen glücklich angepaßte Lösung, der nichts Provisorisches anhaftet.
Das Riesentor an der- Westseite erhielt einen Windfang, denn es soll künftig als Haupteingang verwendet werden, ebenfalls ein begrüßenswerter Gedanke. Lange genug war das Riesentor nicht im Gebrauch und konnte man nur durch die Turmtore in den Dom gelangen; so bildete sich im Inneren unter der tief herabhängenden Orgelempore ein toter, weil unbenützter Raum. Außerdem setzte man dadurch eine der wichtigsten Raumeigenheiten des Doms, nämlich den Zug in die Tiefe und zum Altar hin — was ja nicht nur ästhetische, sondern auch symbolhafte Bedeutung besitzt —, außer Geltung, mußte der Besucher doch einen langen Umweg nehmen, um die volle Länge des großen Raumes wirklich übersehen zu können. Das Überraschungsmoment, mit dessen Wirkung auf den Besucher ja jeder mittelalterliche Bau rechnet, war hinfällig geworden.
Sonst wird man in den Langschiffen, abgesehen von einigen Holzeinbauten, die der Weiterführung der Arbeiten dienen, wenig Veränderungen der Einzelheiten bemerken. Und doch wird jedermann feststellen, daß das Dominnere ganz anders wirkt als früher: es ist nicht mehr dunkel.
Die Frage nach der Belichtung des Dominneren ist wichtiger, als es den Anschein haben mag; denn man darf sagen, daß das Bild, das sich nun dem Eintretenden bietet, von dem der Erinnerung gänzlich abweicht. Die Glasfenster des vergangenen Jahrhunderts, um die man von künstlerischem Standpunkt kaum trauern muß, sind zerstört und durch das sogenannte Kathedral- glas, eine Zusammenfügung verschieden gefärbter, aber heller Glastäfelchen, ersetzt worden; das Tageslicht hat durch sie, nur ein wenig in seinem Helligkeitsgrad gedämpft, freien Zutritt. Dazu kommt noch, daß durch die Restaurierungs arbeiten vieles gereinigt und dadurch aufgelichtet wurde. Es ist also fast taghell im Dom: ein ungewohnter, überraschender, aber nicht abträglicher Eindruck. Ohne Zweifel rückt diese Neuerung die Bilder, Baudetails oder die Pfeilerplastiken, deren hohen künstlerischen Rang man erst vor einiger Zeit entdeckt hat, jetzt im buchstäblichen Sinne des Wortes ins volle Licht.
Dennoch sind viele Debatten um diese neuen Belichtungsverhältnisse vorauszusehen. Manchem werden sie allzu nüchtern, vielleicht auch als ein wenig zu sehr vom Standpunkt dös Denkmalpflegers her bestimmt erscheinen. Und in der Tat wird man zugestehen müssen, daß das Dunkel, das ehemals im Stephansdom herrschte und die Pfeiler gewissermaßen in unabsehbare Höhe verlaufen ließ, den Raumverhältnissen durchaus angepaßt war. Gewiß, die Schiffe scheinen auch jetzt sehr hoch, doch bleibt abzuwarten, ob dieser Eindruck, den man keinesfalls missen möchte, nicht der Einfügung der Trennungswand zuzuschreiben ist, die ja die Länge des Raumes verkürzt und dadurch seine Höhe deutlicher werden läßt. Nicht ausgeschlossen also, daß in dem Augenblick, in dem die Wand fallen wird, die Maßverhältnisse sich ungünstig verändern.
Man hat in dieser Angelegenheit klugerweise noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Doch erwägt man für den Fall, als die jetzige Notlösung sich nicht bewähren sollte, verschiedene Vorschläge, so den, die Glasfenster des 14. Jahrhunderts, die sich früher in den Chören und verschiedenen Museen befanden, nun in den Langhausfenstern anzubringen, oder einen anderen, nämlich neue Entwürfe von zeitgenössischen Künstlern ansführen zu lassen. Und wirklich ergäbe sich hier eine der Möglichkeiten, neue Kunst zu dienlichen Aufgaben heranzuziehen.
Während in diesem Teil der Kirche Gottesdienste gehalten werden, muß in den anderen Teilen, in den Chören und am Äußeren, die Arbeit ohne Unterbrechung Weitergaben.
Im Laufe des kommenden Jahres wird das große Steildach des Langhauses bedeckt sein; die Beschaffung der buntglasierten Dachziegel hat manche Umstände gemacht, doch wurde man ihrer Herr. Ein tschechisches Unternehmen hat sie, getreu den alten Vorbildern, in zehn Farbabstufungen angefertigt, und ihre Übernahme steht bevor.
Längeren Zeitraum wird die Mauerung der Kreuzgewölbe in den Chören beanspruchen, für die man nun die Gerüste aufstellt. Da die Gewölbe gänzlich zerstört sind, wird die Arbeit an ihnen wenigstens zwei Jahre kosten; erst dann wird es möglich sein, auch hier das eiserne Dachgerüst zu montieren. Ferner wird man die Türme, vor allem den nördlichen Adlerturm, der ja unter dem Brande besonders zu leiden hatte, der Restaurierung unterziehen; selbstverständlich wird an ihm nichts von Grund auf erneuert werden, auch die Form der flachen Renaissancedachkuppel, die ihn bedeckte, wird man beibehalten. Am Südturm haben die Zimmerleute mit dieser Arbeit bereits begonnen. Und schließlich wird auch der Neu- güß und der Einbau der Pummerin, jener fast schon sagenhaften Riesenglocke, Kopfzerbrechen verursachen. Wie bekannt, war es nicht möglich, diese zwanzig Tonnen schwere Glocke wirklich zu läuten, da man damit ein Ausschlagen der Turmspitze um etwa 60 Zentimeter bewirkte; nun will man mit Hilfe besonderer Vorrichtungen den Mangel beseitigen.
Im ganzen wurde die Zeit des Wiederaufbaues mit zehn Jahren angenommen; doch kann man hoffen, daß in etwa zweieinhalb Jahren, also sechs Jahre nach den unheilvollen Tagen des April 1945, wenigstens das Innere des Stephansdomes wieder ganz hergestellt ist.
Der Umfang dieser Bauarbeiten weckt die Frage nach ihrer Finanzierung. Es muß zunächst festgehalten werden, daß, obwohl einige der wichtigsten und wohl auch kostspieligsten Bauetappen bereits abgeschlossen sind, die ausgegebenen Summen keineswegs schwindelnde Höhe erreichen. Im Gegenteil, sie betragen nur einen, und zwar recht kleinen Bruchteil dessen, was von den Behörden für andere Bauvorhaben, etwa die Wiederherstellung der Oper, an Kosten veranschlagt wurde.
Was aber von außerordentlicher Wichtigkeit ist und jedem, der den Dom auch von anderen als nur kunsthistorischen Gesichtspunkten betrachtet, Freude bereiten muß: der Aufbau vollzog sich bis jetzt, ohne daß auch nur im geringsten öffentliche Mittel in Anspruch genommen wurden, ohne daß man jemals um die Hilfe des Staates oder der Gemeinde hätte besorgt sein müssen. Alle Ausgaben konnten aus freiwilligen Spenden bestritten werden. Das ist sicherlich überraschend, und es mutet noch erstaunlicher an, wenn man bedenkt, daß es keines großen propagandistischen Aufwandes bedurfte, um die freiwillige Hilfe wirksam werden zu lassen. Ohne aufgefordert worden zu sein, spendeten einzelne und Organisationen, zwei Lotterien halfen und eine Sondermarkenserie zugunsten des Domes brachte unerwartet hohe Unterstützung. Es ist wahrscheinlich, daß demnächst die Verantwortlichen an die Öffentlichkeit appellieren werden, neuerlich zum Aufbau von St. Stephan beizutragen. Sie sind sicher, daß der Ruf nicht ungehört verhallen wird.
Man muß sich über die Bedeutung dessen, was soeben gesagt wurde, im klaren sein. Es wird nicht leichtfallen, ein Bauvorhaben von diesem Ausmaß zu nennen, das in den letzten Jahrzehnten ohne Hilfe des Staates begonnen und durchgeführt werden konnte. Gerade im Falle der zerstörten Dome — denn es ist in Deutschland, in Köln oder Lübeck, nicht anders wie bei uns — zeigt es’ sich, daß wie im Mittelalter auch heute noch die Bürgerschaft der Städte, auch wenn aus den 20.000 Menschen, die im 15. Jahrhundert Wien bewohnten, eine anonyme Masse geworden ist, Gemeinschaftsleistungen sondergleichen vollbringen kann.
Daß die Bevölkerung einer Millionenstadt um ein Bauwerk, das in Flammen steht, weint, daß sie über seine Zerstörung trauert, daß sie schließlich freiwillig Beitrag um Beitrag leistet und die Fortschritte des Aufbaues eifersüchtig überwacht — das stellt ein Phänomen dar, das seit langer Zeit ohne Beispiel ist.