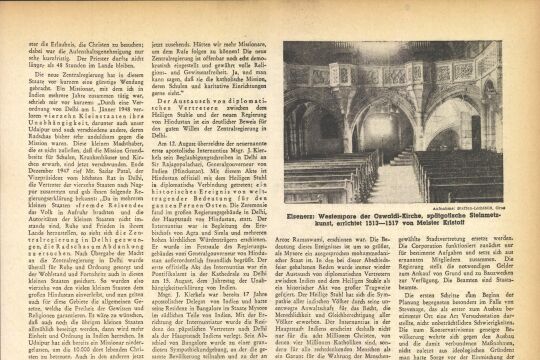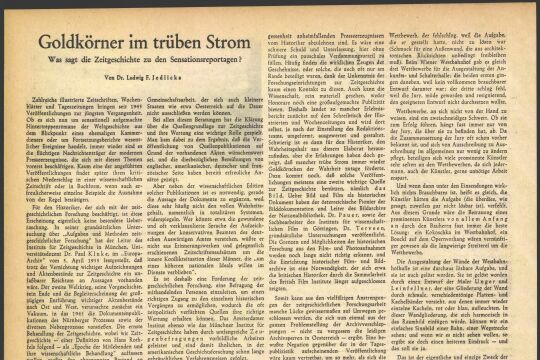Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Heinrichshof und die Grundstruktur der öffentlichen Dinge
An vielen Stellen der Inneren Stadt stoßen wir auf unverständliche Entscheidungen der Baubehörde. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Lösungen am Stephansplatz, bei der Albertina, am Karlsplatz samt Museum durchaus keinen Beifall finden. Auch beim Neubau Heinrichshof steht die Behörde im Gegensatz zur urteilsfähigen Bevölkerung.
Die Verstimmung wird sichtbar in Leserzuschriften, hörbar in Radiopersiflagen und in Gesprächen. Die Behörde kümmert sich nicht darum. Sie laviert den Zorn ins Gustiöse, läßt Schablonen aufstellen, die die Fassade ein Stück zurück oder höher oder abgerundet zeigen und drängt das Urteil vom Prinzipiellen zum Detail. Modelle und geschickt lancierte Aeußerungen sind sozusagen Meinungswellenbrecher. Aber hinter aller Kritikasterei steckt — wichtiger als das Ausgesprochene — ein allgemeines Unbehagen über die Art, das Bauwesen Wiens zu lenken oder zu manipulieren. E steht außer Frage, daß die enge Kärntner Straße, überhaupt die Durchquerung der Innenstadt, eine historische Gelegenheit versäumte, daß die kleine Zurückdrängung des Haas-Hauses den kritischen Verkehrspunkt nicht entlastet, daß der Karlsplatz auch nach der Aufführung des Museums „Gegend“ bleiben wird und daß am „Kulturbrennpunkt“, bei der Oper, das „Volk“ die Folgen der Motorisierung viel richtiger vorausahnt als die zu keiner durchgreifenden Tat zusammenfindenden Kompetenzen. Was den Stephansplatz betrifft, so wären sicherlich empörte Zuschriften auch dann eingesandt worden, wenn man das Singer-Haus aufgekauft und die Rotenturmstraße breiter geöffnet hätte. Aber es wären auch Befürworter aufgetreten, und die geschaffene größere Raumfreiheit, welche in München oder Frankfurt als Gegenleistung des Schicksals für die furchtbaren Bombennächte bereits erkennbar wird, hätte die Sentimentalen in die Minderheit gedrängt. Das „Volk“ will einen lenkenden Willen, will den Mut zur großen Lösung sehen. Damit sind wir bei der staatlichen Grundstruktur, bei „halber Tat auf halben Wegen...“
Die bundeseignen Bäume im Hofe der technischen Hochschule dürfen nicht vom Gemeindegärtner, der dreißig Schritte entfernt am Karlsplatz arbeitet, sondern müssen vom Schön-brunner Obergärtner gestutzt werden. Sie unterstehen einer anderen Kompetenz. Aber daß die eine der anderen nicht telephoniert, offenbart eine böse Zweigeleisigkeit und das geringe Streben zum Ganzen. Die korrekte Teilung in bundes- und gemeindeeigene Bäume ist bedeutungslos. Wir finden hier die zweigeteilte Grundstruktur, die uns das Hin und Her beim Heinrichshof erklären helfen kann. Selbstverständlich sagen die Leute, daß bei einem 60-Millionen-Proiekt die finanziellen Interessen von Grundbesitzer, Bauwerber, Entwerfer, Ueberprüfer ihre Rolle spielen. Daß sie der Oeffentlichkeit nicht gerade mit Begeisterung Einsicht in die Motive geben, ist ihr gutes Recht. Aber auch ein Zweifel am nominell korrekten Vorgehen der öffentlichen Instanzen ist dvreh nichts begründet. Die „Grundstruktur“ reicht vollkommen aus, das ma-igelnde Zusammenspiel der künstlerischen, verkehrstechnischen, finanziellen Faktoren zu begründen. Es wäre ungerecht zu verlangen, daß Beamte die Initiative an sich reißen müßten. Die Ausschüsse sind beratend, nicht entscheidend. Es fehlt der Mariatheresienorden für den Stadtgestalter.
Die Straßen, der Verkehr, Gebäudevolumen und Gebäudeart unterstehen dem Rathaus. Die Oper hingegen ist bundeseigen. Der Heinrichshof ist — oder war bis vor kurzem — Privateigentum, welch seltsames Relikt! Die Baupolizei des Rathauses überwacht die Neubauten in bezug auf die Bauordnung. Eine künstlerische Oberaufsicht der Neubauten ist einmal durch die Stadtplanung, dann durch nichtbeamtete Fachleute des städtischen „Beirats“ in beschränktem Maß gegeben. Die Oper wiederum, auch der Ring, unterliegt einer anderen künstlerischen Betreuung. Das „Alte“ bewacht das Denkmalamt. Da auf der ganzen Welt niemand weiß, was Kunst ist oder gar was einst dafür gehalten wird, so stehen diese Instanzen auf schwachen Füßen. Wie soll ein Amt generell darüber befinden, ob zum Beispiel der Verkehr oder das historische Bild den Vorrang verdient? Falls es hart auf hart geht, können diese Stellen nichts anderes tun, als hinhaltend gegen grobe ästhetische Ausschreitungen zu kämpfen. Eine andere Frage allerdings ist es, ob zwei Räte in künstlerischen Fragen autoritativer sind als einer, und ob es überhaupt vernünftiger sei, die Verantwortung über künstlerische Dinge mehreren Stellen anzuvertrauen. Wie es aber auch mit den Vorteilen der Demokratie im kulturellen Bezirk bestellt sei, Tatsache ist, daß wir alle an Abstimmungen glauben und daß Individualität und Intuition heute wenig gelten. Warum ist aber nicht aus der öffentlichen Meinung ein sachkundiger mutiger Mann hervorgetreten, der die Millionen zum Grundankauf und zur Offenhaltung der Frage bis zur Entscheidung durch einen öffentlichen Wettbewerb mobilisiert hätte? Ein Amt ist zu Mut nicht verpflichtet.
Das künstlerische Problem des Platzes vor der Oper ist keineswegs einfach. Es könnte sein, daß Van der Null denen recht geben mußte, die schon 1868 die Situierung der Oper bemängelten. Sie steht zu tief und hat, wenn man von der viel niedrigeren Börse absieht, als einziges von den monumentalen Gebäuden des Rings keinen „Ehrenhof“. Man weiß, daß Hansen das Parlament zurückschieben und mit ..großer Achse“ versehen wollte. Der Oper gegenüber allerdings — Architekten sind keine Engel — führte er die „Wand“ des Heinrichshofes auf, eines Gebäudes, welches schön detailliert war, aber im Gegenspiel mit der Oper das Ungewöhnliche des mangelnden achsialen Freiraums nicht vergessen ließ. Die Charaktere der beiden Häuser standen fühlbar hart einander gegenüber. So öde die offiziellen Symmetrien — siehe München — auch erscheinen: die P 1 atzschaffung in enger Stadt traf und trifft ein Z e i t a n 1 i e g e n \ Die vielen unbestellten Projekte, die im Laufe des genießerisch in die Länge gezogenen Opernwiederaufbaues auftauchten, vergrößerten die Respektdistanz zwischen Oper und ihrem Gegenüber. Die bestellten Projekte allerdings mußten dem hohen Grundpreis Rentabilität verschaffen, was nur durch massive Ausnützung möglich ist. Oeffentliche Gelder, zum ganzen oder teilweisen Erwerb wurden von niemand bereitgestellt oder beantragt, und die sagenhaften ausländischen Gruppen hatten es nicht eilig, Wohltäter an der Schönheit Wiens zu sein oder die kulturelle Bastion durch ein glorreiches aber ertragloses Operngegenüber zu verstärken.
Die Oper „droht“ endlich fertig zu werden. Die Ruine mahnt: Es muß etwas geschehen. Die Autoflut steigt an, sie ist in Paris, in München bereits fürchterlich, die Parkmöglichkeiten werden immer spärlicher. Es wird schwieriger, sich vorzustellen, wie man die zur Operneröffnung Vorgemerkten durch die Vorfahrt schleust, die schon für die Kutscher eigentlich zu eng war. Die Seitenvorfahrten reichen nicht aus, weil ein an Operngasse und Kärntner Straße unterbrochenes Fließband der Taxis nicht wirksam sein kann. Dazu tritt als unerwarteter Antreiber die Möglichkeit auf: 1. Kapital der international verflochtenen Versicherungsgesellschaften heranzuziehen, welches sich, ehe der Gedanke der „Koexistenz“ auftauchte, nur bis zur Enns wagte. 2. eine Koppelung mit den fast zinslosen Geldern des Wiederaufbaues einzugehen, hoch-und niederverzinsliche Gelder zu mischen und dadurch vielleicht doch noch die gesetzmäßige Rendite zu erreichen. Auf einmal kam in die Sache Turbulenz. Die Möglichkeit war vorhanden, daß ein großes, glänzendes Gebäude entsteht, über das die Wiener zwar auf alle Fälle schimpfen, das aber im Verein mit der eröffneten Oper sehr repräsentativ wirken könnte. Dem zu begegnen wurde über Nacht die Lösung der Opernkreuzung begonnen. Es ist nicht zu leugnen, daß eine glänzende unterirdische Geschäftsstraße mit bequemen Lauftreppen eine sehr bedeutende Demonstration modernen Bauwillens dargestellt hätte. Viele Zehntausende hätten eine gerade schnelle Verbindung bei Kärntner Straße und Operngasse der Gemeinde täglich gedankt. Die Gemeinde mühte sich au%h um das Problem der Wagenabstellflächen, dessen Bedeutung jeder kennt, der an der zugigen Durchfahrt in leichten Kleidern einst auf das Taxi wartete. Aus dem Motiv des „genau so wie früher und justament“ war der Schaffung unterirdischer Garagen links und rechts der Oper keine Aufmerksamkeit geschenkt worden, obwohl man trockenen Fußes vom Wagen zum Aufzug und zum Sitzplatz hätte kommen können. Der Traditionalist von 1946 nahm das Auto noch nicht zur Kenntnis. Und nun verlangen nicht nur der neue Heinrichshof, sondern auch die Büro-Wohnbauten an der Meinl-Ecke und beim Operncafe zusätzliche Parkmöglichkeiten. In Amerika schreibt man bereits für jede neuentstehende Bürofläche die gleichgroße Abstellmöglichkeit vor. Im Souterrain des Heinrichshofes sollen aber nur 140, nach anderen sogar nur 80 Wagen untergebracht werden. Dies entspricht vielleicht einem Sechstel der Hamburger Vorschrift und einem Zwanzigstel der stärksten amerikanischen Vorsorge.
Dies ist die Lage, die es erfordert hätte, daß Stadt und Bund eine zentrale Stelle schaffen, die über die beiden Herzensanliegen der Bevölkerung entscheiden. Ein Wettbewerb hätte brauchbare Ideen bringen oder aber die Unmöglichkeit der Lösung beider Grundprobleme dartun müssen. Da aber die „Grundstruktur“ nach zwei Richtungen zog, da eine doppelte politische Propaganda mit den technischen und künstlerischen Dingen möglich erschien, so wurde, als es Zeit war, dieser Weg nicht einmal versucht. Die Herstellung der alten Pracht stand auf der einen Seite im Vordergrunde, und als der anderen die Möglichkeit erschien, mit der Beseitigung der Kreuzungskalamität Paroli zu bieten, war vollends der Versuch einer Generallösung, das Zusammenspiel von Stadtbau, Denkmalschutz und Verkehr nicht mehr durchzuführen. Am unbegreiflichsten erscheint es, daß eine Bereitstellung von Bundesmitteln zum ganzen oder teilweisen Ankauf des Grundes von niemandem in Betracht gezogen wurde. Man hätte Zeit zum Studium gewonnen und wäre keinesfalls in die Verlegenheit geraten, an der Parzelle zu verlieren. Was wird allein an Fläche ein zentraler Untergrundbahnhof erfordern, der dem Standard der Weltstädte entspricht! So sieht der Unbeteiligte, daß man zwar am Rande der Stadt, nicht aber an dem empfindlichsten Punkt „plante“. Es war ein Nebeneinander der Kompetenzen, wie bei den Bäumen am Karlsplatz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!