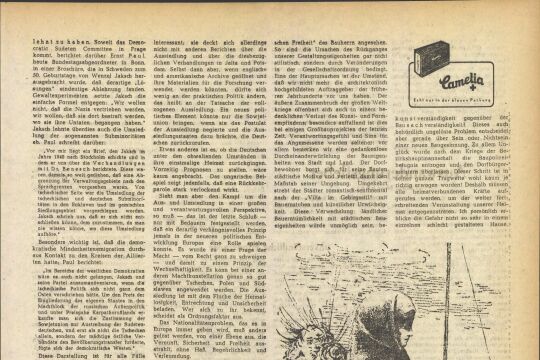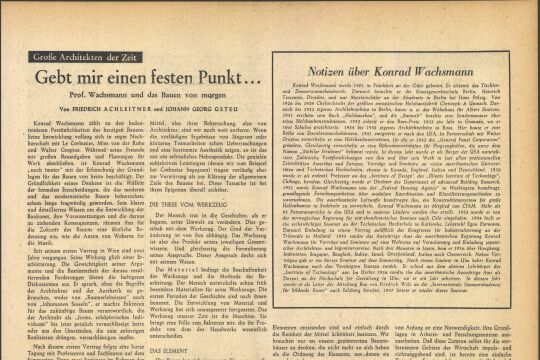„Wir Amerikaner haben sicherlich vieles zerbombt, aber es scheint mir, daß die Wiener selbst seit 1945 noch viel mehr zerstört haben.“ Dieser Ausspruch eines jungen amerikanischen Architekten, der besser als mancher Wiener die lokalen „Bausünden“ kennt, weist auf einen Sachverhalt hin, der uns einiges zu denken geben sollte. Es muß nicht besonders hervorgehoben werden, daß zu den zahlreichen Abbruchen von historischen Bauwerken zumindest eine ebenso große Zahl von Neubauten kommt, die zur Verschan-delung des Wiener Stadtbildes beigetragen haben.
Welche sind aber die Gründe, die In den letzten siebzehn Jahren österreichischer Bautätigkeit zu diesen oft sehr unbehaglichen Ergebnissen führten? Es wäre verfehlt, für alle Fehlleistungen nur die relativ kleine Gruppe der Planenden, also die Architektenschaft, verantwortlich zu machen. „Man wird mir einwenden, daß ich den wienern falsche absich-ten unterschiebe. Die architekten sind schuld daran, die architekten hätten nicht so bauen sollen. Ich muß die baukünstler in schütz nehmen. Denn jede Stadt hat jene architekten, die sie verdient. Angebot und nachfrage regulieren die bauformen. Der, der dem wünsch der bevölkerung am meisten entspricht, wird am meisten zu bauen haben. Und der tüchtigste wird vielleicht, ohne je einen auftrag erhalten zu haben, aus dem leben scheiden. Die anderen aber machen schule. Man baut dann so, weil man es eben so gewohnt ist“ (Adolf Loos, Wien 1898).
Ist es wirklich so arg?
Ist es aber heute wirklich so arg um unsere Baukunst bestellt? Neigen wir nicht allzu leicht dazu, die Vergangenheit und das Ausland mit anderen, milderen Blicken zu betrachten als unsere Leistungen der Gegenwart? Stimmt es wirklich, daß man schon fast aus allen Himmelsrichtungen, wenigstens von Norden, Westen, Süden und seit neuestem auch von Südosten nach Österreich reisen kann, um überall das gleiche, merkbare Qualitätsgefälle im allgemeinen Bauschaffen feststellen zu müssen?
Man müßte eine Gegenfrage stellen: Gibt es Länder mit einer ähnlichen Bautradition wie Österreich, die in der jüngsten Vergangenheit genauso versagt haben? Wäre es in einer anderen ehemaligen europäischen Metropole möglich gewesen, zum Beispiel ein Zentrum wie den Stephansplatz in einer ähnlich provinziellen Art wiederaufzubauen? Es genügt vollkommen, sich einmal nur in der Wiener Innenstadt umzuschauen, um ein Bild unserer Situation zu bekommen.
Es fehlt die Kontrolle der Öffentlichkeit
Jeder einzelne Fall wirft Fragen auf, über die man dringend ins klare kommen müßte. Und alle diese Fragen kreisen zuletzt um das Gespenst eines ausweglosen Provinzialismus, der in den verschiedensten Schattierungen sichtbar wird: die Verbauung des Stephansplatzes, die Verschandelung des Domes durch eklektizistische und kommerzielle Zubauten, die kurzsichtige „Verkehrslösung“ bei der Albcrti a, der Heinrichshof, die Ruprechtskir-chenverbauung, Ringturm, Gartenbau, Universitätsinstitute und nicht zuletzt die beispiellose „Donaukanalverbau-ung“; das sind nur wenige Spitzen eines breiten Massivs anonymen Bauschaffens, die keineswegs als einzelne Fehlleistungen dastehen. Man könnte auch in jeder anderen österreichischen Stadt eine ähnliche Liste zusammenstellen, und man müßte auch zu den gleichen Ursachen kommen. Kein Platz für Städtebau ...
In dem Buch „Die moderne Großstadt“ des Soziologen Hans Paul Bahr dt findet man folgende Stelle:
„... Den akademischen Schichten könnte man mit dem gleichen Recht vorwerfen, daß sie ihr Wissen, ihre Rede- und Schreibgewandtheit so wenig den Stadtgemeinden zur Verfügung gestellt haben, daß in ihrer umfassenden Allgemeinbildung soviel Platz für Literatur, Musik und bildende Kunst, aber kein Platz für Städtebau war ...“ Ihnen muß man ja vor allem die Schuld geben, wenn heute stadtplane-rische Entscheidungen faktisch nur durch gute oder schlechte Experten oder durch eigennützige Interessengruppen, denen die Experten erliegen, gefällt, dagegen nur selten Gegenstand öffentlicher Diskussion werden.
Unseres Erachtens sind städtebauliche Fragen popularisierbar, aber nur dann, wenn es eine vermittelnde Gruppe gibt. Und wer sollte diese sein, wenn nicht die Ärzte, die Lehrer, die Volkswirte, die Ingenieure und die gesellschaftskritischen Intellektuellen, die alle von ihrem Fachgebiet her einen Zugang finden können, wenn sie sich darum bemühen ... Erinnert sei nur daran, daß nach dem Krieg in Deutschland viele Innenstadtumpla-nungen am geschlossenen Widerstand von Geschäftsleuten gescheitert sind, die ihre Läden genau an der gleichen Stelle wieder aufbauen wollten, wo sie gestanden waren. Auch sie hatten längst verlernt, über ihre kurzfristigen Interessen hinaus an das Schicksal der Stadt zu denken. Auf jeden Fall fehlte das Regulativ einer umfassenden städtischen Öffentlichkeit, die einen Ausgleich mit den vorhandenen, wenn auch nicht formulierten Interessen aller hätte erzwingen können. Über den Wiederaufbau unserer Innenstädte wurde faktisch in Amtszimmern und an Stammtischen entschieden...“
Man kann bei diesem Zitat ruhig dem Begriff „Städtebau“ „Architektur“ zur Seite stellen und es stimmt genauso. Auch bei uns sind Städtebau und Architektur nicht Sache der Öffentlichkeit. Diskussionen über wichtige öffentliche Bauvorhaben werden selten in Erwägung gezogen, und wenn sie kaum zu vermeiden sind, wie beim Aligemeinen Krankenhaus der Stadt Wien, dann werden sie möglichst verzögert. Dabei ist tatsächlich großes Interesse am Bauschaffen vorhanden. Bauwerke sind ja eine Realität, die in das Leben jedes einzelnen stark eingreifen und dauernd zu Auseinandersetzungen zwingen. Natürlich gäbe es in Österreich zunächst viele Vorurteile wegzuräumen, die Diskussionen ziemlich aussichtslos erscheinen lassen. Das wäre aber die Aufgabe einer lebendigen Architekturkritik, die es praktisch bei uns nicht gibt. Wir sind sogar so weit, daß, wenn dazu Ansätze sichtbar werden, dann auch sofort (sogar in Fachkreisen) die Ferdinandsfrage gestellt wird: „Ja, dürfend denn das?“ Ist es nicht zum Beispiel Geschäftsstörung, das Werk eines Architekten, eines Büros oder das einer Firma zu kritisieren? Natürlich hängt das vor allem davon ab, ob man die Architektur als Kunst oder als Geschäft betrachtet.
Ist eine wache Öffentlichkeit, ein kritisches und verständiges Architekturpublikum nicht vorhanden, so verzichten auch schon die Architekten selbst teilweise auf ihre öffentliche Bedeutung, auf einen fairen und überprüfbaren Wettbewerb vor der Öffentlichkeit. Wäre es sonst denkbar, daß es sich bei einer so bedeutenden Sache, wie es ein Weltausstellungspavillon, als geistiger und künstlerischer Repräsentant eines Landes, ist, die Architektenschaft gefallen läßt, daß seine Vergabe ganz im stillen hinter Kammertüren ausgehandelt wird, anstatt daß man dazu einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben hätte? Natürlich steht es dem Wirt-schaftsförderungsinstitut der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft zu, jeden ihr richtig erscheinenden Architekten außerdem noch einzuladen, aber es ist sehr bedenklich, daß man sich ermächtigt fühlt, eine Sache, die ganz Österreich betrifft und repräsentiert, mehr oder weniger im Hause auszuhandeln.'
Viele der Besten wandern aus
Zu den entscheidenden Voraussetzungen für diese Lage gehört zweifellos, daß jene profilierten Architekten, die um 1930 das Gesicht unserer Architektur bestimmt haben, fast geschlossen emigrierten. Und fast alle sind nach 1945 nicht mehr oder erst spät zurückgekehrt, ob es sich nun um Josef Frank, Ernst P 1 i s c h k e, Ernst Lichtblau, Richard Neutra, Walter Loos, Oskar W1 a c h, H. A. Vetter, Rudolf B a u m f e 1 d, Hugo G o r g e, Heinrich K u 1 k a oder um Felix Au g e n f e 1 d handelt. Es ist interessant, daß fast alle diese Namen in der Wiener Werkbundsiedlung vertreten sind, die heute vielfach als die letzte Manifestation einer österreichischen Architektur mit internationalen Maßstäben bezeichnet wird.
War dieser erste große „Aderlaß“ von außerordentlichen Folgen, so gibt es ein zweites, auf lange Sicht vielleicht noch folgenschwereres Problem, nämlich das der Daueremigration unserer besten jungen Kräfte, die in Österreich nicht jene Anzahl guter Büros finden, die für ihre Weiterentwicklung notwendig wären. Gewiß spielen bei der Platzwahl auch ökonomische Überlegungen eine große Rolle. Aber es ist bekannt, daß gerade die besten Büros des Auslandes, die von Studenten belagert werden, am wenigsten bezahlen.
Die Daueremigration der jungen Kräfte wird gewiß auch durch ein Gesetz gefördert, das vorschreibt, daß jeder fertige Architekt fünf Jahre in einem inländischen Büro arbeiten muß, um die Prüfung zur behördlichen Befugnis machen zu können. Es wäre vernünftiger und erfolgversprechender gewesen, ein hartes Wettbewerbsklima mit internationalen Maßstäben zu schaffen und die jungen Architekten daran teilhaben zu lassen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Finnland, hat sich dadurch aus dem Chaos der Nachkriegszeit eine energische, vitale Architektengeneration herangebildet, von denen einzelne, schon bevor sie ihr Studium beendet hatten, international bekannt waren. In diesem Land sind heute Fragen der Architektur und Architekten sehr populär.
Bei uns hat man jedoch versucht, „sich's gut zu richte-,'\ Es ist eigentlich ein Wunder, daß es noch nicht den Rayons- oder Bezirksarchitekten gibt, wie es im Rauchfangkehrer-gewerbe oder in der Försterei üblich ist. Dieser Hang zur Sicherheit ist eines der typischsten Symptome des Provinzialismus.
Die Quellen freilegen!
Wien hat zwischen 1918 und 1938 kulturell noch von der weltstädtischen Substanz einer alten europäischen Metropole gelebt. Nach 1945 mußte man aber das zerbombte Erbe einer Provinzhauptstadt übernehmen. Diesei Erbe trat eine Generation an, die viele Jahre für Dinge opfern mußte, die weitab von persönlichen Interessen waren. So setzte im Wiederaufbau sofort ein Zug zu einem hohen, gesicherten Lebensstandard ein. Das ist verständlich und müßte nicht unbedingt ergeben, daß hier eine Parvenüwelt aufgerichtet wurde, die einen unbändigen Hang zur Repräsentation zeigt — Repräsentation als Selbstzweck und nicht als selbstverständliches Ergebnis einer Geisteshaltung.
Österreich hat nach 1945 keine überragende Architektenpersönlichkeit besessen, die als Orientierungspunkt und Maßstab im Kampf gegen diese Entwicklung gewirkt hätte. Da ein solches eigenes schöpferisches Zentrum fehlte, war man darauf angewiesen, ins Ausland zu fahren, um den Kontakt zu einer zeitgemäßen Architektur wiederzufinden. Man fuhr zuerst in Länder, die Inseln des Friedens geblieben waren und in jeder Hinsicht als vorbildlich erschienen: nach Schweden und in die Schweiz. Und man hat sich langsam an das Herumschauen gewöhnt. So war die erste Phase der architektonischen Nachkriegsproduktion eine Stilmischung aus Resten des Neoklassizismus der jüngsten Vergangenheit und den Einflüssen gemäßigter und stagnierender Moderne, wie sie in den Wohlstandsländern zum überwiegenden Teil heute noch herrscht. Es hat sich bei uns ein Eklektizismus breitgemacht, der langsam aus einem Historizismus in einen Modernismus überwechselt. Meilensteine auf diesem Weg sind in Wien der Heinrichshof und das Haus der Bundesländerversicherung.
Es wäre falsch, die Bemühungen einiger — vor allem jüngerer — Architekten zu übersehen, die jene Quellen freilegen wollen, aus denen einst eine originale, großzügige und weltoffene Architektur entsprang. Diese Bemühungen bleiben jedoch vergeblich, wenn sich nicht alle am Bauschaffen Beteiligten, vor allem aber die — meist öffentlichen — Auftraggeber und Bauherren dieser Aufgabe bewußt werden. Hierzu müßte aber auch die Öffentlichkeit ihre wichtige Rolle als Umschlagplatz der Ideen, als Träger der Kritik und als Feind der provinziellen Einmauerungsund Verschanzungstendenzen übernehmen. Kritik ist heute nicht mehr Urteilsspruch, sondern Fragestellung. Bei uns müßte sie eigentlich oft Provokation sein.