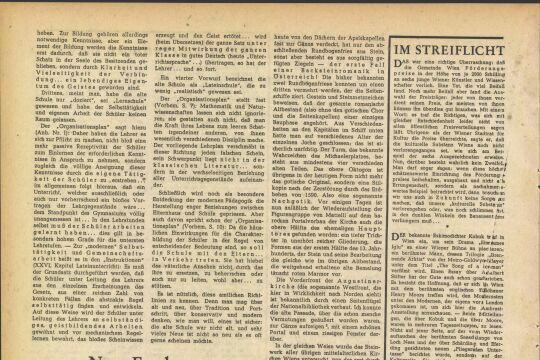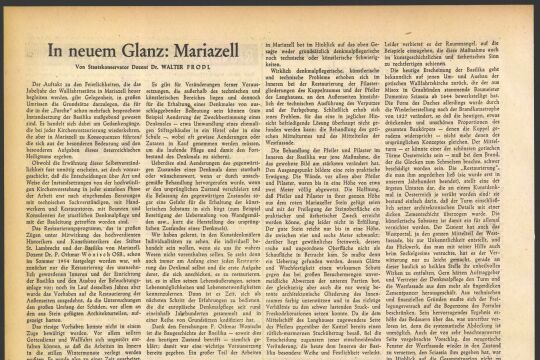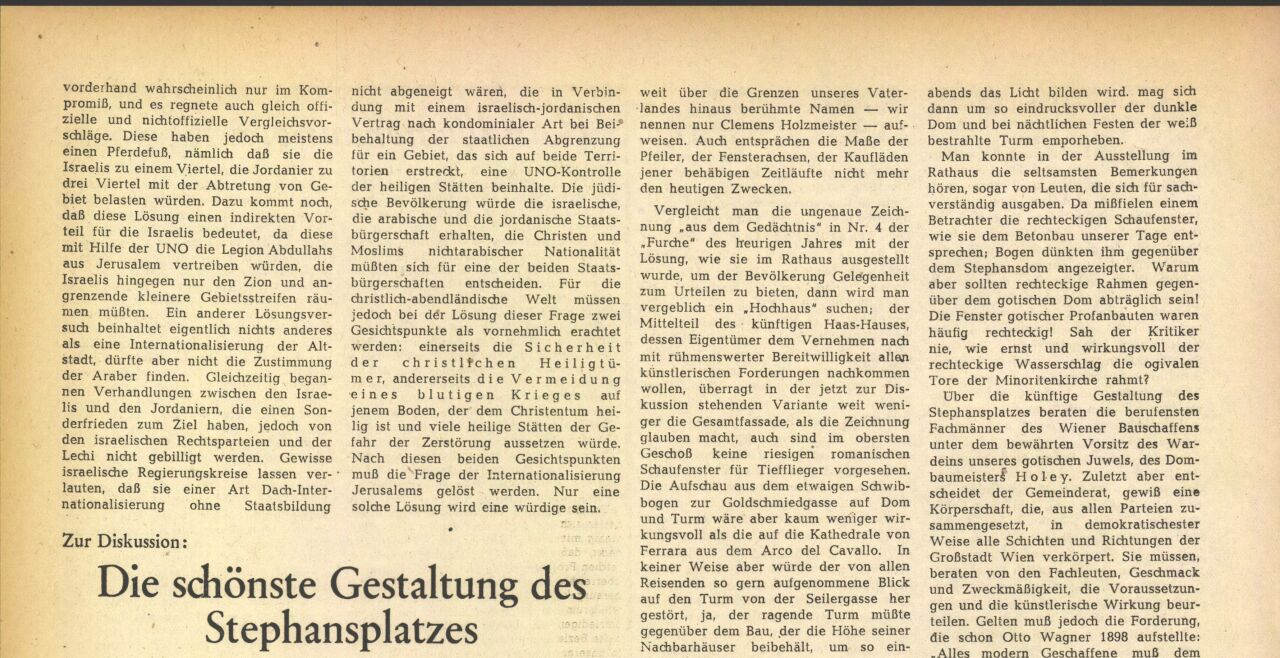
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die schönste Gestaltung des Stephansplatzes
In der Diskussion über die Gestaltung des Stephansplatzes ergreift heute Senatspräsident Dr. Kurt Frieberger, Präsident der Grillparzer-Gesellschaft und Vorstandsmitglied des .Verbandes der geistig Schaffenden“, der sich mit künstlerischen Fragen wiederholt befaßt hat, das Wort. Seine Ausführungen bewegen sich in einigem Gegensatz zu den früheren Darlegungen in der Furche“ (vgl. Furche“ Nr. 2 und 4/1950), müssen aber bei der Schwierigkeit des Gesamtfragenkomplexes gleichwohl gehört werden. Die österreichische Furche“
Die stürmischen Auseinandersetzungen über die Neugestaltung der Westwand des Stephansplatzes sind ein beglückender Beweis, wie sehr den Wienern das künftige Stadtbild am Herzen liegt. Ist nun die Kampfansage gegen Lösungen, die aus nahezu zwei Dutzend Entwürfen in Betracht gezogen werden, wirklich begründet? Ein Beirat hervorragendster Sachverständiger stand vor der schweren Wahl. Noch ist nichts endgültig entschieden. Viel wird von historischen Werten gesprochen, von Formen, auf die man zurückgreifen müßte, sichtlich ohne vorherige Einsicht in die vielen, zum Teil sehr schön ausgeführten Pläne früherer Jahrhunderte. Abgrenzung gegen alles Profane halten manche für geboten. Verkehrsprobleme werden kurzweg ab- • getan, weil ja die Rotenturmslraße sowieso zu eng bliebe. Aber der Autobusbahnhof vor dem Riesentor sollte doch verschwinden, nicht wahr? Geklagt wird über eine Schädigung der Sicht auf den Turm durch ein „Hochhaus“, ohne sich am Entwurf zu vergewissern, daß die ohnehin sehr geringe Erhöhung eines mittleren Teiles am künftigen Haas-Haus von nirgendwo zusammen mit dem Turm ins Auge gefaßt werden könnte.
Fromme Abgeschiedenheit im Brennpunkt großstädtischen Verkehrs könnte wohl nur erzielt werden, wollte man den Stadtkern museal konservieren, Verkehr und Geschäftsleben anderswohin verbannen. Träten in der Inneren Stadt an Stelle der Büros Wohnungen, so müßte den Bewohnern doch noch eine Möglichkeit des Einkaufs und der Zu- und Abfahrt geboten werden. Bliebe aber dann ein totes Stadtviertel übrig, dann hätte man Muße genug, um so recht zu erkennen, wie viel des Häßlichen auch nicht einen Blick mehr verdient. Man betrachte nur die noterzwungene Schauwand neben dem Haas-Haus in ihrer Trostlosigkeit oder die Schießschartenfenster des Trattner-Hofes und anderes mehr. Gäbe es in der Umgebung des Domplatzes nichts zu schauen als die Bausünden des abgelaufenen Jahrhunderts, müßte man nicht tief trauern über das Verlorene, dessen Andenken die Stiche von Pfeffel und Kleiner, die Aquarelle von Rudolf von Alt bewahrten?
Man vergleiche die überlieferten Stadtbilder. Da war das Heiligtum von Sankt SteDhan nur auf vier schmalen Wegen zugänglich.Vorgelagert war der Heiltums-stuhl und eine niedrige Flucht gemauerter Buden, die kaum erfreulicher wirkten als die Devotionalienstände um die Wallfahrtskirche der Patrona Austriae zu Mariazell. Ein Gesamtanblick des Domes war überhaupt von nirgends her möglich. Innerhalb des Stephansfreythofes stand man nämlich überall zu knapp vor dem Kirchenbau. Uber die-Umbauten hinweg störte den Blick allenthalben das erdnahe Gemäuer. Glücklicherweise ist der ehrfürchtig einfache Rahmen des Platzes für den Betrachter von der Brandstätte her unzerstört geblieben. Wollte man jedoch den Frieden des Platzes, sobald die Bauhütten abgetragen sind, auch westwärts vervollständigen, den Dom vom lauten Leben der Straße absperren, nichts entspräche weniger den Bestrebungen der Kirche in unserer Zeit, nichts weniger den Wünsdren des HI. Vaters Pius XII., Heiligtum und religiöses Leben sollen nicht dem Alltag entrückt werden. Im Gegenteil: gläubige Lebensführung, katholische Aktion, der Kreuzzug der Nädistenliebe eines P. Lombardi sollen an die Menschen herangetragen werden, Denken und Wandel durchdringen.
Auf welches historische Stadtbild wollte man zurückgreifen? Vom römischen Vin-dobona blieb die Krümmung der Stadtmauer im Grundriß der Grabenecke erhalten. Welch mittelalterliches Winkelwerk sich rund um die geliebte Kirche aufwölbte, zeigt der Blick in die Kärntnerstraße vom Jahre 1470, darin der „Meister des Schottenstiftes“ die Heimsuchung Mariae statthaben läßt. Rauher Zeit entsprach die Wehrhaftigkeit der Bürgerhäuser. Enge Tore sollten die Verteidigung erleichtern. Hochgelegen sind die spärlichen Fenster, Gemäuer ohne Geschäftsleben. Aus dem Wirrwarr über-schnittener Dächer ragen die Heidentürme, ragt Alt-St.-Peter. Für einen Ausblick moderner Ästheten ist kein Raum wahrnehmbar. So bildete auch das Ende der Goldschmiedgasse bis vor etwa hundert Jahren ein schmaler Engpaß. Der Graben war durch eine Fortführung der Ostwand der Dorotheergasse bis auf ein Gäßchen eingeengt, der Stock-im-Eisen-Platz abgeschlossen. Den schönen Blick von der Seilergasse auf den Turm gab es nicht.
Am ehesten entspräche unserer seelischen und wirtschaftlichen Lage eine Wiederholung der ruhig edlen Fronten der Häuser im Vormärz. Auch damals war — nach den napoleonischen Kriegen und dem Staatsbankrott — ein sparsames und sehr ehrliches Bauen geboten. In der nüchtern-ernsten Zeit des k. k. Hofbaurates Paul Sprenger täuschte man nicht mehr Hausteinfassaden vor. Man konnte sich keine großartigen Statuen leisten, obwohl das alte Laschansky-Haus Würde mit geschmackvollem Zierrat vereinte. Genaue Wiederholung alter Vorbilder wäre jedoch denkbar unkünstlerisch und ein Armutsbekenntnis der österreichischen Bauschaffenden, die noch immer weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus berühmte Namen — wir nennen nur Clemens Holzmeister — aufweisen. Auch entsprächen die Maße der Pfeiler, der Fensterachsen, der Kaufläden jener behäbigen Zeitläufte nicht mehr den heutigen Zwecken.
Vergleicht man die ungenaue Zeichnung „aus dem Gedächtnis“ in Nr. 4 der „Furche“ des heurigen Jahres mit der Lösung, wie sie im Rathaus ausgestellt wurde, um der Bevölkerung Gelegenheit zum Urteilen zu bieten, dann wird man vergeblich ein „Hochhaus“ suchen; der Mittelteil des künftigen Haas-Hauses, dessen Eigentümer dem Vernehmen nach mit rühmenswerter Bereitwilligkeit allen künstlerischen Forderungen nachkommen wollen, überragt in der jetzt zur Diskussion stehenden Variante weit weniger die Gesamtfassade, als die Zeichnung glauben macht, auch sind im obersten Geschoß keine riesigen romanischen Schaufenster für Tiefflieger vorgesehen. Die Aufschau aus dem etwaigen Schwibbogen zur Goldschmiedgasse auf Dom und Turm wäre aber kaum weniger wirkungsvoll als die auf die Kathedrale von Ferrara aus dem Arco del Cavallo. In keiner Weise aber würde der von allen Reisenden so gern aufgenommene Blick auf den Turm von der Seilergasse her gestört, ja, der ragende Turm müßte gegenüber dem Bau, der die Höhe seiner Nachbarhäuser beibehält, um so eindrucksvoller wirken.
Stören wird leider weiterhin das Singer- und das „Goldene - Becher“ - Haus. Nichts wäre dort inniger zu wünschen als ein Gebäude von den einfach edlen Formen des Churhauses. Gegenüber dem Riesentore aber ist endlich Gelegenheit zur Errichtung einer unaufdringlichen, harmonisch gegliederten Abschlußwand von der Geschlossenheit der Ummaue-rung des Josefs-Platzes. Wie einfach und klar, wie vornehm und frei von allem Auftrumpfen hat Fischer von Erlach etwa die Hofstallungen, den jetzigen Messepalast, zu gliedern verstanden. Vor ähnehrlichen Schauwänden, deren Zauber abends das Licht bilden wird, mag sich dann um so eindrucksvoller der dunkle Dom und bei nächtlichen Festen der weiß bestrahlte Turm emporheben.
Man konnte in der Ausstellung im Rathaus die seltsamsten Bemerkungen hören, sogar von Leuten, die sich für sachverständig ausgaben. Da mißfielen einem Betrachter die rechteckigen Schaufenster, wie sie dem Betonbau unserer Tage entsprechen; Bogen dünkten ihm gegenüber dem Stephansdom angezeigter. Warum aber sollten rechteckige Rahmen gegenüber dem gotischen Dom abträglich seinl Die Fenster gotischer Profanbauten waren häufig rechteckig! Sah der Kritiker nie, wie ernst und wirkungsvoll der rechteckige Wasserschlag die ogivalen Tore der Minoritenkirche rahmt?
über die künftige Gestaltung des Stephansplatzes beraten die berufensten Fachmänner des Wiener Bauschaffens unter dem bewährten Vorsitz des Wardeins unseres gotischen Juwels, des Dom-baumeisterl Holey. Zuletzt aber entscheidet der Gemeinderat, gewiß eine Körperschaft, die, aus allen Parteien zusammengesetzt, in demokratischester Weise alle Schichten und Richtungen der Großstadt Wien verkörpert. Sie müssen, beraten von den Fachleuten, Geschmack und Zweckmäßigkeit, die Voraussetzungen und die künstlerische Wirkung beurteilen. Gelten muß jedoch die Forderung, die schon Otto Wagner 1898 aufstellte: „Alles modern Geschaffene muß dem neuen Material, den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, wenn es zur modernen Menschheit passen soll, es muß unser eigenes, besseres, demokratisches, selbstbewußtes, ideales Wesen veranschaulichen und den kolossalen technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften Rechnung tragen.“ Daß jeder seinen Entwurf für den besten hält, ist eine begreifliche künstlerische Leidenschaft. Maßgebend sind die, deren Leben sich in diesen, um diese Bauten auf Jahrzehnte hinaus abspielt. Die höchste Forderung aber hat Hermann Bahr in die Worte gekleidet: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!