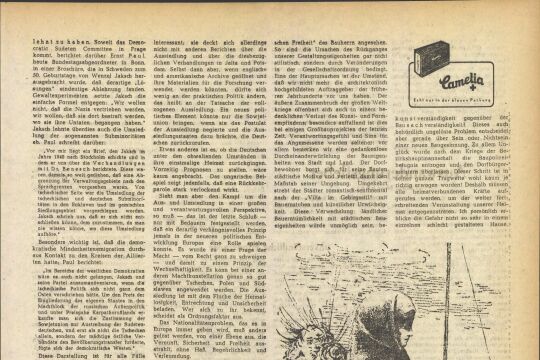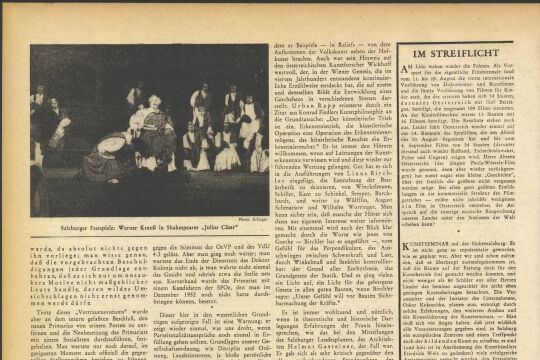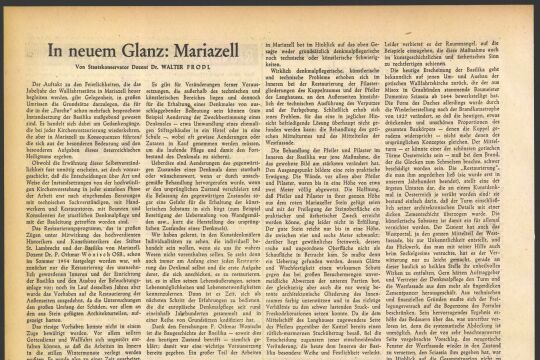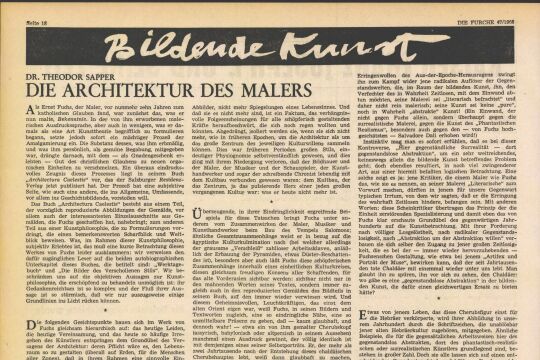' Ein leidenschaftlicher Aufsatz über diesen umstrittenen Gegenstand in der „Furche“ vom 5. April 1947 gipfelte in der Frage, mit welchem Recht man dem Volk die Freude an Glasgem'älden in Barockkirchen nehmen wolle. Richtiger gefaßt, ollte sie lauten: Aus welchen Gründen glauben die für die Erhaltung unseres Kunstbesitzes verantwortlichen Stellen, die Anbringung von Glasgemälden als eine Schädigung der künstlerischen Wirkung und damit auch der Würde barocker Kirchenräume betrachten zu müssen?
Die Bemühungen der Denkmalpfleger, durch strenge, gewissenhafte Prüfung aller zu erwägenden Umstände Fehlentscheidungen zu vermeiden, sind auch in diesem Falle vielfältige. Den ersten Schritt stellt das Zurückblicken auf die Jahrzehnte hindurch gemachten Erfahrungen dar: Jeder, der mehrfach mit der Ausmalung von Kirchen zu tun hatte, wird sich davon überzeugt haben, wie verschiedenartig der Eindruck ein und desselben Wand- oder Gewölbetons ist, wenn die Fensterverglasung auch nur geringe farbige Teile, etwa einen schmalen bunten Rand, aufweist. Bei einer einfachen Tönung der Flächen können solche Abwandlungen der Eigenfarben der Raumschale durch buntes Licht hingenommen werden. Verhängnisvoll wirkt sich dieses jedoch aus, wenn es auf Gemälde oder eine wohlabgewogene farbige Raumausstattung auffällt. Eine solche war aber gerade das Ziel, das der Barockarchitekt verfolgte, mag es durch Wandmalerei, durch das Uberziehen der Mauerflächen mit Stuckmarmor oder durch die Marmorierung und Vergoldung der hölzernen Kircheneinrichtungsstücke angestrebt worden sein. Daß hiebei eine Unzahl von Zwischentönen vorherrschen, die der Art des auffallenden Lichts gegenüber sehr empfindlich sind, ist selbstverständlich. Besonders deutlich wird dies, wenn man sich die mannigfaltigen Farbenübergänge vergegenwärtigt, die der illusionistischen Malerei, mag es sich um eine Scheinarchitektur oder die Vortäuschung überirdischer Begebenheiten handeln, eigen ist. Ein schlagendes Beispiel für die Gefahr, die farbiges Licht für eina barocke Raramausstattung bedeutet, bietet eben jetzt die Notverglasung der Universitäts- (Jesuiten-) Kirche in Wien, bei der in Ermangelung farbloser Scheiben, gelbes oder graues Glas hat verwendet werden müssen: die auf Andrea Pozzo zurückgehenden Deckengemälde sind ihrer Wirkflng völlig beraubt; ja auch die farbige Gesamthaltung des Raumes ist aufs schwerste getroffen. Zum Glück handelt es sich hier nur um einen vorübergehenden Zustand.
Die Farbigkeit der gotischen Innenarchitektur hatte diese hohe Empfindlichkeit gegenüber der Art des auffallenden Lichtes noch nicht besessen. Die wenigen verwendeten Grundfarben, die nur in beschränkten Flächen harmonisch zueinander gestimmt waren, konnten um vieles leichter dem bunten Licht der Scheiben gegenüber sich behaupten, ja mit diesem wetteifernd, kontrapunktische Verbindungen mit ihm eingehen.
Ebenso wie die Farbenverteilung im barocken Räume eine einheitliche, harmonisch in sich geschlossene ist, finden wir auch alle Bildwerke und Zierformen aufs reifste durchdacht, in einer Weise verteilt, daß sie einander das Gleichgewicht halten oder eine Steigerung in ihrer Abfolge bewirken. Das Einführen neuer dekorativer Akzente in Flächen, die als neutral behandelt vorgesehen gewesen waren, hat daher Fehlbetonungen zur Folge, die die Gesamtwirkung aufs schwerste schädigen. Aus diesem Grunde wären sogar in Darstellungen in den Fenstern einer Barockkirche, auch in den Fällen, in denen jene nicht wohlberechnete Öffnungen gegen den Freiraum hin sind, für die Wirkung des Raumes höchst nachteilig.
Dies sind die Lehren eigener Erfahrung. Weitere können wir aus der geschichtlichen Betrachtung ziehen: Verfolgen wir die Entwicklung der Innenräume, so stoßen wir erst im Barock auf eine nicht bloß den einzelnen Raumabschnitt, sondern den Gesamtraum erfüllende, mannigfach abgewandelte Lichtkomposition; erst hier könnte man gleichsam von einer einheitlich geformten umbauten Lichtmasse sprechen. Die Grundvoraussetzung für eine solche Behandlungsmöglichkeit war es aber, daß der durchzubildende Stoff — ebenso wie der Modellierten keine Steinbrocken enthalten darf — ein durchaus gleichmäßiger ist. Aus diesem Grunde, und nidit wegen eines zufälligen Schwindens der technischen Kenntnisse der Glasmalerei — über das Fortleben der Schmelzmalerei auch im späten 17. und 18. Jahrhundert kann man sich leicht unterrichten 1 —, ist auf die farbige Behandlung der Fenster in Barockkirchen Verzicht geleistet worden.
Wenn wir bisher immer wieder schlechtweg von einem Barockraume gesprochen haben, so hatten wir dabei Hauptleistungen der österreichischen Barockbaukunst im Auge. Neben diesen gibt es aber unter den Kirchenbauten des Barock eine Unzahl kleiner Kirchenräume, die wohl ihre Entstehung in dem Zeitalter dieses Stils nicht verleugnen, bei denen jedoch wegen der Einfachheit der Raumform und dem Fehlen einer künstlerischen Ausstattung die wesentlichsten Gründe, die gegen die Anbringung von Glasgemälden gesprochen hatten, nicht vorliegen. In diesen Fällen scheint eine Bereicherung der Ausstattung des Raumes, der sich oft im wesentlichen von kleinen einschiffigen Kirchen der Spätgotik kaum unterscheidet, durch Glasgemälde erwogen werden zu können. Allerdings muß hiebei mit großem künstlerischen Takte vorgegangen werden.
Der Hinweis auf solche Sonderfälle wird vielleicht von vielen als eine Bestätigung des Vorwurfs betrachtet werden, daß die Grundsätze der Denkmalpflege äußerst schwankende seien. Es liegt aber eben einmal in dem Wesen der Behandlung von Kunstwerken, daß die Regeln des Vorgehens keine starren sein können: müssen doch in jedem Falle die besonderen Umstände, unter denen die richtige Lösung gefunden werden muß, gewissenhaft berücksichtigt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß der Rahmen, innerhalb dessen Entscheidungen getroffen werden können, kein klar umschriebener sei; es ist daher durchaus irrig, zu glauben, daß jede Entscheidung nur dem subjektiven Empfinden des jeweiligen Denkmalpflegers entspringe und daß weiterhin auch jeder Laie, dem alle Erfahrung und die Übung, die fallweise verschiedenen Voraussetzungen richtig zu werten, fehlt, tun könne was ihm beliebe. *
Wohl haben die allgemeinen Richtlinien der Denkmalpflege, da sie von dem Stand der Kunstforschung, die zwangsläufig wie jede andere Wissenschaft im Zuge der Gewinnung neuer Einsichten einer Entwicklung unterworfen ist — in der Heilkunde zum Beispiel nehmen wir alle ihre Schwankungen als eine Selbstverständlichkeit hin —, Wandlungen durchgemacht. Seit der wissenschaftlichen Unterbauung der Denkmalpflege, die allerdings erst verhältnismäßig spät erfolgt ist, war der Entwicklungsverlauf jedoch ein durchaus stetiger. Denn an den Leitgedanken, die Alois Riegl in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts aufgestellt hat *, hat keine entscheidende Abänderung vorgenommen werden müssen.
Auch ist es unrichtig, aus diesen Grundsätzen den Schluß zu ziehen, daß dadurch die Kirchen zu Museen für die in früheren Jahrhunderten entstandenen gegenständlichen Fassungen religiösen Empfindens würden. Immer wieder vertritt die öffentliche Denkmalpflege den Standpunkt, daß, wie in alter Zeit, neue Herstellungen in dem Geiste der eigenen Tage durdigeführt werden müssen. Den Beurteilern von Entwürfen für solche Neuherstellungen wird es allerdings nicht leicht gemacht: Denn während in früheren Jahrhunderten infolge des in einem jeden
1 Vgl. z. B. Hermann Schmitz, „Die Glasgemälde des Kgl. Kunstgewerbemuseums in Berlin“, Berlin 1913, I. Bd. (Text), S. 225 ff.
1 Vgl. insbesondere „Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung“ (Einleitung zu einem Entwurf für ein Denkmalschutzgesetz), Wien 1903; abgedruckt in Alois Riegl, Gesammelte Aufsätze, Augsburg -Wien 1929, S. 144 bis 193).tief wurzelnden Kunstempfindens, jeder Künstler und Auftraggeber nicht minder wie jeder ausführende Handwerker mit unglaublicher Sicherheit wußte, was sich ziemt, wenn ein neues Werk in den Wetteifer mit der Kunstschö ng früherer Jahrhunderte zu treten hatte, ist diese Feinfühligkeit durch die zahllosen Umstände, die unsere heutige niedrige Kulturstufe bedingt haben, weitgehend verlorengegangen. In solchen Verhältnissen ist man im Interesse der Sache genötigt, in erster Linie auf die begründeten Darlegungen jener zu hören, deren Lebensberuf es ist, in das Wesen der alten Kunstwerke so tief einzudringen, daß sie mit weitgehender Sicherheit es zu sagen vermögen, was die Wahrung ihrer ungeschmälerten Wirkung erheischt.
Es soll nicht geleugnet werden, daß dieser Zustand kein gesunder ist. Ebenso wie jeder Richter und jeder Arzt, wünscht auch jeder Denkmalpfleger nicht mehr notwendig zu sein. Während es in der Geschichte des Rechtslebens und der Gesundheitspflege jedoch kaum einen Zeitraum gegeben hat, in dem der Wahrer des allgemeinen Wohles nicht vonnöten gewesen wäre, bestand in früheren, kulturell auf einer hohen Stufe stehenden Jahrhunderten tatsächlich nicht annähernd im gleichen Ausmaße wie heute die Notwendigkeit, durch einen eigenen Zweig der Verwaltung auf die Erhaltung des Kulturbesitzes früherer Zeiten hinzuwirken. Die Eigentümer von Kunstwerken trugen aus eigenem für deren Erhaltung Sorge und, wo dies einer Gemeinschaft oblag, war der Gemeinsinn ein so entwickelter, daß durch das Zusammenwirken aller das jeweils Erforderliche herbeigeschafft werden konnte; wo aus Erneuerungssucht ein altes Kunstwerk einem neuen weichen sollte, war es oft gerade der mit dessen Schaffung beauftragte Künstler selbst — wir denken dabei an die geradezu ergreifende Ablehnung des Bildhauers Thomas Schwanthaler, den Flügelaltar Michael Pachers in St. Wolfgang am Abersee durch ein eigenes Werk zu verdrängen —, der für die Erhaltung des durch ihn zu ersetzenden Werkes eintrat. Und wo ein Künstler im Anschlüsse an die Werke früherer Jahrhunderte etwas Neues zu schaffen hatte, gechah dies mit einem künstlerischen Feingefühl, das dem alten Werke ebenso wie dem neugeschaffenen von Nutzen war. In diesen „paradiesischen“ Zustand der Stellung zu unseren Kulturdenkmalen wieder zurückzufinden, sollte das Bestreben eines jeden sein. Der Weg dahin kann leicht beschritten werden: es gilt nur mit offenen Auge alle Werte in sich aufzunehmen, die die Werke erprobter Künstler allenthalben uns darbieten, in den Mitmenschen die tiefe Empfänglichkeit für all diese Schönheiten heranzubilden und sich jedes Urteils zu enthalten, das zwangsläufig wegführt von dem Ziele, dessen Verfolgung geboten ist.
Wie es sich mit der Fama ▼erhält, ist allen bekannt Warum ist die Fama ein Übel? Weil sie geschwind ist? Weil sie eine Verräterin ist oder weil sie meistens lügt? Sie ist auch nicht einmal dann, wenn sie etwas Wahres weiterträgt, vom Fehler des Lügens hei, indem sie an der Wahrheit Abstriche, Zusätze oder Änderungen vornimmt. Noch mehr, es ist mit ihr so bestellt, daß sie nur besteht, indem sie lügt. Und wirklich, sie lebt nur so lange, als sie nicht beweist. Sobald sie etwas bewiesen hat, hört sie auf, Fama zu sein; als ob sie sich Ihres Amtes, Überbringerin von Nachrichten zu sein, entledigt hätte, übermittelt sie jetzt eine Tatsache... _, ... ... ... „„„, , . , ..
' Tertullian (zirka 160—220) im ApologaUcum