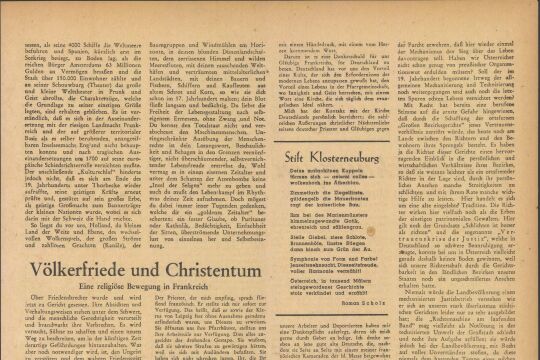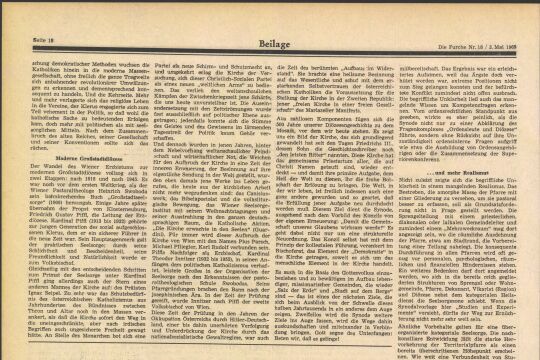Das Ärgernis des kirchlichen Eheprozesses
Unter diesem Titel veröffentlichte der Bonner Kirchenrechtler, Prof. Heinrich Flatten, seine Antrittsvorlesung (Paderborn 1965). Die Publikation ist um so beachtlicher, als Flatten, angesehener Kirchenrechtler und Vizeoffizial von Köln, durchaus nicht im Lager progressiver Nörgler oder nichtinformierter Reformer zu suchen ist. Die Veröffentlichung fällt noch in die erste Phase der durch das Konzil hervorgerufenen Entwicklung, teilt jedoch nicht das Schicksal so vieler in Hast hingeworfener Reformvorschläge. Die Folge dieser Eilfertigkeit war es unter anderem, daß nach einer Flut von Publikationen, die vielfach einem geringen Sachverstand entsprungen «waren, eine Ermüdung eingetreten ist. Wenn nun nach dieser Periode des Dilettantismus das Wort der Fachleute, die in lebendiger Verbindung mit der Wirklichkeit stehen, Aufmerksamkeit findet, ist der Sache mehr gedient, selbst wenn das Anliegen energisch oder auch provozierend vorgetragen wird.
Unter diesem Titel veröffentlichte der Bonner Kirchenrechtler, Prof. Heinrich Flatten, seine Antrittsvorlesung (Paderborn 1965). Die Publikation ist um so beachtlicher, als Flatten, angesehener Kirchenrechtler und Vizeoffizial von Köln, durchaus nicht im Lager progressiver Nörgler oder nichtinformierter Reformer zu suchen ist. Die Veröffentlichung fällt noch in die erste Phase der durch das Konzil hervorgerufenen Entwicklung, teilt jedoch nicht das Schicksal so vieler in Hast hingeworfener Reformvorschläge. Die Folge dieser Eilfertigkeit war es unter anderem, daß nach einer Flut von Publikationen, die vielfach einem geringen Sachverstand entsprungen «waren, eine Ermüdung eingetreten ist. Wenn nun nach dieser Periode des Dilettantismus das Wort der Fachleute, die in lebendiger Verbindung mit der Wirklichkeit stehen, Aufmerksamkeit findet, ist der Sache mehr gedient, selbst wenn das Anliegen energisch oder auch provozierend vorgetragen wird.
Die Unzufriedenheit mit den geltenden Normen und einer mit ihr teilweise konformen, teilweise aher auch sie vernachlässigenden Praxis beruht auf prozeßtechnischen wie auch meritorischen Erwägungen. An erster Stelle wird die beträchtliche Zeitdauer, die das kirchliche Verfahren beansprucht, genannt. Unnötige Förmlichkeiten, die Schriftlichkeit des Verfahrens und die durch sie bedingte sukzessiv und in größeren Zeitabständen sich abwickelnde Tätigkeit der einzelnen Prozeßbeteiligten, verlängern die Dauer mindestens um Monate, bei weniger expe-dit arbeitenden Gerichten auch um Jahre. Allein die Befragung von Parteien und Zeugen erstreckt sich in der Regel auf einen Zeitraum, für den im Durchschnitt ein halbes Jahr anberaumt werden kann. Rechtsbei-stand und Ehebandsverteidiger benötigen für die Einbringung ihrer Schriftsätze eine Zeitspanne, die nicht viel darunter liegt. Das Aktenstudium, dem sich die drei Richter anschließend widmen, verlängert abermals das Endstadium eines Verfahrens.
Wenn den unzufriedenen Prozeßparteien gesagt wird, daß nach Rechtsvorschrift ein erstinstanzliches Verfahren zwei Jahre nicht überschreiten dürfe, und man habe sich gerade noch an diesen Termin gehalten, so ist das menschlich doch ein geringer Trost. Dies um so weniger, als nach günstigem Abschluß eines Verfahrens das Urteil von der höheren Instanz bestätigt werden muß. Es darf zwar beim Berufungsverfahren mit einer kürzeren Dauer gerechnet werden, dennoch bedingt nicht nur die zeitliche Sutmmiation von Prozeßvorgängen, sondern die dadurch hervorgerufene Spannung eine arge psychische Belastung. Nach etwa drei Jahren, mitunter auch nach einer Zeitspanne, die das doppelte beträgt, erfolgt die lang erwartete Entscheidung. Sie fällt in jene Jahre des Lebens, in denen menschliche Entscheidungen rascher erfolgen müssen, wenn nicht Chancen vertan werden sollen. Der Abbau überflüssiger Prozeßformalitäten, vor allem der Pflicht, in allen Fällen eine zweitinstanzliche Bestätigung einzuholen, wäre ein erster Schritt zur Raffung der Termine. Eine strengere Handhabung bei Einräumung von Fristen (für Richter, Advokaten und Ehebandsverteidiger) könnte viel dazu beitragen, die Vorlage von Schriftsätzen sowie die Vorbereitung der Urteilsberatung zu beschleunigen.
Dies alles ließe sich jedoch nur bei einer weitreichenden Änderung der bisherigen Gerichtsverfassung ermöglichen. Zwischen jenen Extremen, die durch Konzentration aller Eheprozesse beim Heiligen Stuhl und dem Fortbestehen von Gerichten an jedem Bischofssitz gegeben sind, dürfte die gesunde Mitte liegen. Sie strebt eine Zusammenfassung zu Regionalgerichten für eine oder mehrere Kirchenprovinzen an. Darin hegt kein Vorwurf gegen jene kirchlichen Richter, die ehren- oder nebenamtlich die zusätzliche Last der kirchlichen Gerichtsbarkeit auf sich genommen haben. Anders ließe sich der Betrieb an den bischöflichen Gerichten nicht mehr aufrechterhalten.
Dazu kommt noch der Umstand, daß manche Diözesangerichte genötigt sind, die Rolle von Berufungsgerichten zu übernehmen, im Wege der Delegation gar in dritter Instanz, obgleich die Qualifikation kaum für die erste Instanz ausreicht Überzeugend für die Güte des richterlichen Spruches ist aber nicht der Grad im Instanzenzug, sondern die innere Qualität der Entscheidung. Das Streben zur inneren Wertigkeit müßte sich in Ausbildung, Praxis und rigoroser Auswahl kirchlicher Richter zeigen. Diese Notwendigkeit wird in Zukunft um so größer werden, als durch den Ausbau einer Verwaltungsgerichtsbarkeit für größere Bereiche (Regionen, Länder) die Aufgaben der kirchlichen Rechtsprechung vielgestaltiger werden. Die bisherige Tätigkeit, die wesentlich auf die Ehegerichtsbarkeit eingeschränkt war, wird dadurch eine Ausweitung erfahren. Zum besseren Verständnis dieser im Werden begriffenen Neuerung sei noch einiges bemerkt. Die bisherige Rechtsordnung kannte als Rechtsmittel gegen eine Verwaltungsentscheidung des Bischofs lediglich den Rekurs an eine Verwaltungsbehörde des Heiligen Stuhles (Kongregation). Die Behandlung des Falles erfolgte zumeist ohne regulären Prozeß. Der Beschwerdeführer lernte die gegen ihn vorgebrachten Gründe nicht kennen, es fehlte ihm das Recht der Verteidigung in der üblichen Form, die Namen der mit dem Fall betrauten Konsultoren blieben ihm unbekannt, die Entscheidung enthielt in der Regel keine Erwähnung der ihr zugrundeliegenden Motive, sondern beschränkte sich auf die Wendung, dem Rekurs sei stattgegeben beziehungsweise er sei verworfen worden.
Nun wurde im Zuge der Kiurien-reform am Apostolischen Gerichtshof der Signatur eine eigene Sektion für die Verwaltungsgerichtsbarkeit geschaffen. Diesem ersten Schritt müßten weitere folgen, indem ein Ausbau nach unten stattfindet, so daß der Heilige Stuhl erst in zweiter oder nur in dritter Instanz angegangen werden müßte.
Man könnte hier kurz sagen: Was den Eheprozeß durch ein zuviel an Prozeßformalitäten belastet hat, fehlte in der kirchlichen Verwaltung bisher in um so größerem Maße.
Eine dadurch notwendig gewordene Aufwertung der kirchlichen Gerichte läßt sich nur durch eine Konzentration erreichen, wie sie in Italien und auch einigen anderen Ländern durch Herausbildung von Regionalgerichten gegeben ist.
Der Verzicht auf eine Bestätigung des Urteiles durch eine höhere Instanz wird am ehesten zu verantworten sein, wenn sich bereits das erstinstanzliche Urteil durch Zuverlässigkeit auszeichnete. Dies erfordert eine entsprechende Besetzung des Gerichtshofes, wie sie oft nur durch eine überdiözesane Zusammenarbeit zu erreichen ist. Es wirkt auf die Prozeßparteien nicht vertrauenerweckend, wenn die Divergenz zwischen Erst- und Berufungsgerichtshof allzu kraß in Erscheinung tritt. Geradezu entmutigend ist es, wenn schon ein Vorurteil besteht, das eine Gericht werde die Ungültigkeit der Ehe wahrscheinlich aussprechen, das Obergericht mit noch größerer Wahrscheinlichkeit den Spruch verwerfen, und eine dritte Instanz tendiere zumeist dahin, dem Erstgericht recht zu geben. Die Sympathie gilt durchwegs jenem Gericht, das mit affirmativen Ehenichtigkeitsurteilen nicht geizt; es erfreut sich des Rufes, milde zu sein, als werde die Wahrheitsfindung durch die Begriffe der Milde oder Strenge regiert. In diesem Widerstreit von Hoffnung und Enttäuschung ist es psychologisch nicht leicht, das eigene Gewissen mit einander widersprechenden Entscheidungen in Einklang zu bringen.
Auf dieser Linie liegt auch die Divergenz zwischen dem eigenen Dafürhalten und einem durch Beweis abgesicherten Urteil. Der Seelsorger wird versucht sein, das gerichtliche Vorgehen nur noch als einen Versuch zu werten, die Dinge auf diesem Wege behördenkundig zu machen und somit einer äußeren Rechtsregel zu unterwerfen. Versagt das Mittel, so stünden dem Gewissen — so hört man es nicht selten — andere Auswege zu Gebot; auf die Erkenntnis hin, daß die Ehe nichtig sei und nach einer vor dem Trauungspfarrer abgegebenen Erklärung müßte der Weg zur neuerlichen Eheschließung offenstehen. Wenn diese Bekundung der persönlichen Überzeugung gar unter Eid erfolge, sei es zu verantworten, wenn auf die peinliche und zeitraubende Prozedur überhaupt verzichtet werde. Wer auf diesen Vorschlag die Klage zu vernehmen meint, daß dann die Ehegerichte unnötig seien, ist an die Fragestellung nur peripher herangetreten. Die Gerichtsbarkeit ist nicht Selbstzweck und wird am wenigsten von jenen kirchlichen Richtern als solcher empfunden, die von der Undankbarkeit ihrer Aufgabe überzeugt sind, wenn menschliche Erfüllung und unmittelbar seelsorgliche Leistungen als Maßstab dienen. Das Wesen der Gerichtsbarkeit muß viel mehr im Rechtsschutz gesehen werden, ganz- gleich, ob es private Interessen sind, die im Widerstreit stehen, oder zwischen Gemeinschaft und Individuum ein Konflikt entstanden ist. Nun ist aber die Ehe nicht einzig und allein der privaten Sphäre überlassen. Wer die Kirche anruft, um die Anerkennung einer Bindung für den Rechtsbereich zu erlangen, muß auch jene Sicherheit verbürgen, die dieser Rechtsbereich fordert.
Sicherlich gibt es Fälle, in denen der Mangel eines Beweismittels, etwa des Taufscheines oder des Nachweises, daß nicht eine frühere eheliche Bindung vorliegt, durch einen Manifestationseid wettgemacht werden kann. Warum geht das bei einer Eheungültigkeit nicht? Weil hier, im Gegensatz zu Taufe oder Vorehe, nicht über eine feststehende Tatsache ausgesagt wird, sondern das Erkennen der Ungültigkeit auf einem schlußfolgernden Denken beruht und daher nicht Bekundung, sondern Beurteilung dessen ist, was bekundet wurde.
Die Gegensätzlichkeit zwischen der Überzeugung des Antragstellers und der Beurteilung, die er durch ein Gericht erfährt, kann nicht auf einen
Nenner zurückgeführt werden. Oft genug ist es eine irrige Einschätzung der eigenen Lage, weil die Kenntnis der Rechtsprinzipien fehlt oder die Verbitterung nach einer zerbrochenen Ehe die objektive Beurteilung erschwert, ja vielleicht sogar die Tatsachen anders erscheinen läßt. Von den Fällen einer bewußten Irreführung soll gar nicht die Rede sein; diese Gefahr liegt in jedem menschlichen Tun und verhindert es, nach einer absoluten Gewähr gegen Mißbrauch zu suchen.
Weitaus brennender ist die Frage, wie eine Zweigleisigkeit überwunden werden kann, wenn die Ungültigkeit objektiv gegeben ist und von den Eheleuten auch so dargestellt wird, daß ihre Aussage den Schluß zuließe, hier handle es sich mit Sicherheit um eine ungültige Eheschließung. Nun gilt nach dem heutigen Recht das Parteiengeständnis im Eheprozeß nicht als voller Beweis, weil ihm der Legalverdacht anhaftet, es sei im eigenen Interesse erfolgt.
Es wird ferner bemängelt, daß für den Zeugenbeweis, er ist eigentlich das Beweismittel schlechthin, immer noch die Aussage von zwei oder drei einwandfreien Zeugen gefordert wird. Zunächst muß mit einem doppelten Mißverständnis aufgeräumt werden. Die Parteienaussage, prozeßtechnisch als „Geständnis“ bezeichnet, und der Beweis durch weniger als zwei Zeugen wird nicht einfach-hin als völlig wertlos hingestellt, sondern gilt als unvollständiger Beweis, ihm kommt keine volle Beweiskraft zu.
Sicherlich ist es in diesem Zusammenhang berechtigt, eine eindeutige Hinwendung zur freien Beweiswürdigung zu vollziehen und damit den kanonischen Prozeß von den Überresten der formellen Beweistheorie zu befreien. Damit wird die Konfliktsituation überwunden, wie sie sich aus einem abweisenden Urteil wegen Beweisnotstandes trotz objektiv gegebener Ungültigkeit, von der die Eheleute auch subjektiv überzeugt sind, ergibt.
Diese Überlegungen sind heute so allgemein, daß von einem Vorstoß zu zweckmäßigeren Verfahrensweisen nicht mehr die Rede sein muß, sondern nur noch ven einem Vollzug dessen, was sich bereits als Postulat herauskristallisiert hat und die Bisohofskonferenzen einzelner Länder beschäftigt. So gelang es den Bischöfen der Vereinigten Staaten, durch eine Eingabe an den Heiligen Stuhl schon vor Erscheinen des neuen Gesetzbuches für ihren Bereich eine Änderung der noch bestehenden Bestimmungen zu erlangen
Damit könnte der Eindruck entstehen, als sei ein Mittel in Entwicklung begriffen, durch das allen jenen eine Hilfe geboten werden könnte, die nach dem Zusammenbruch der Ehe sich nicht in der Lage sehen, für den Rest ihres Lebens notgedrungen ein zölibatäres Da-'sein zu führen. Die Last, die damit verbunden wäre, reicht über die Grenzen dessen, was durch den Begriff der Enthaltsamkeit abgesteckt wird.
Um so wichtiger ist es, keine Illusionen aufkommen zu lassen. Uns stehen die Zahlen der abgeschlossenen Ehenichtigkeitsverfahren für das Jahr 1966 zu Verfügung. Es wurden in Italien 825 Verfahren durchgeführt, in Deutschland waren es 580, in der ganzen übrigen Welt 845. Diese Zahlen stellen einen geringen Bruchteil aller geschiedenen oder innerlich zerbrochenen Ehen dar. (Vergleichsweise sei erwähnt, daß in Österreich die Zahl der in einem Jahre durch Urteil abgeschlossenen Verfahren kaum jemals ein halbes Hundert übersteigt.)
Seelsonglich gesehen ist das Nichtigkeitsverfahren nicht der normale Weg zur Bereinigung eines Gewissenskonfliktes, sondern nur eine Ausnahme. Weder die Reformen des Prozeßrechtes noch die Neufassung der Ehenichtigkeitsgründe, über die in diesem Zusammenhang noch nicht gesprochen wurde, vermag die Zahlen so zu strecken, daß sie den Umfang eines Allheilmittels anzunehmen vermöchten.
Grundsätzlich wird man von einer glaubwürdig wirkenden Ehejudika-tur erwarten müssen, daß sie nicht durch außersachliche Erwägungen, seien sie in ihrem Motiv noch so edel, Verzerrungen erleidet. Weder die Furcht, daß es zu viele Verfahren geben könne, noch das Verlangen, überall eine Ehenichtigkeit-zu wittern, können zum Maßstab werden. Ganz abgesehen von dieser inneren Notwendigkeit, ist es die Ehrlichkeit vor einer kritisch beobachtenden Welt, die es verbietet, sich zum Prinzip der Unauflöslichkeit zu bekennen, in der Praxis jedoch durch fragwürdige Künste der Rechtsprechung diesen Grundsatz zu umgehen.