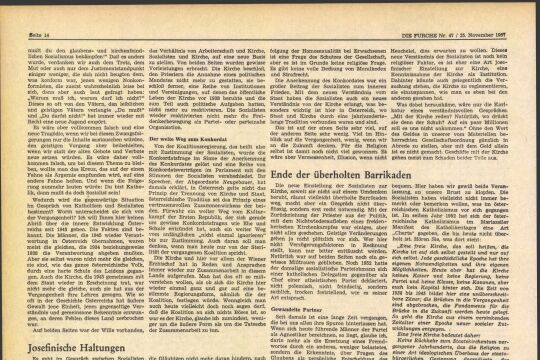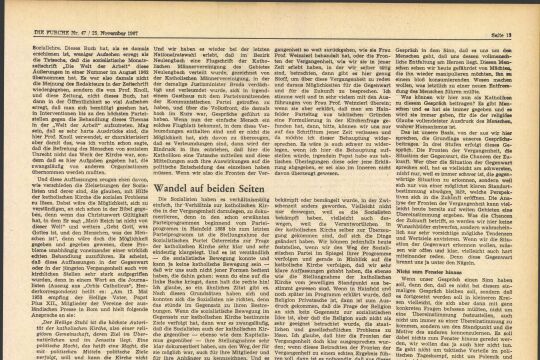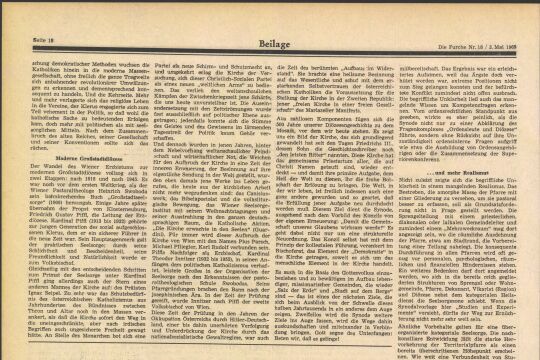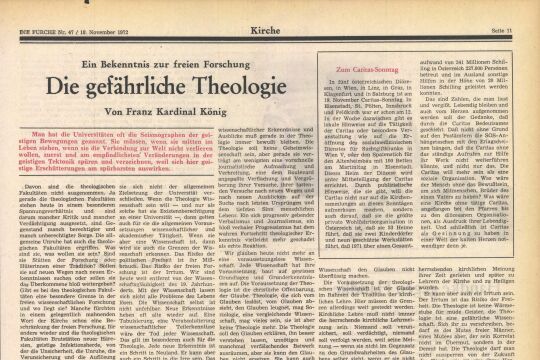Die falsche Kritik an Rom
Die Begleitmusik zur Promulgation des neuen Mischeherechts war nicht immer erfreulich, schon deshalb nicht, weil sie der Verkündung nicht folgte, sondern ihr bereits vorausging. Die Bischöfe waren schon vorher im Besitz eines Dokumentes, dessen Freigabe bis zum 30. April gesperrt war. Bis zu diesem Tage sollte die Möglichkeit geboten werden, offizielle oder zumindest offiziöse Kommentare zu verfassen. Undichte Stellen in diesem weitgespannten Netz führten dazu, daß die Nachricht von der Presse schon früher aufgegriffen wurde und vor jedem kirchenamtlichen Kommentar eine Welle emotionsgeladener Stellungnahmen die nachfolgende Verlautbarung überflutete.
Die Begleitmusik zur Promulgation des neuen Mischeherechts war nicht immer erfreulich, schon deshalb nicht, weil sie der Verkündung nicht folgte, sondern ihr bereits vorausging. Die Bischöfe waren schon vorher im Besitz eines Dokumentes, dessen Freigabe bis zum 30. April gesperrt war. Bis zu diesem Tage sollte die Möglichkeit geboten werden, offizielle oder zumindest offiziöse Kommentare zu verfassen. Undichte Stellen in diesem weitgespannten Netz führten dazu, daß die Nachricht von der Presse schon früher aufgegriffen wurde und vor jedem kirchenamtlichen Kommentar eine Welle emotionsgeladener Stellungnahmen die nachfolgende Verlautbarung überflutete.
Der bekannte Theologe Küng, Lehrstuhlinhaber in Tübingen und Experte für Ökumenismusfragen, bezeichnete das päpstliche Dokument als skandalös. Es sei eine Regelung, hinter der römische Monsignori und einige deutsche Kirchenrechtler stünden.
Wer die Vorbereitung in etwa mitverfolgen durfte, weiß allerdings, daß der Versuch, das neue Gesetz als Produkt einiger weniger und dazu beschränkter Köpfe zu diskreditieren, an den objektiven Tatsachen vorbeigeht. Es wäre nur dann verständlich, wenn man grundsätzlich alles, was aus Rom kommt, unbesehen als unzureichend ansehen wollte.
Das Gesetz des Jahres 1966 war bewußt ein vorläufiger Versuch, dem die Erprobung nachfolgen sollte. Erst aufgrund von Erfahrungen sollte eine weitere Fixierung erfolgen. Inzwischen zeigte die römische Dispenspraxis, daß man durchaus gewillt war, großzügig vorzugehen. Das Ausmaß der Dispenserteilungen ließ sogar die Frage auftauchen, ob es noch sinnvoll sei, an einem Hindernis festzuhalten, das in der Regel mit einer Nachsicht vom Gesetz gepaart war.
Der Kritik, daß Rom einem ungebührlichen Zentralismus huldige, wenn es den Fall an sich zog, sooft eine Befreiung von der Form erbeten wurde oder der Nichtkatholik sich weigerte, die Kautelen zu leisten, könnte nur bei oberflächlicher Betrachtung als zutreffend erscheinen. Tatsächlich zeigte sich eine Großzügigkeit der Dispenserteilung, die nicht bei jedem Ordinarius zu erwarten gewesen wäre. Nicht wenige Bischöfe mögen der Auffassung gewesen sein, daß man es ihnen überlassen könne, diese Freizügigkeit des Gebarens an den Tag zu legen; so mancher war aber noch mehr besorgt, weil Rom gewährte, was der Bischof doch lieber verweigert hätte. Aus dem Garanten der Bindung wurde nicht selten der Garant der Freiheit. Das möge nicht übersehen werden, wenn die Rolle der römischen Kurie richtig eingeschätzt werden soll.
Etwas ähnliches gilt für die Neufassung der Bestimmungen, wenn man sie an der Instruktion von 1966 mißt. Die heutige Form der Sicherstellungen stand schon vor etwa drei Jahren zur Debatte, war heftig umstritten und wurde von einem beachtlichen Teil deutschsprachiger Fachleute als zu weitgehend bezeichnet. Fast neigt man zur Vermutung, daß eine Erörterung auf nationaler Ebene der heutigen Regelung nicht hätte zum Durchbruch verhelfen können. Zumindest konnte man die Befürchtung hegen, daß in den Zusammenhängen, wie sie durch die Kirche eines Landes gegeben sind, der Mut zu dieser Lösung gefehlt hätte, weil die Experten das Bild einer eklatanten Uneinigkeit zeigten. Wer heute die deutschen Kanonisten als die Schuldtragenden apostrophiert, müßte der Vollständigkeit halber hinzufügen, daß es nicht jene Kirchenrechtler waren, die dem „konservativen“ Flügel angehören, sondern jene, die sich eher progressiv gaben. Ihre Vorschläge über die Regelung der religiösen Kindererziehung sind in das päpstliche Dokument eingegangen.
Der Ruf nach Selbsthilfe durch Mißachtung des neuen Gesetzes, wie er von Küng vor die Öffentlichkeit getragen wurde, versucht mit einem theologiegeschichtlichen Problem zu argumentieren. Es ist der Hinweis auf die Form der Eheschließung, an die Küng die Frage knüpft, ob der Kirche das Recht zustünde, die Gültigkeit einer bereits dem Naturrecht angehörenden Institution in dieser Weise zu regeln. In der heutigen Debatte würde man es vielleicht als Plumpheit deuten, wollte man sich auf das Tridentinum berufen, um selbstsicher zu behaupten, dies alles sei bereits entschieden, der Kirche stünde das Recht zu, die Form verbindlich festzulegen, weil die Ehe ein Sakrament sei. Selbst wenn wir auf diese Art der Beantwortung verzichten, wird der Rückfall in eine imaginäre „naturrechtliche Ordnung“ kaum weiterhelfen. Dann wird sich eben die Öffentlichkeit mit der Ehe in jener Weise befassen, wie es der Staat tut, der in seiner Gesetzgebung von Hindernis, Ehewillen und Form der Ehewillenserklärung spricht
Formzwang auf der einen Seite und Naturrecht mit natürlicher Freiheit auf den Eheabschluß auf der anderen, ergeben zwar rhetorisch eine wirksame Gegenüberstellung, sind aber eine nicht schlüssige Begriffs-vermengung. Ob ein Verzicht auf die herkömmliche Formvorschrift ratsam sei, wurde während der Mischehendebatte zumindest seit Beginn des II. Vatikanums oft erörtert. Dabei verzichtete man auf eine Bemühung der theologischen Grundsatzfrage, sondern begnügte sich mit rechtspolitischen Erwägungen. Die für Deutschland geltende Regelung durch die „Provida“ (1906), die es einem getauften Nichtkatholiken ermöglichte, seinen katholischen Partner in die „Formfreiheit hineinzuziehen“, um zumindest die Gültigkeit des Eheabschlusses sicherzustellen, ergab den Modellfall. In diesem Sinn versuchte Kardinal Frings die Konzilsväter für eine Wiedereinführung der Formfreiheit zu gewinnen. Damit hätte man für die Mischehe, und um diese allein ging es, wenigstens das eine erreicht, daß eine Ehe niemals aufgrund eines Formmangels ungültig gewesen wäre.
Der Kardinal erfuhr allerdings im eigenen Lande Kritik und schien in der Folgezeit seinen Vorschlag nicht mehr aufrechtzuerhalten. Vielleicht war es zu früh, das Problem der kichlichen Eheschließungsform im Zusammenhang mit der Mischehe isoliert zu betrachten, da die Debatte sich zur generellen Frage ausgeweitet hatte, ob es noch zweckmäßig sei, neben die staatlich geforderte Form ein eigenes kirchliches Vorgehen zu setzen. So schwand der spezifische Charakter eines Mischehenproblems.
Inzwischen hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß in der Formfrage gar nicht das Wesen des Mischehenproblems zu sehen sei. Die anfängliche Skepsis, Rom werde keine Formbefreiung im Zuge eines Dispensansuchens gewähren, wandelte sich sehr bald, zumal solche Ansuchen rasch und ohne weitere Nachfrage positiv erledigt wurden. Da die bischöfliche Behörde diese Nachsicht von der geltenden Form nunmehr selbst erteilen kann, Ist ein dramatischer Aufruf zur Selbsthilfe durch Zuwiderhandeln gegen das Gesetz eine objektiv nicht begründete Maßnahme.
Die Befreiung von der Formvorschrift ermöglicht es auch, dem ökumenischen Zusammenwirken jene Gestalt zu verleihen, die noch durch das Gesetz selbst nicht gewährleistet erschien. Nach der Instruktion des Jahres 1966 durfte der nichtkatholische Geistliche zwar eingeladen werden, sich an der Trauung durch Ansprache und Gebet zu beteiligen, von der Erfragung und der Entgegennahme des Konsenses blieb er ausgeschlossen. Die Verletzung eines Paritätsprinzips schien vorzuliegen, und psychologisch mag dies zutreffen. Dennoch sei grundsätzlich etwas festgehalten, was nur zu gern übersehen wird. Nach evangelischem Verständnis, ist zwischen Eheschließung und Trauung zu unterscheiden. Der ehebegründende Akt erfolgt vor dem Standesbeamten, die Trauung im Gotteshaus konstituiert nicht nochmals die bereits geschlossene Ehe; sie besteht in einem Bekenntnis vor der christlichen Gemeinde, diese Ehe nach dem Gebot Christi führen zu wollen und sie damit unter das Evangelium zu stellen. Gebet und Segnung vervollständigen diesen Vorgang.
Wenn nun der katholische Pfarrer durch Konsensbefragung und -entgegennähme einen ehebegründen Akt einleitet, so brüskiert er, sachlich gesehen, nicht seinen evangelischen Amtsbruder, der diesen Vorgang dem Standesbeamten überlassen hat. Es könnte höchstens davon die Rede sein, daß der Standesbeamte sich nicht beachtet fühlt, weil sein Tun von der katholischen Kirche ignoriert wird.
Diese sachliche Richtigstellung soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese Art der Mitwirkung, die eben gerade noch dem nichtkatholischen Geistlichen eingeräumt wird, als verletzend empfunden werden kann und in ökumenischer Sicht nicht frei von Belastungen ist.
Wenn erst durch Dispens und nicht schon durch das Gesetz die Tür weiter geöffnet werden kann, damit beide Geistliche paritätisch zusammenwirken dürfen, so darf der gesamtkirchliche Zusammenhang nicht übersehen werden. Die Begegnung mit der evangelischen Kirche im deutschen Sprachraum steht doch unter ganz anderen Aspekten geschichtlicher, soziologischer, religiöser und pastoraler Art als es die Verhältnisse anderer Länder mit gänzlich anderen Voraussetzungen zeitigen.
Weit schwerwiegender ist die Frage der katholischen Taufe und Erziehung. Sicherlich wirkte es sympa-tisch, wenn man hier sagen könnte: Wir überlassen es den Eheleuten, darüber zu befinden; ihr Gewissen und nicht eine von außen her auferlegte Norm soll entscheiden. Fehlt eine derartige Norm, so regiert die Freiheit. Es bleibt allerdings die entscheidende Frage: Gewährt das Gewissen diese Freiheit? Der Verzicht auf die Norm darf nicht als eine Forderung angesehen werden, die nur die katholische Kirche angeht. In der kirchlichen Lebensordnung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern las man noch 1966: „Die Trauung mit Christen eines anderen Bekenntnisses kann aber gewährt werden, wenn Sich die Eheleute geeinigt haben, ihre Kinder in der evangelisch-lutherischen Kirche taufen zu lassen und im evangelisch-lutherischen Bekenntnis zu erziehen.“ Es muß freilich zugegeben werden, daß solche Regelungen nicht für alle Landeskirchen gelten und die im evangelischen Raum feststellbare Entwicklung von solchen Formulierungen eher wegzuführen scheint.
Dennoch kehren wir zu unserer Frage zurück, wenn das Gewissen allein entscheiden soll. Die Lösung zu einem späteren Zeitpunkt, also erst in der Ehe, wenn das Kind bereits getauft werden soll, ist nur eine Verlagerung des Problems. Hier ausweichend ist die Formel, sich mit einer „christlichen“ Erziehung begnügen zu wollen. Sie enthält als positiven Satz das Bekenntnis zu den gemeinsamen Grundlagen des Christentums, enthebt die Ehepartner jedoch nicht der Entscheidung, die früher oder später einmal kommen wird, welcher christlichen Kirche oder Gemeinschaft das Kind angehören soll. Dazu drängen soziologische Gegebenheiten und vielleicht auch staatliche Gesetze. Die Kautelen in der Form der neuen gesetzlichen Regelung sind letztlich nichts anderes als eine Bedacht-nahme auf die immanente Verpflichtung des katholischen Christen, seinen Glauben nicht nur zu bewahren, sondern auch nach Kräften bestrebt zu sein, ihn weiterzugeben. Der Kernpunkt einer echten Schwierigkeit liegt allerdings in dem Bemühen, dies „nach Kräften“ tun zu wollen.
Es wäre sicher ein dankenswerter Beitrag zu einem offenen Gespräch, wenn der nichtkatholische Christ zugeben wollte, aus der Überzeugung seines Glaubens heraus die gleiche Gewissenspflicht zu empfinden oder sie zumindest auch empfinden zu können. Dann könnte man einmütig feststellen, daß es sich um ein echtes Gewissensproblem handelt, das weder durch Gewalt noch durch Diplomatie gelöst werden kann, das aber bei Bestehen einer beiderseitigen ehrlichen Uberzeugung immer einen schmerzlichen nicht überwindbaren Rest hinterlassen wird. In dem Bemühen „nach Kräften“ darf sich weder eine die Ehe zerstörende Kraft bemerkbar machen, noch soll die Wendung formelhaft mitgeschleppt werden, um kirchlichen Behörden zur Beruhigung zu dienen, sie hätten einer Situation, die bereits vorgezeichnet war, auf dieses Wörtlein hin ihren Segen erteilen dürfen.
Im Wege der Interpretation und Anwendung sowie des interkonfessionellen Gespräches könnte der Versuch gemacht werden, dieses Kernproblem klarer herauszustellen. Mit dem Hinweis auf das Treuebekenntnis zum eigenen Glauben Ist noch nicht jene Spannung gemeistert, die durch ein anderes, ebenso überzeugtes Gewissen in die Ehe getragen wird. Noch weniger ist in der neuen Gesetzgebung die Rolle des Elternrechtes aufgezeigt, das auch hier zum Tragen kommen müßte.