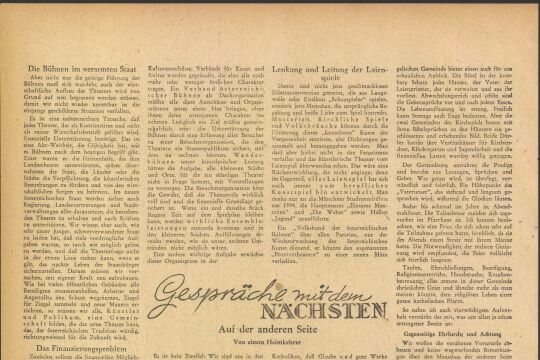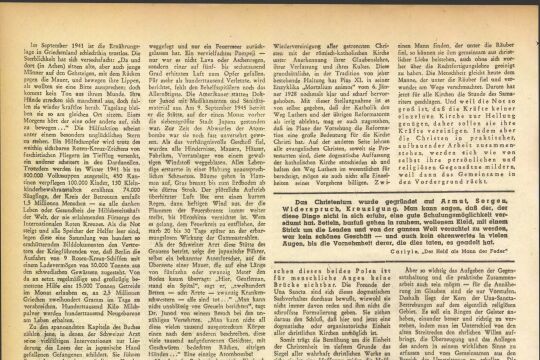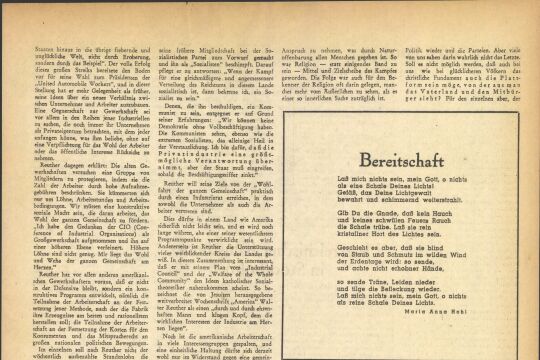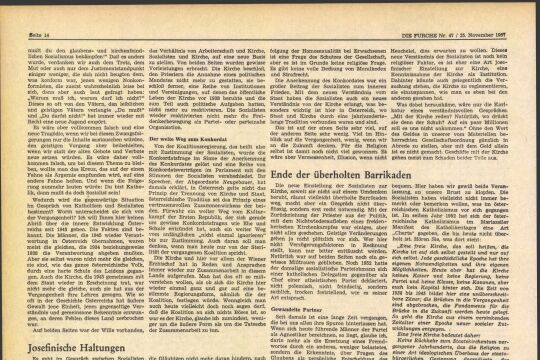Ökumene im Zwielicht
Ökumenismus in Gesinnung und Tat ist heute zum Wertmaßstab geworden; von einem bloßen Gütezeichen zu sprechen, wäre zu wenig. In dieser doppeldeutigen Feststellung liegt nicht die Abwertung jenes Bestrebens, das in seiner Grundlegung, Zielsetzung und Methodik durch ein Konzilsdokument, das Dekret über den Ökumenismus, verankert worden ist. Ebensowenig richtet sich das Mitschwingen eines unausgesprochenen “Verdachtes gegen jene, die aus ehrlicher Uberzeugung, unabhängig von einer Modeströmung, sich dem Gedanken der Einheit unter den Christen verschrieben haben.Diese kritische Vorbemerkung könnte sich allerdings als zweischneidiges Schwert erweisen und den Verdacht gegen jenen wenden, der ihn ausspricht. Mit Warnungen vor verfehlten Mitteln und unglücklichen personalen Zusammenhängen hat schon manche Kritik begonnen, um dann trotz wenig überzeugender, grundsätzlicher Bekenntnisse zur Sache diese selbst in Frage zu stellen.
Ökumenismus in Gesinnung und Tat ist heute zum Wertmaßstab geworden; von einem bloßen Gütezeichen zu sprechen, wäre zu wenig. In dieser doppeldeutigen Feststellung liegt nicht die Abwertung jenes Bestrebens, das in seiner Grundlegung, Zielsetzung und Methodik durch ein Konzilsdokument, das Dekret über den Ökumenismus, verankert worden ist. Ebensowenig richtet sich das Mitschwingen eines unausgesprochenen “Verdachtes gegen jene, die aus ehrlicher Uberzeugung, unabhängig von einer Modeströmung, sich dem Gedanken der Einheit unter den Christen verschrieben haben.Diese kritische Vorbemerkung könnte sich allerdings als zweischneidiges Schwert erweisen und den Verdacht gegen jenen wenden, der ihn ausspricht. Mit Warnungen vor verfehlten Mitteln und unglücklichen personalen Zusammenhängen hat schon manche Kritik begonnen, um dann trotz wenig überzeugender, grundsätzlicher Bekenntnisse zur Sache diese selbst in Frage zu stellen.
Dennoch wird dem Anliegen am ehesten gedient, wenn es von jenen trüben Beimischungen befreit wird, die nicht immer Zeichen einer bösgläubigen Zielsetzung und Taktik sein müssen, sondern die Unsicherheit des ersten, tastenden Bemühens zeigten.
Gewiß könnte gerade in Österreich auf eine reiche Erfahrung hingewiesen werden, die sich Vertreter christlicher und nichtchristlicher Bekenntnisse aneignen konnten. Zeigte doch der Vielvölkerstaat ein konfessionell ebenso vielgestaltiges Bild, das durch den Rahmen einer staatlichen Gesetzgebung zusammengehalten wurde. Anerkennung von Religionsgesellschaften, Absicherungen gegen etwaige Störungen interkonfessioneller Beziehungen und ein paritätisch gezeigtes Wohlwollen schufen ein Klima der Urbanität, die- man sich gegenseitig zu erweisen gewillt war. Dennoch müßte hier gefragt werden, wieweit der Gedanke der religio dominans, auch als sie sich rechtlich längst nicht mehr auf diese Sonderstellung berufen konnte, doch nachgewirkt hat.
Wie dünn die Tünche äußerlich korrekter Verhaltensweisen war, zeigte sich nach dem Auseinanderfallen der national und konfessionell gemischten Monarchie. In den Grenzen des heutigen Österreich war es zunächst das Nebeinander der katholischen und evangelischen Kirche. Die Anwesenheit orthodoxer Gruppen wurde vorwiegend als ein Anliegen ausländischer Kolonien gesehen, deren Existenz weder als konfessionelle Förderung noch als Behinderung gewertet wurde; die altkatholische Kirche erschien in diesem Rahmen eher als ein ärgerliches Zwischenspiel.
Gerade in den enger gewordenen Verhältnissen zeigten sich historisch gewordene und immer noch weiterbestehende Belastungen. Der Gedanke an die Gegenreformation ließ bei den evangelischen Christen nicht das Bewußtsein schwinden, eine „Kirche der Märtyrer“ zu sein. Jede Aufweichung der Fronten, jede Unklarheit über die Tragweite eines von der katholischen Kirche angebotenen Ökumenismus rief den Gedanken an Vergangenes und Zukünftiges wach. Vielleicht klingt es etwas zu kraß, wenn die Frage pointiert gestellt wird und dann jene Vorfahren auf den Plan ruft, die bereit waren, für ihren Glauben in den Tod zu gehen. Nicht minder mag die Sorge erscheinen, wenn die Zukunft der evangelischen Kirche durch eine konfessionelle Weitmaschigkeit in die Gefahr eines Überrolltwerdens hineingerät.
Die tatsächliche Begegnung bis zum Ende des zweiten Weltkriegs war nicht dazu angetan, zu einer gegenseitigen Öffnung beizutragen. Die politischen Ereignisse des Jahres 1934 schienen erneut einen gegen-reformatorischen Triumph nachklingen zu lassen. Loyalitätserklärun-gen, die evangelische Kirchenmänner in der Systemzeit abgaben, dürften wohl nicht aus der Tiefe des Herzens gekommen sein, denn nach Ende des Krieges zählte sich auch die evangelische Kirche zu den Leidtragenden der Jahre 1934 bis 1938 Ob es psychologisch richtig war, hiei mit zuviel Nachdruck Klage zu führen, mag dahingestellt sein. Nur zu deutlich mußten es die Katholiker nach dem „Anschluß“ erleben, daC Los-von-Rom-Bewegung und
deutschnationale Tendenz, die bereits als Relikt des vergangenen Jahrhunderts erschienen, neuerlich das katholisch-evangelische Verhältnis trübten. Es wuchs die Zahl jener evangelischen Christen, deren Konfessionswechsel eines politischer Beigeschmacks nicht entbehrte. Damit wurde an die unglückliche Tradition, wegen einer gescheiterter Ehe und der nachfolgenden neuerlichen Eheschließung das Bekenntnis zu wechseln, angeknüpft. Die Gegensätzlichkeit wirkte auch über das Jahr 1945 hinaus. Wenr die katholische Kirche mit der Konkordatsfrage vor die öffentlichkeil trat (es geschah nicht immer in sehi geschickter Weise), wurden evan-gelischerseits nicht selten Bedenken vorgebracht.
Auch gelegentliche Wahlaufrufe des katholischen Episkopates, nur solchen Kandidaten die Stimme zu geben, mit deren Eintreten für das Christentum gerechnet werden dürfe, riefen evangelische Stimmer auf den Plan, die einer „Äquidistanz1' das Wort zu reden schienen, als dieser nicht glückliche Terminus noch nifcht in dais Vokabular katholischer Bischöfe eingedrungen war.
Innerkirchlich war die Lage nichl dazu angetan, die festgefahrener Fronten aufzulockern. Dem evangeli-scherseits gezeigten Bestreben, hu Sinne des einstigen Bekennertums zu verharren und die Reihen durch Konvertiten“ aufzufüllen, entsprach die Haltung der katholischen Kirche. Während der Weltgebetswoche für die Wiedervereinigung der Christen standen Gebetstexte zur Verfügung, die einer oberhirtlichen Empfehlung nicht entbehrten. Sie enthielten den Segen für alle Bestrebungen, die nichtkatholischen Christen mit der katholischen Kirche zu vereinigen. Dieser Hinweis ist deshalb nicht überflüssig, weil durch ihn die Ausgangsstellung ökumenischer Begegnungen gekennzeichnet ist. Heute möchte man es schamhaft verbergen, was einst über die „Bekehrung der Irrgläubigen“ gesagt worden ist. Wollte man jedoch einer offenen Aussprache ausweichen, bliebe das Mißtrauen, das auch mit der bereits bis zum Überdruß strapazierten Formel nicht überwunden werden kann: Vor dem Konzil war es so, jetzt ist es anders.
Der Frage könnte auch ausgewichen Werden, wenn die Pflege menschlicher Beziehungen als Nahziel vor Augen gestellt wird. Hier scheint sich tatsächlich eine Routine anzubahnen, die zum „Sandwich-Ökumenismus“ hinsteuert. Der Vorwurf wäre berechtigt, wollte man bewußt auf jeden weiteren Schritt verzichten. Der Wert einer menschlich aufgeschlossenen Atmosphäre darf jedoch weder verkannt noch ins Lächerliche gezogen werden. Zutreffend, aber nicht ausreichend sind der Hinweis auf gemeinsames Tun im Kampf gegen Hunger, Elend, Unwissenheit sowie alle Bemühungen um Frieden und Völkerverständigung. Wenn gar das Bekenntnis zum Gottesglauben und zu den gemeinsamen Grundlagen des Christentums hinzutritt, scheint die Welt schon halb gewonnen. So wahr und erstrebenswert das alles ist, so kann doch in diesen Nahzielen eine unverkennbare Resignation mitschwingen, etwa in der Feststellung: Weil wir zur Einheit nicht gelangen können und es deshalb letztlich auch gar nicht wollen, bleibt es bei allgemeinen menschlich-religiösen Werten und Begegnungen.
Hier liegt die Gefahr, die etwa auf die Formel zurückgeführt werden könnte: Zwei Jahrtausende Christentum lassen sich im geschichtlichen Ablauf nicht rückgängig machen. Es sind Grenzen entstanden, durch die Altar gegen Altar steht. Die gegenseitige Respektierung dieser Gegebenheit ist das erste, die freundliche Geste über das Trennende hinweg das zweite. Theologisch kann dieses Spiel mit der distanzierten Freundlichkeit keineswegs befriedigen. Fast sieht es so aus, als wolle man mit Verjährungsterminen arbeiten und die Spaltung nach dem entsprechenden Fristenablauf mit einer durch nichts zu rechtfertigenden Legalität umkleiden. Auch die Flucht in den christlichen Pluralismus, der hier die Abwandlung in den vagen Terminus der Pluriformität erfährt, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine Vielfalt theologischer Ausdrucksweisen, der Tradition, des Frömmigkeitslebens, der Kirchendisziplin und liturgischer Formen nie den wesentlichen Gehalt christlicher Offenbarung in eine widersprüchliche Verschiedenartigkeit aufzuspalten vermag.
Das Suchen nach Wahrheit kann nicht von der Zumutung ausgehen, auf den Wahrheitsanspruch zu verzichten, ganz gleich ob dieser Anspruch im Sinne der Ausschließlichkeit oder nur des besseren Weges erhoben wird. Das Mittel dazu ist nicht nur die Kenntnis des anderen Standpunktes, der nur zu gern und zu übereilig verurteilt wurde, weil man ihn in die einmal festgelegten Kategorien des eigenen Denkens zwängte. Dazu gehört aber auch das Bekenntnis der eigenen Lehre, wenn man den anderen nicht mit Aussichten und Versprechungen vertrösten will, die einzulösen man nicht imstande ist.
Die in Aussicht gestellte Wandelbarkeit eines Dogmas, das nur als zeitgebundenes und daher stets veränderliches Vehikel einer Wahrheit erscheint, ist nun schon arg genug strapaziert worden. Haben wir den evangelischen Bruder wirklich ernstgenommen, wenn wir ihm eine Entwicklung in Aussicht stellen, die imstande wäre, alle bekenntnismäßigen Unterschiede zu nivellieren? Der Vorschlag nach Zusammenlegung der Fakultäten ist entweder ein plumper Anbiederungsversuch oder ein verkappter Verzicht auf den eigenen Wahrheitsanspruch. Welche Religionsgemeinschaft könnte es sich leisten, nach diesem Verzicht noch weiterzubestehen? Wäre es nicht ein Betrug an den eigenen Gläubigen, sich den Luxus einer „Kirche“ leisten zu wollen, wenn man sie innerlich bereits aufgegeben hat? Der Hinweis darauf, daß die heutige Jugend kein Verständnis für bekenntnismäßige Unterschiede aufbringe, zeigt zwar im Kern das Verlangen nach Einheit, bietet jedoch methodisch keine theologisch brauchbare Handhabe.
Wenn nur das als richtig angesehen wird, was der Mensch jeweils bereit ist anzunehmen, ist ein Christentum im Entstehen, das eine vertikale Bindung nicht mehr ernst nimmt oder sie an menschliche Bedingungen knüpft. Welchen Sinn soll es denn haben, wenn die Ökumene zum Tummelplatz von Außenseitern wird, die in sich die Liebe zum getrennten Bruder entdecken, weil sie nun meinen, von dieser Warte her dem Extrem huldigen zu können. Wie soll ferner der nichtkatholische Gesprächspartner Vertrauen gewinnen, wenn ihm augenzwinkernd versichert wird, daß sowieso alles diskutabel sei und die kirchlichen Autoritätsorgane mit ihrem Anspruch auf ein Lehramt wohl oder übel kapitulieren müßten. Meint man wirklich mit dieser Vielzahl von „Päpsten“ die katholische Kirche glaubwürdiger darstellen zu können? Wie wird sich unter diesen Vorzeichen die Begegnung mit der Orthodoxie gestalten? Ist es wirklich zweckdienlich, im Rahmen von Organisationen, die der Begegnung mit den Kirchen des Ostens dienen könnten, dem erstaunten Gast aus dem Orient vor Augen zu führen, wie weit man sich vom gemeinsamen Erbe entfernt hat? Noch klingt die bittere Klage eines orthodoxen Theologen nach: „Nach jahrhundertlang andauernden Mißverständnissen beginnen wir den Weg zueinander zu suchen, und gerade in diesem Augenblick seid ihr im Begriff, das gemeinsame Erbe aufzugeben und dort eine Annäherung zu suchen, wohin wir euch nicht folgen können.“
Wer dieses Bedauern über einen zwielichtigen Ökumenismus teilt oder es maliziös interpretieren möchte, könnte nun nach dem Sinn ökumenischer Bestrebungen fragen, Johannes XXIII. sprach von einer Begegnung, ohne daß dabei die Absicht bestehe, einen historischen Prozeß zu machen. Die Zerrissenheit einer Gemeinschaft, die sich durch ihre gegenseitige Liebe der Welt glaubhaft darstellen müßte, ist ein Übel, das alle trifft. Es konnte nicht ohne menschliche Schuld entstehen, und dieses Verschulden einseitig zu suchen, wäre verfehlt.
Der Auftrag, die Einheit zu suchen, entspringt nicht einem menschlichen Wunsch, sondern ist göttlicher Auftrag, das Vermächtnis Christi. Eine Einheit, die in Gott gesucht und durch Ihn bewirkt wird, ist ein Streben und ein Geschehen, gegen das es kein Widerstreben geben darf. Wenn wir heute nicht das Modell des einen Hauses in allen Einzelheiten auszudenken vermögen, so liegt darin kein Grund, vorläufig nichts zu tun und nur zu warten. Wer trägt dann die Verantwortung für jenen Verlust, dessen Ausmaß nicht mehr abzusehen wäre, weil das Nichtstun sich im Grenzenlosen verlöre? Eine von Gott gewirkte Einheit, an der wir mitwirken dürfen, kennt weder Sieger noch Verlierer, da sie nicht Triumph, sondern Gnade ist.