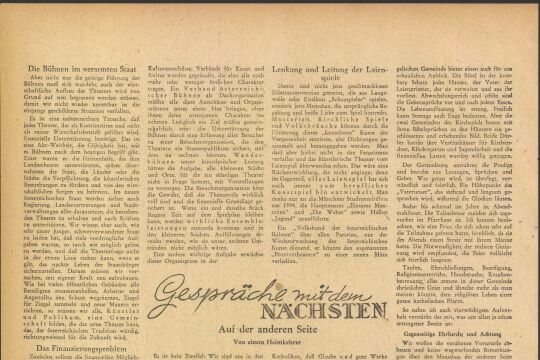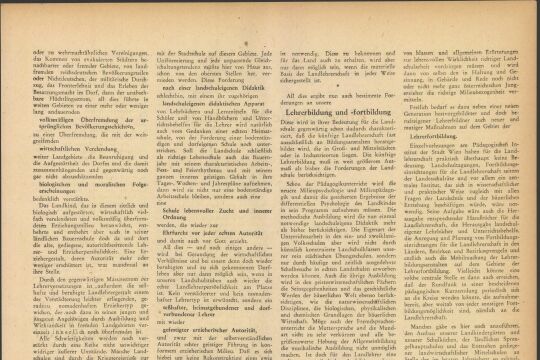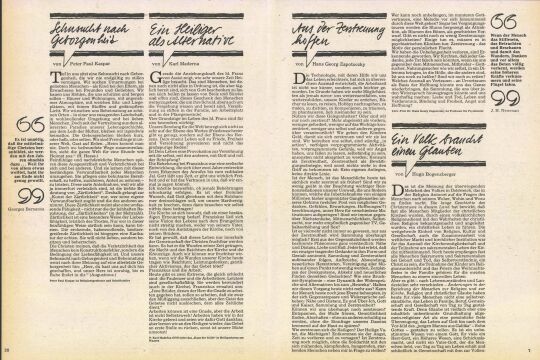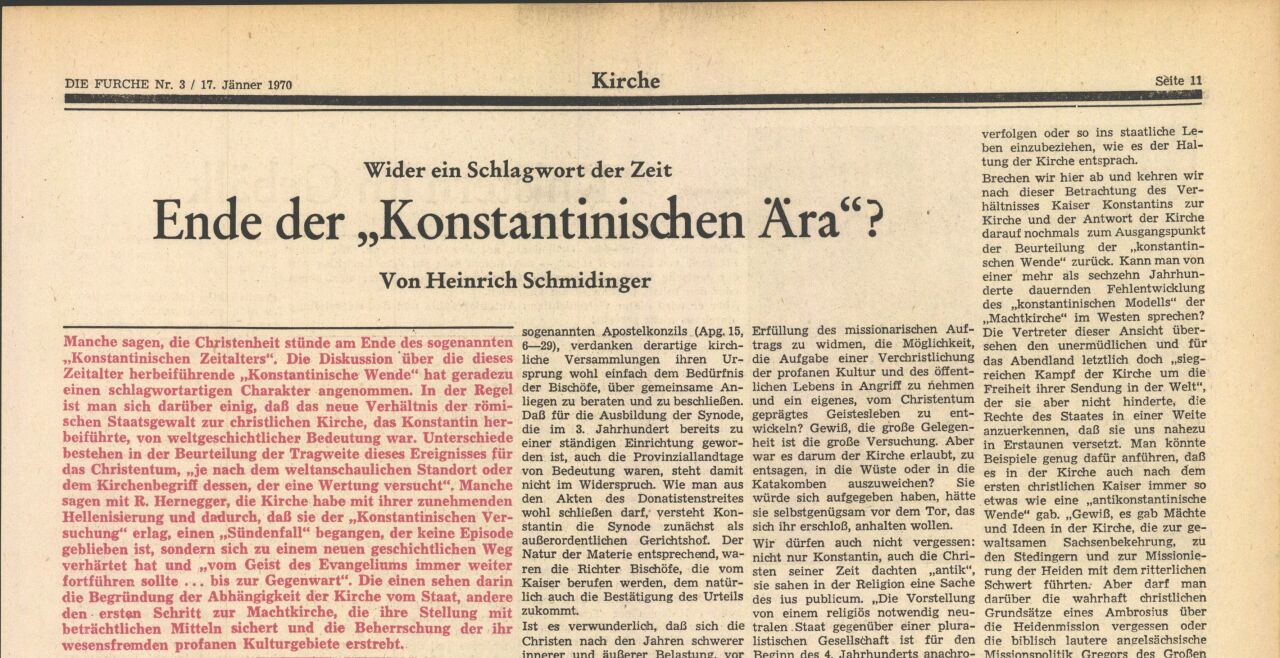
Ende der „Konstantinischen Ära“?
Manche sagen, die Christenheit stünde am Ende des sogenannten „Konstantinischen Zeitalters“. Die Diskussion über die dieses Zeitalter herbeiführende „Konstantinische Wende“ hat geradezu einen schlagwortartigen Charakter angenommen. In der Regel ist man sich darüber einig, daß das neue Verhältnis der römischen Staatsgewalt zur christlichen Kirche, das Konstantin herbeiführte, von weltgeschichtlicher Bedeutung war. Unterschiede bestehen in der Beurteilung der Tragweite dieses Ereignisses für das Christentum, „je nach dem weltanschaulichen Standort oder dem Kirchenbegriff dessen, der eine Wertung versucht“. Manche sagen mit B. Hernegger, die Kirche habe mit ihrer zunehmenden Hellenisierung und dadurch, daß sie der „Konstantinischen Versuchung“ erlag, einen „Sündenf all“ begangen, der keine Episode geblieben ist, sondern sich zu einem neuen geschichtlichen Weg verhärtet hat und „vom Geist des Evangeliums immer weiter fortführen sollte ... bis zur Gegenwart“. Die einen sehen darin die Begründung der Abhängigkeit der Kirche vom Staat, andere den ersten Schritt zur Machtkirche, die ihre Stellung mit beträchtlichen Mitteln sichert und die Beherrschung der ihr wesensfremden profanen Kulturgebiete erstrebt.
Manche sagen, die Christenheit stünde am Ende des sogenannten „Konstantinischen Zeitalters“. Die Diskussion über die dieses Zeitalter herbeiführende „Konstantinische Wende“ hat geradezu einen schlagwortartigen Charakter angenommen. In der Regel ist man sich darüber einig, daß das neue Verhältnis der römischen Staatsgewalt zur christlichen Kirche, das Konstantin herbeiführte, von weltgeschichtlicher Bedeutung war. Unterschiede bestehen in der Beurteilung der Tragweite dieses Ereignisses für das Christentum, „je nach dem weltanschaulichen Standort oder dem Kirchenbegriff dessen, der eine Wertung versucht“. Manche sagen mit B. Hernegger, die Kirche habe mit ihrer zunehmenden Hellenisierung und dadurch, daß sie der „Konstantinischen Versuchung“ erlag, einen „Sündenf all“ begangen, der keine Episode geblieben ist, sondern sich zu einem neuen geschichtlichen Weg verhärtet hat und „vom Geist des Evangeliums immer weiter fortführen sollte ... bis zur Gegenwart“. Die einen sehen darin die Begründung der Abhängigkeit der Kirche vom Staat, andere den ersten Schritt zur Machtkirche, die ihre Stellung mit beträchtlichen Mitteln sichert und die Beherrschung der ihr wesensfremden profanen Kulturgebiete erstrebt.
Für alle, ob sie diese Deutung verteidigen oder bekämpfen, ist der Ausgangspunkt Kaiser Konstantin. Wie verschieden er auch in seinem Verhältnis zum christlichen Glauben beurteilt werden mag, daran, daß Konstantin römisch dachte, auch der Religion und dem Christentum gegenüber, ist nicht zu rütteln. Als religio licita gehörte das Christentum zum ius publicum und damit zur Kompetenz des Kaisers. Wir Westeuropäer denken, bewußt oder unbewußt von christlichen Traditionen getragen, beim Wort Religion zunächst an einen Glauben, an etwas Innerliches, an ein persönliches Verhältnis des Menschen zu Gott Mit diesem Begriff läßt sich bei der römischen Religion wenig anfangen. Die Religion der Römer hat fast keine persönlichen und individuellen Elemente. Sie ist nicht Sache des einzelnen, sondern der Gemeinschaft, ist eine Staatsfunktion. Deshalb ist Religion eine Pflicht ersten Ranges für jeden Bürger, ohne Rücksicht auf dessen persönliche Uberzeugung. Die Erfüllung dieser kultischen Staatspflichten hat eine doppelte Bedeutung: sie soll die Gunst der Götter erwerben und durch den gemeinsamen Kult das Reich zu einer Einheit zusammenfassen, die den Staat stark macht gegen jeden Angriff und gegen jede Unterhöhlung.
Das ist auch weiterhin die durch Aussagen des Kaisers selbst belegte Auffassung Konstantins, nachdem er einmal davon überzeugt ist, daß nicht die alten Staatsgötter, sondern der Gott der Christen der wahre Gott ist, der über Lohn und Strafe verfügt. Was für Konstantin die Religion und speziell das Christentum wichtig macht, sind nicht die dogmatischen Lehrsätze, sondern eine Kult- und Gebetsgemeinschaft, deren einheitliches Beten und Opfern die Reichseinheit garantiert und den Schutz des höchsten Wesens — do ut des — sozusagen erzwingt.
Gefahren der Uneinigkeit
Die Uneinigkeit einer so verstandenen christlichen Religion gefährdet die Einheit des Kultes und damit indirekt die Einheit des Reiches. Sobald Konstantin feststellen muß, daß eine solche Uneinigkeit durch dogmatische Differenzen entstehen kann — was dem römischen religiösen Denken an sich eher fernlag —, interessiert er sich auch für solche Unterschiede der Lehre. Dazu wird er sehr bald, fast schon beim ersten Bekanntwerden mit dem Christentum, veranlaßt. Es geht ihm dabei dann — grob gesagt — nicht so sehr darum, die Richtigkeit einer dogmatischen Lehrmeinung herausstellen zu lassen, sondern um den Versuch, möglichst rasch die Mehrheit auf eine dieser Sondermeinungen festzulegen, die dann eben zur lex, zum nomos, wird, während die Andersdenkenden Ipso facto zu Reichsfeinden gestempelt werden. Konstantin vermeidet zunächst eine Einmischung in innere kirchliche Angelegenheiten, greift aber dann aus dem angeführten
Grund zuerst in die donatistischen und darauf in die arianischen Streitigkeiten ein. Ist die Kirche selbst nicht imstande, die Einheit in der pflichtgemäßen Gottesverehrung herzustellen, so muß der Kaiser als Gottes Werkzeug eingreifen. Mit der Einheit in der Kirche und im Kult steht und fällt ja sein ganzes Lebenswerk, zu dem nach seiner Überzeugung Gott ihn erwählt hat.
Als Mittel für eine solche Vereinheitlichung der Lehrmeinungen und damit der wahren Gottesverehrung boten sich die Sjmoden an. Abgesehen von dem möglichen Beispiel des
sogenannten Apostelkonzils (Apg. 15, 6—29), verdanken derartige kirchliche Versammlungen ihren Ursprung wohl einfach dem Bedürfnis der Bischöfe, über gemeinsame Anliegen zu beraten und zu beschließen. Daß für die Ausbildung der Synode, die im 3. Jahrhundert bereits zu einer ständigen Einrichtung geworden ist, auch die Provinziallandtage von Bedeutung waren, steht damit nicht im Widerspruch. Wie man aus den Akten des Donatistenstreites wohl schließen darf, versteht Konstantin die Synode zunächst als außerordentlichen Gerichtshof. Der Natur der Materie entsprechend, waren die Richter Bischöfe, die vom Kaiser berufen werden, dem natürlich auch die Bestätigung des Urteils zukommt. '
Ist es verwunderlich, daß sich die Christen nach den Jahren schwerer innerer und äußerer Belastung, vor allem in den östlichen Reichsgebieten, in einem geradezu „bedenkenlosen Enthusiasmus“ dem „Kaiser ihres Glaubens“ zuwandten? Kann man von den damaligen Bischöfen erwarten, daß sie bei der theoretischen Wertung des christlichen Kaisers die Gefährdung sahen, die mit dem neuen Verhältnis zwischen Staat und Kirche, das sich nun anbahnte, gegeben war? Standen nicht dem Verlust des Ausleseprinzips der Verfolgungszeit und der Gefährdung der Kirche durch staatliche Bevormundung gewaltige positive Möglichkeiten gegenüber, wie.die Freiheit, sich ungehemmt dem Ausbau des innerkirchlichen Lebens und der
Erfüllung des missionarischen Auftrags zu widmen, die Möglichkeit, die Aufgabe einer Verchristlichung der profanen Kultur und des öffentlichen Lebens in Angriff zu nehmen und ein eigenes, vom Christentum geprägtes Geistesleben zu entwickeln? Gewiß, die große Gelegenheit ist die große Versuchung. Aber war es darum der Kirche erlaubt, zu entsagen, in die Wüste oder in die Katakomben auszuweichen? Sie würde sich aufgegeben haben, hätte sie selbstgenügsam vor dem Tor, das sich ihr erschloß, anhalten wollen. Wir dürfen auch nicht vergessen: nicht nur Konstantin, auch die Christen seiner Zeit dachten „antik“, sie sahen in der Religion eine Sache des ius publicum. „Die Vorstellung von einem religiös notwendig neutralen Staat gegenüber einer pluralistischen Gesellschaft ist für den Beginn des 4. Jahrhunderts anachronistisch.“ Es ist eine übertreibende Verzeichnung des wahren Bildes, wenn man der nachkonstantinischen „Machtkirche“ die reine, noch biblisch denkende, Märtyrer zeugende Kirche gegenüberstellt. Abgesehen davon, daß man in neuester Zeit viel zurückhaltender geworden ist mit der Rede von den „jahrhundertelangen Verfolgungen“, kommt es zur staatsgesetzlichen Verfolgung von Decius an bis zum Toleranzedikt des Galerius gerade deshalb, weil die Kirche im 3. Jahrhundert solche Macht und solchen Einfluß gewonnen hatte, daß für das Imperium nur noch zur Entscheidung stand, sie auf Leben und Tod zu
verfolgen oder so ins staatliche Leben einzubeziehen, wie es der Haltung der Kirche entsprach. Brechen wir hier ab und kehren wir nach dieser Betrachtung des Verhältnisses Kaiser Konstantins zur Kirche und der Antwort der Kirche darauf nochmals zum Ausgangspunkt der Beurteilung der „konstantin-schen Wende“ zurück. Kann man von einer mehr als sechzehn Jahrhunderte dauernden Fehlentwicklung des „konstantinischen Modells“ der „Machtkirche“ im Westen sprechen? Die Vertreter dieser Ansicht übersehen den unermüdlichen und für das Abendland letztlich doch „siegreichen Kampf der Kirche um die Freiheit ihrer Sendung in der Welt“, der sie aber nicht hinderte, die Rechte des Staates in einer Weite anzuerkennen, daß sie uns nahezu in Erstaunen versetzt. Man könnte Beispiele genug dafür anführen, daß es in der Kirche auch nach dem ersten christlichen Kaiser immer so etwas wie eine „antikonstantinische Wende“ gab. „Gewiß, es gab Mächte und Ideen in der Kirche, die zur gewaltsamen Sachsenbekehrung, zu den Stedingern und zur Missionierung der Heiden mit dem ritterlichen Schwert führten. Aber darf man darüber die wahrhaft christlichen Grundsätze eines Ambrosius über die Heidenmission vergessen oder die biblisch lautere anseisächsische Missionspolitik Gregors des Großen oder den Heroismus der siedelnden Zisterzienser, der Franziskaner in Marokko und China“, der späteren Missionsorden b's auf unsere Zeit? Ob man das „konstantinische Zeitalter“ wegen kirchlichen Anspruchs auf Macht in der Welt oder „wegen einer obersten Weisungsbefugnis in Sachen des Naturrechts“ verurteilt, immer geht es hier um eine einseitige oder zumindest um eine unausgeglichene Erfassung der geschichtlichen Wesensstruktur der Kirche. „Innerweltliche Immanenz und eschatologische Transzendenz werden in ihr immer da sein müssen und werden immer in der Spannung des Ausgleichs stehen.“ „Wenn man einen dieser Aspekte außer acht läßt“, erklärte Kardinal Suhard von Paris im Jahre 1947 in einem Hirtenbrief, „zerstört man die Kirche. Ohne sichtbare Organisation, ohne Einrichtungen, Hierarchie, Sakramente gibt es keine Fleischwerdung Christi auf Erden, die Kirche ist dann kein Leib mehr. Wenn man jedoch umgekehrt bei der juridischen Organisation halt macht und über das äußerlich Sichtbare nicht hinausgeht, so heißt das, den Leib Christi durch einen Leichnam ersetzen.“
Kein Irrweg
Ohne den vielen in der Kirche, die sich allzu beruhigt und unbekümmert auf dieser Welt eingerichtet haben, eine Ausrede zu bieten, können wir mit Hugo Rahner sagen: „Die Kirche muß immer so sein wie sie bis jetzt geworden ist und also gerade heute ist. Aber das .unwandelbare Wesen der Kirche, wie J sich in den Schriften der Apostel und Evangelisten bezeugt' (um noch ein Wort Giloths zu gebrauchen), muß auch erkannt und geliebt werden können in seiner je gegenwärtigen Gestalt. Sonst endet die Theologie der Kirchengeschichte und unsere Liebe zur sichtbaren Kirche ... doch letztlich in einem ungeschichtlichen Esoterismus. Man kann das Licht Christi nicht nur im Zu-rückblenden in die frühchristliche Kirche finden. Das Wort ist Fleisch geworden. Es ist immer gegenwärtig und zukünftig zumal. Auch im Fleisch Seiner Kirche, das noch Makel und Runzeln trägt.“ Aufs Ganze gesehen, waren die mehr als eineinhalbtausend Jahre seit Konstantin kein Irrweg der Kirche. Gerade, wenn sie sich treu blieb, mußte sie den Ruf hören, der sie in die Weite der Welt rief, auf einen anscheinend leichteren, in mancher Hinsicht aber soviel schwereren Weg. Sie hat ihn freudigen Herzens betreten — wie sollte sie anders? — und ist ihn gegangen unter Fallen und Aufstehen, bisweilen allzu sicher, wenn er eben und glatt verlief, bisweilen seine Mühsal und Gefahr beklagend. Sie trug Bürden von Besitz und Ehren, nicht immer der Verantwortung bewußt, die sie sich damit auflud. Gewiß konnte sie vor ihrem eigenen Gewissen nicht immer bestehen, in konstantinischer Zeit so wenig wie vorher und heute. Aber um dessentwillen, der sie leitete, behält auch dieses Stück ihres Weges sein Recht und seinen Sinn.