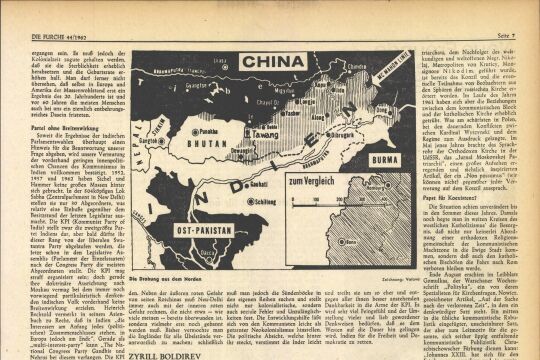Das größte Konzil der Kirchengeschichte und sicher nicht ihr bedeutungslosestes ist zu Ende. Es hat wichtige Dekrete verfaßt und Vorsorge dafür getroffen, daß sie realisiert werden. Auch das Papsttum hat den Willen zur Fortsetzung, der konziliaren Tendenzen bekundet; man braucht nicht zu fürchten, daß es ein spektakuläres Ereignis ohne Folgen war, eine emotionale und verbale Angelegenheit, gut für Publizisten und den Ruf der Kirche bei den Außenstehenden.
Das Konzil hat im Verlauf seiner Arbeiten seine Materien reduziert und gerade dadurch seine Erfolge vergrößert; fast keines der verabschiedeten Dokumente trägt rein traditionalistischen Charakter und stellt nur ein Wiederholung des schon Gewußten und Praktizierten dar. Die verbalen Ergebnisse der Kirchenversammlung sind naturgemäß von verschiedener Gewichtigkeit; neben den schwerwiegenden Dokumenten über die heilige Liturgie, die Kirche, den Ökumenismus steht ein rasch verfaßtes und oberflächliches über die modernen Massenmedien. Aber die dokumentarische Ernte ist nur ein Bruchteil des Erreichten. Sehr Wichtiges liegt in der Atmosphäre, in den Begegnungen und Kontakten, den theologischen Hintergrundarbeiten, den Erfahrungen, die gesammelt wurden, in den geistigen Öffnungen, in dem Weltniveau der Verhandlungen, in vielen Imponderabilien, die sich schon der Beschreibung, geschweige denn der rationalen Auswertung entziehen.
Eine kopernikanische Wende
Das Bedeutendste am Vaticanum II ist, daß es allgemein als Anfang zur Entwicklung, nicht als Schlußpunkt einer definitiv gewordenen Situation empfunden wird. Es war in mancher Hinsicht ein Dammbruch, der lange Aufgestautes in Fluß brachte, eine Ahnung von den in der Kirche ruhenden Potenzen, die lange frustriert wurden. Es bedeutet in manchen Punkten eine dialektische, kopernikanische Wende, zugleich aber die Evolution jener Kräfte, die lange schon vorhanden waren, die offizielle Ernte privater Bemühungen, die sich immer als ekklesial wußten, ohne als solche anerkannt zu werden.
Das Fazit der Kirchenversammlung kann etwa so beschrieben werden:
Dem seelsorglichen Prinzip ist vor dem kirchenpolitischen, dem bloß dogmatischen zum Durchbruch verholten worden, und das trotz des Fehlens einer eigenen Kommission für seelsorgliche Angelegenheiten und des Fehlens einer diesbezüglichen römischen Kongregation. Die Heilsfrage, für Katholiken und Nichtkatholiken, stand im Hintergrund aller Beratungen. Die Kirche zeigte sich nicht in richterlicher, doktrinärer, herrscherlicher Geste, sondern als liebend besorgt im Dienst der Welt und der christlichen Brüder.
Das Konzil besaß ökumenischen Geist. Es nahm nicht nur von den üblichen Anathemen Abstand und verzichtete nicht nur auf polemische Formulierungen, sondern bemühte sich, mit den Getrennten Kontakt zu finden und ihnen in aufrichtiger Brüderlichkeit entgegenzukommen. Alle Formulierungen wurden den „Beobachtern“ (die oft zu Mitarbeitern oder doch Ratgebern wurden) vorgelegt, und man versuchte, ihre Standpunkte zu berücksichtigen. Das Dekret über den Ökumenismus selbst stellt den Beginn einer Theologie über diese Materie dar und bedeutet eine Wende im Verhältnis der Kirche zu den Getrennten. Es ging Hand in Hand mit den Initiativen des Papstes selbst und des Sekretariates für die Einheit der Christen unter der Leitung der bedeutendsten Figur des Konzils, des Kardinals Bea.
Verzicht auf den „weltlichen Arm“
Die Kirche beendet mit diesem Konzil ihr Mittelalter und die noch weiter zurückreichende konstantinische Ära. Sie schwört dem Staatskirchentum, der Idee des Sakralstaates, dem Papocaesarismus, der Zweischwertertheorie, dem pro-tektionistischen System und der Kreuzzugsmentalität endgültig ab und nimmt einen liebenswerten spirituellen Charakter an, der durch die politische Aura vergangener Jahrhunderte immer wieder verdeckt war, Ärgernisse und Unverständnisse hervorrief. Die Dokumente über die Religionsfreiheit, den Ökumenismus und die nichtchristlichen Religionen legen Zeugnis dafür ab. Die Kirche kann auch von den Gegnern füglich nicht mehr als machtlüsterne Klerokratie mißverstanden werden. Die Kirche, die für sich selbst Freiheit von den Staaten verlangt (und wie aktuell ist diese Forderung des Evangeliums!), ist auch bereit, die Gewissen der anders Uberzeugten zu respektieren. Sie verzichtet (nicht nur aus historischer Nötigung) auf die dubiose Hilfeleistung des „weltlichen Arms“, um sich durchzusetzen, um sich in der Gesellschaft existent zu erhalten.
Dem entspricht als analoges Faktum die Achtung vor der geistigen Freiheit ihrer eigenen Glieder. Hatte das Amt früher die Tendenz, möglichst viel und rasch zu dogmatisie-ren, und mußte es damals mit den Pionieren der Theologie in Konflikt kommen, weil oft Zeitbedingtes als Ewiges proklamiert wurde und die Entwicklung neuer Ideen im voraus suspekt war, herrscht nun eine Haltung des Vertrauens in die charismatischen Kräfte des Denkens vor (und darum handelt es sich bei Theologie). Das theologische Problemdenken ist erwacht, die Lehrbuchmentalität zurückgedrängt, nach der alles Tradierte unüberbietbar klar und problemlos gewiß ist. In den Kommissionen des Konzils hatte der Episkopat Gelegenheit, die glaubensklärende und bewußtseinserweiternde Arbeit der Theologen kennenzulernen, und die anmaßende Selbstverständlichkeit der Normaltheologie schwand dahin wie Schnee in der Sonne. Eine Reform des Indexwesens und des Sacrum Officium wird für die Zukunft eine geläuterte Praxis schaffen.
Die Kirche spricht viele Sprachen
Der Pluralismus hat in der Kirche seinen Einzug gehalten. Nicht im Sinne eines dogmatischen Relativismus (unter Ausschaltung der Wahrheitsfrage), sondern als Universalismus, als Katholizität verstanden. Die Kirche hat nicht nur viele Riten und Sprachen (ohne um ihre Einheit besorgt sein zu müssen); sie wird in Zukunft wieder (wie im Mittelalter) viele Theologien als Interpretationen des einen Glaubens besitzen. Der Monolithismus hat sich als Verengung, als „Kleingläubigkeit“ entlarvt; eine liturgisch, theologisch, disziplinar unifizierte Kirche kann nicht Weltkirche im Sinne der Völkerunion, sondern nur Diktatur sein.
Am Anfang der Kirche schon stand die Pluralität der Frömmigkeiten, der theologischen Positionen, der sozialen Strukturen; die Schrift ist, als historisches Dokument der ersten Generation, Zeuge dafür.
Die Kirche des Konzils zog aus dem selbstgewählten Ghetto unter die weltanschaulichen Realitäten der
Welt; sie ist kein erratischer Block mehr, der beziehungslos inmitten einer fremden Landschaft liegt; sie fühlt sich als ein Teil dieser Welt (wenn auch nicht „von dieser Welt“), gedenkt mit der Welt zu leben und zu leiden und weiß sich an die Welt gesendet, Kontaktlosigkeit als Un-berührbarkeit, als Tabuisierung ist kein Ideal mehr. Sie steht im Dialog mit den NichtChristen anderer Konfessionen, mit den Gottesgläubigen in aller Welt, ja selbst mit denen, die sich nichtgläubig fühlen und wähnen, und endlich mit ihren Feinden und Verfolgern. Die Kirche ist nicht mehr in Verteidigung, aber auch nicht in Polemik und Aggression begriffen. Sie segnet, ladet ein, sucht Versöhnung und Brüderlichkeit, ohne sich und das ihr anvertraute Evangelium aufzugeben oder zu verraten.
Die Kirche ist kein museales Stück mehr. Sie weiß sich als den lebendigen Leib Christi, der in der Welt atmet. Sie denkt nicht daran, aus der Geschichte, ihrem Fluß, ihren Veränderungen auszusteigen, um ein göttlich-monophysitisches Antlitz zu zeigen. Sie glaubt wieder intensiver an die wahre Menschlichkeit und Geschichtlichkeit ihres Herrn und sieht sich von der jeweiligen Zeit und Konstellation angefordert. Sie versucht, die „Zeichen der Zeit“ wahrzunehmen und sich der Situation korrespondent zu benehmen (Aggiornamento!). Sie versteht, daß „Welt“ und „Zeit“ nicht zu trennen sind; daß Welt nur in Zeit existiert.
Ebenbürtige Söhne Gottes
Die Kirche des Konzils repräsentiert sich als „klassenlose“ Gesellschaft. Das bedeutet nicht „Demokratisierung“ im Sinne der Fundamentalthese, „alle Gewalt (in der Kirche) geht vom (Kirchen-) Volke aus“, denn die Kirche hält fest daran, daß ihre grundlegenden Ämter nicht bloß ekklesialen Ursprungs, sondern eine Stiftung des Herrn sind, der auf Dauer Kirche wollte (s. Mt. 16, 16 ff.); aber sie erfährt sich als das eine brüderliche Gottesvolk, in dem es keine Herren und keine Untertanen, sondern nur ebenbürtige Söhne Gottes gibt, die alle an den „Ämtern“ Christi partizipieren, wenn auch nicht alle dieselbe Funktion im Leibe Christi, „der die Kirche ist“, besitzen. Den „Hirten“ stehen nicht dumme Schafe gegenüber, der „Mutter“ Kirche nicht lallende Babies, den „Vätern“ nicht unmündige Kinder, die kommandiert und gegängelt werden müssen. Insofern hat das demokratische Muster seine Analogie in der Kirche — es setzt urteilsreife, zur politischen Entscheidung und Mitarbeit fähige Bürger voraus. An Stelle der „Stände“ treten funktionell differenzierte Gruppen, deren Kollaboration die Kirche als Sozialgebilde ausmacht und aktiv erhält Das Prinzip der Gremialität unterstreicht nur die Tatsache, daß der eine Christus nicht schlichter-dings durch einen kirchlichen Funktionär ersetzt werden kann, sondern daß es auf der menschlichen Ebene der Kirchlichkeit der Koinonia, der Geistesgemeinschaft und Zusammenarbeit bedarf, um Kirche existent und lebendig zu halten.
Die postkonziliare Ära hat begonnen; sie dient zweifellos der Anwendung und Realisierung der Konzilsergebnisse; sie muß aber noch mehr auf das Weiterdenken der konziliaren Probleme, auf Ergänzung des Konzils, auf konsequente Verfolgung seiner Trends eingestellt sein. Das Konzil darf nicht wieder zum „Gesetz“, zur unveränderlichen kanonischen Norm gemacht werden, die kasuistisch und rubrizistisch ausgewertet wird. Es war ein Lebensvorgang der Kirche und muß neue Lebensvorgänge auslösen.