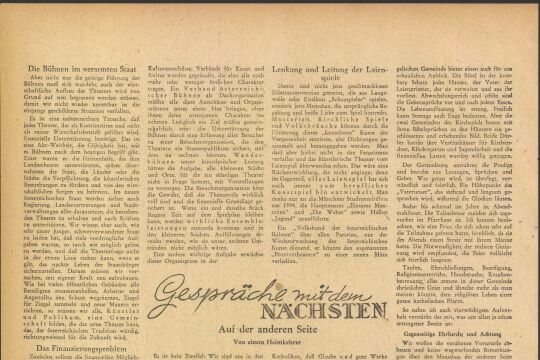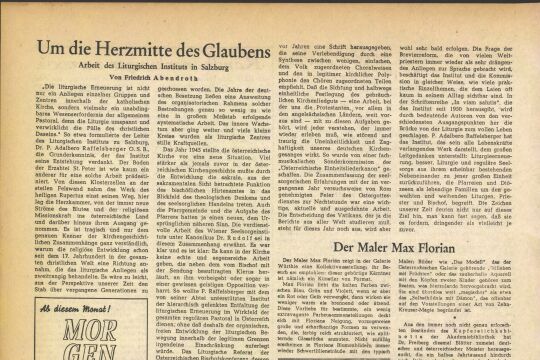Vollends Gegenwart aber setzte die Versammlung, als sie sich spontan entschloß, dem Bischof von Mainz ein Opfer für die Armen und Alten der Stadt (natürlich ohne Unterschied der Konfession) zur Verfügung zu stellen. 8000 DM trugen die Meßdiener nach dem Opfergang des letzten Tages zum Altar. Sie dienen dem Zweck einer aus dem Vollzug der Liturgie erwachsenen Agape, eines Liebesmahles, bei dem der Mainzer Wein nicht fehlen soll.
Ohne diese Bezüge zur Umwelt ist das, was sich auf diesem Kongreß zutrug, kaum zu verstehen: Keines der Referate kann losgelöst von Ort und Stelle voll gewürdigt werden. Gewiß waren sie alle gründlich vorbereitet und architektonisch gebaut, aber keines von ihnen war akademischer Selbstzweck, theoretisieren-des „Reden über die Dinge“. Keine der dem Präsidium schriftlich eingereichten Fragen war in spitzfindiger Neugier gestellt, keine Homilie trug den Charakter des bloß Erbaulichen. Prälat Johannes Wagner gab am ersten Tag noch einmal Bericht über die jahrelange Konzilsarbeit, die schließlich zur Konstitution über die Liturgie geführt hatte.
Zunächst schien es manchem Zuhörer, als werde hier Bekanntes wiederholt und der Text der Konstitution nur einfach interpretiert. Dann aber wurde zweierlei sichtbar: einmal die Verknüpfung der Liturgieordnung mit den übrigen Themen des Konzils, mit den Vorlagen über das Wesen der Kirche und über das Bischofsamt — besonders — und daraus erwachsend die Perspektive der Zukunft. Die Konstitution ist zwar ein Wort für Wort durch die Konzilsväter bestätigter Beschluß, aber sie weist in der Mehrzahl ihrer Vorhaben und Aufgabenstellung über den jetzigen Text hinaus. Sie gibt dem eigentlichen Reformwerk die einheitlichen geistigen Leitlinien, Richtung und in gewisser Hinsicht auch Abgrenzung. Die Durchführungsbestimmungen werden erst dann voll wirksam sein, bis die Kirchenversammlung die Vollmachten und Zuständigkeiten der einzelnen Hierarchen geklärt haben wird. Das Mißverständnis um das erste päpstliche „Motu proprio“ zur Konstitution hat ja bereits gezeigt, wo diese Klärungen unbedingt notwendig sein werden. Prälat Wagner deutete aus genauer Kenntnis der die jetzige Konstitution um ein Vielfaches übertreffenden Konzilsmaterialien auch an, in welcher Richtung sich die weitere Reform bewegen werde.
Professor Josef Jungmanns großer Traktat über „Wesen und Würde christlichen Gottesdienstes“ war das dogmatische Herzstück des Kongresses. Seine in einem reinen Leben Satz für Satz erarbeiteten und mit Nüchternheit frei von Schwär-mertum gewisser „Liturgisten“ alten
die heilige Liturgie verabschiedet hat, in der Geschichte der Kirche des katholischen Deutschlands, das gerade in Mainz seinen vornehmsten Mittelpunkt besitzt. Der Bischof von Mainz hatte den Dom selbst als Tagungsort für die Versammlung zur Verfügung gestellt und in seinem Grußwort dabei von der „Eignung zum Gottesdienst“ gesprochen, als den er demnach auch diesen Kongreß verstanden wissen wollte. Unter den Standbildern der Bonifatiusnachfolger eines Jahrtausends, die den „Heiligen Stuhl“ von Mainz innehatten und als des Heiligen Römischen Reiches Erzkanzler bis zu dessen Versinken die Entscheidungsstimme bei der Wahl des Kaisers und das Amt der Krönung besaßen, trat diese Gemeinschaft zusammen.
Mainzer Tradition im ganz lebendigen Sinn begleitete die drei Kongreßtage auch bei der gottesdienstlichen Musik (von Georg Paul Köllner, Heinrich Rohr und ihren Helfern geleitet). Sie war durch Elemente einer Tradition von mehreren Jahrhunderten bestimmt, deren zeitnaher, volksliturgischer Charakter das lang zurückliegende Datum ihres Entstehens kaum glaublich erscheinen ließ. Stils geprüften Thesen behandelten die innere Verbundenheit von Einzelgebet und gemeindlichem Gottesdienst.
„Wesen und Würde christlichen Gottesdienstes kann man nur voll verstehen, wenn man vom vollen Begriff der Kirche als Heilsgemeinschaft ausgeht. Träger des Gottesdienstes ist nicht der Priester am Altar allein, sondern die ganze Versammlung der Gläubigen ... Sie ist heiliges Volk, weil sie zu Christus hin versammelt ist und durch Ihn im Heiligen Geist Anbetung und Opfer darbringt... Auch der Einzelbeter betet nur als Glied der Kirche. Dieser kirchliche Charakter allen echten Betens, diese Entelechie des Betens auf die Kirche hin, kommt in der Ordnung der Sichtbarkeit aber erst in der rechtmäßig versammelten Gemeinde zur Geltung.“
In diesem Zentralsatz — gesprochen im übrigen vom Priester eines Ordens, der zuweilen überakzentuiert als Vorkämpfer der ganz persönlich zentrierten und der äußeren Liturgie reserviert gegenüberstehenden Frömmigkeit dargestellt wird — liegt die Lösung der so viel und fruchtlos diskutierten Scheinproblematik von „subjektiver“ und „objektiver“ Frömmigkeit, die schon Pius Parsch gesehen hat, für die ihm aber noch die dogmatische Ausdrucksmöglichkeit fehlte, weil das allem zugrunde liegende moderne Kirchenverständnis vor ein paar Jahrzehnten noch kaum entwickelt war.
Der dritte Hauptreferent, Professor Joseph Pascher, München, sprach aus der Wissensfülle des Liturgiehistorikers heraus, der jedoch durch das Material nicht erdrückt wird, sondern in jeder Stunde Priester und Seelsorger bleibt, dem es auf die fruchtbare Gegenwart, nicht auf die antiquarische Vergangenheit ankommt. Auch sein scheinbar sehr weitläufiger Eingangsteil über die Geschichte des Pascha-Mysteriums, das die neue Liturgieordnung in den Mittelpunkt jedes Gottesdienstes stellt, offenbart am Ende einen sehr gegenwartsbezogenen Zusammenhang zu den Grundfragen des Glaubenslebens. Das Verhältnis von Karfreitag und Ostermorgen, die innere Beziehung zwischen Tod und Wiedergeburt, Fasten und Freude, sinkender Ölbergnacht und weichendem Dunkel des Auferstehungsmorgens: das alles sind keine romantischen Stimmungsgehalte, keine behutsam übernommenen Traditionen. An diesen Elementen des Gottesdienstes offenbart sich das eigentliche Selbstverständnis der christlichen Existenz. Die Härte des realen Todes vom Karfreitag kann ebensowenig zugunsten einer allgemeinen Osterstimmung verharmlost werden wie der reale Charakter des Neuen Lebens zugunsten der Erlösungstat des Kreuzestodes. Joseph Pascher machte die Wandlung der Akzente im Laufe der für die Liturgie formentscheidenden ersten nachchristlichen Jahrhunderte an vielen Einzelheiten deutlich.
Der großartige neue Aufriß der inneren Ordnung des Kirchenjahres vom Pascha-Mysterium, den Pascher sodann vor den Zuhörern entwik-kelte, kann hier nicht im einzelnen wiederholt werden. (Es sei hier aber ausdrücklich auf das vor kurzem im Max-Hueber-Verlag, München, erschienene, 782 Seiten starke Werk des Verfassers „Das liturgische Jahr“ verwiesen.) Das ganz Neue an Paschers großem Kirchenjahrskonzept liegt in seinem überlegenswer-ten Lösungsversuch für die große Schwierigkeit einer Harmonisierung des Heiligenkalenders mit dem eigentlichen Herrenjahr, das nach der neuen Ordnung zwar den Vor-, rang haben, aber die Heiligenfeste nicht ganz verdrängen soll.
Es war ein guter Gedanke des Kongresses, die Nachmittagsreferate drei Pfarrern aus den Großstädten München, Wien und Zürich zu übertragen, die — vom Temperament her ganz verschieden geprägt — zur Praxis der Liturgie in der Zeit des Uberganges nach der neuen Konstitution sprachen. Im übrigen zeigten auch andere Sprecher, daß ihnen die Praxis nicht fremd ist, so etwa der bischöfliche Liturgiereferent Österreichs und Oberhirt der Diözese Linz, Dr. Zauner, der in seiner Homilie von den Problemen praktischer Seelsorge mit der Kenntnis eines perfekten Soziologen und mit dem realistischen Eifer eines Pfarrers sprach. Der Münchner Pfarrer Ernst Tewes sprach ebenso wie sein Kollege Ernst Maier aus Wien ohne schönrednerische und romantisierende Illusion von der realen Gemeinde der Gegenwart, die nun die Liturgiekonstitution verwirklichen soll. Beide Referenten stimmten darin überein, daß vor jedem liturgischen Funktionsdetail erst einmal die Substanzfrage gestellt werden müsse.
Die Pastoralerziehung in der Liturgie selbst sei weniger vordringlich als die Hinführung zur Liturgie für den Fernstehenden und — noch entscheidender — die Erziehung des durchaus aktiven Kirchenchristen zum Verständnis dafür, daß Liturgie nur einen Sinn hat als Herzmitte und Ausstrahlungszentrum eines christlichen Gesamtlebens. Der Münchner Pfarrer folgerte — in seinen praktischen Vorschlägen auf zwei wesentliche Punkte konzentriert, deren Verwirklichung ihm in absehbarer Zeit möglich erscheint: eine eigene, nicht nur aus der Verkürzung des Volltextes bestehende Liturgie für die Kindermessen und ein „einfacher“ Meßritus überhaupt für jene Gottesdienstfeiern, die die Fernstehenden zum Heiligtum hinführen sollen.
Die von der versammelten Aula, die sich in diesen Stunden fast wie ein kleines Konzilsplenum fühlte, ob ihrer Kühnheit mit viel Beifall bedachten Vorschläge des Wiener Stadtpfarrers und alten Vorkämpfers der Liturgischen Bewegung, Joseph Ernst Mater, hatten auch nichts anderes im Sinn als das, was Pfarrer Tewes etwas zurückhaltender formulierte. Hinter dem ausdrücklich als Fernziel angesprochenen Gedanken, dereinst zur Gesamtfeier der Liturgie in der Muttersprache zu kommen, steckt bei Pfarrer Maier auch nicht die Spur eines in Rom auch heute noch wie ein Gespenst gefürchteten Gallikanismus oder Febronianismus. Hier glüht der verzehrende Eifer eines Missionars, der wie Paulus dafür brennt, daß das Wort bis ins letzte hinein Fleisch werden, daß die Heilsbotschaft auch den am weitesten draußen Stehenden erreichen soll. Auch mit dem Gedanken, zuweilen — natürlich nicht am Sonntag — die Liturgie mit dem Priester zusammen in der Hausgemeinschaft zu feiern, will Pfarrer Maier das Gegenteil von dem, was man den Liturgikern gern als „Konventikelhochmut“ ankreidet. Er will alle Schranken niederreißen, will das ganz entäußerte Nachgehen und nichts mehr von der geistesaristokratischen Abgeschlossenheit gewisser liturgischer Gemeinschaften von früher. Pfarrer Eugen Egloff, Zürich, kommt aus der beneidenswert konzentrierten und der vertiefenden Seelsorgearbeit zugänglichen Welt der katholischen Diaspora der Schweiz. Bei seiner schlichten, priesterlich-spirituellen Schilderung der Pasahafeier in seiner Gemeinde ergriffen besonders die Worte über die ganz persönlich und existentiell vollzogene Fußwaschung als Zeichen der gelebten Brüderlichkeit. Der meditative Charakter seines Vortrages ließ die Worte nach ihrem Verklingen in der Phantasie nachwirken...
Wenn wir nun nach der Schilderung der Referate von den Gottesdiensten dieses Kongresses sprechen, so geschieht dies nicht, um am Ende die „stimmungsvolle Umrahmung“ zu erwähnen. Wir wagen die Behauptung, daß diese Gemeinschaftsfeiern vielleicht das Wichtigste und Eigentliche der gesamten Versammlung waren. Alle rein weltlichen Kongresse bestehen im Reden, Hören und Diskutieren. Man kann sich vom Gesagten distanzieren, man kann es beachten oder nicht beachten, man kann „in den Spiegel senen und weggehen“ (Jac. 1, 23). Irn Mittelpunkt dieses Kongresses stand bei allem Respekt vor seiner objektiven Wissenschaftlichkeit ein Tun, eine heilige Handlung. Wer immer an ihm teilnahm: es muß ihm klar geworden sein, daß man über die Liturgie, als die eigentliche und entscheidende Dimension des Menschseins überhaupt (nicht nur des christlichen Menschseins) nicht sprechen kann wie über Käferkunde oder Punische Kriege. Daß man sie tut, indem man spricht, hört, schweigt, singt, geht, darbringt, wartet...
Die Gottesdienste trugen weder Experiment- noch Mustercharakter. Der Gedanke, daß hier irgend etwas mit dem Zeigestab „demonstriert“ werden sollte, wäre ja an sich schon eine Lästerung. Christliche Gemeinschaft stellte sich so dar, so wie sie die Liturgiekonstitution heute sieht „in der Welt zugegen und doch unterwegs“. Im altfeierlichen Choralgesang der lateinischen Vesper bis hin zum renaissancehaften Zierat der Falsibordoni-Terzen wie in der brüderlichen Kommunionfeier des deutschen Hochamtes. Noch fehlt der Konzelebrationsritus, aber man konnte ihn vorausahnen, als man während der Eucharistiefeier die Bischöfe zur Kommunion gehen sah, Laien neben Priestern... in allen Ecken und Seitenschiffen, wo das Brot des Lebens hingetragen wurde.
Das „Ite missa est“ des Kardinals von München, Julius Döpfner, war eine Homilie über den Sendungsauftrag, die die Würde einer patristi-schen Predigt erreichte. Hier war der absolute Höhepunkt des Kongresses ein Abschluß, dem sich keiner mehr entziehen konnte. Alles, was in den Referaten angedeutet, umschrieben war, wurde hier zum unmittelbaren Lebenswort. Der Moderator des Konzils setzte mit seinen Worten von der weltverwandelnden Verpflichtung der Liturgie, vom königlichen Priestertum des Gottesvolkes — nach dem berühmten Text aus dem I. Petrusbrief, der einst am Anfang der Liturgischen Bewegung stand — das große, für die absehbare Zukunft geltende Zeichen.