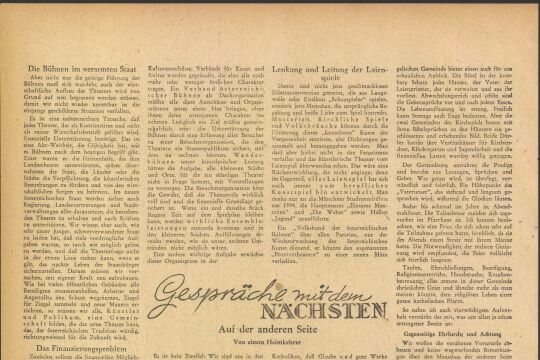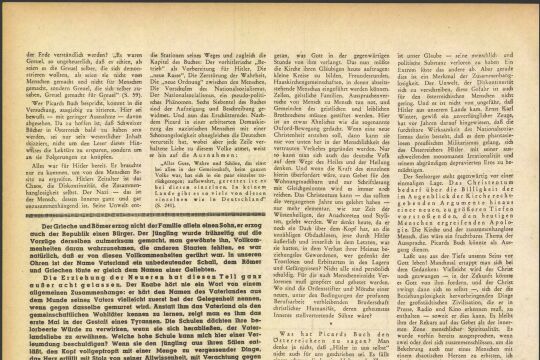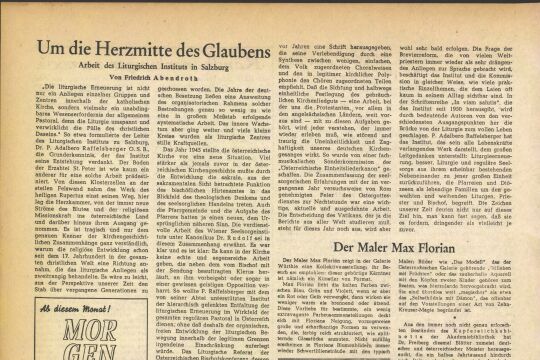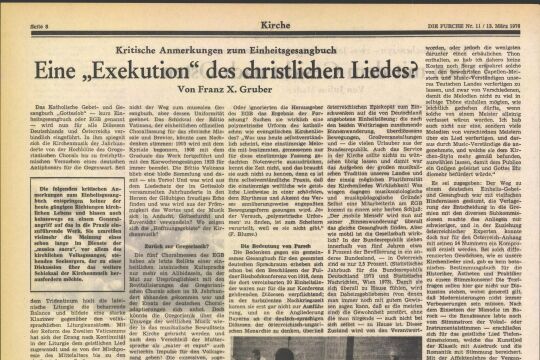Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Gegenthesen zur Liturgiereform
Welches Echo die begonnene Liturgiereform beim gläubigen Volk gefunden hat, läßt sich verläßlich nur mit den Methoden der empirischen Sozialfonschunig feststellen. Leider verfügen wir in Österreich noch über keine abgeschlossene Untersuchung. Es wurden aber vor kurzem die Ergebnisse einer in Argentinien durchgeführten Erhebung über die Auswirkungen der Liturgiereform veröffentlicht (Kathpress, 26. Juli 1966). Hier die Ergebnisse aus einem gewiß nicht „avantgardistischen“ katholischen Land, aus der Erzdiözese Rosario:
• Bei 97 Prozent der Befragten findet die Liturgiereform großen Anklang;
• 83 Prozent der Befragten erklärten, aus dem Wortgottesdienst Fortschritte im Glauben zu ziehen;
• nur noch 37 Prozent der Befragten geben an, die Sonntagsmesse aus Pflichtgefühl zu besuchen;
• der Sinn für die brüderliche Gemeinschaft der Pfarrfamilie ist bei 81 Prozent der Befragten gewachsen.
Diese überraschend hohen Prozentsätze zeigen, wie sehr sich die (hauptsächlich in teilweiser Verwendung der Volkssprache beim Sonntagsgottesdienst aktualisierte) Liturgiereform durchgesetzt hat.
Mitfeier ist Mitvollzug
Prof. Radö („Die Furche“, Nummer 30/1966), behauptet, man höre allzuoft (wie oft?, von wem?) die Klage: es werde immer herumkom mandiert, die Gottesdienste seien überorganisiert; vor lauter Auf stehen, Knien, Sitzen habe mah keine Ruhe mehr. Diese Behauptung trifft zumindestens für den Bereich der Wiener Erzdiözese nicht zu. Ganz im Gegenteil! Was die Gläubigen vermissen, sind bindende und entsprechend bekanntgemachte Richtlinien darüber, bei welchen Teilen der Messe sie aufstehen, knien und sitzen sollen. Immer wieder kommt es vor, daß einige aus der Gemeinde bei einer Stelle der Messe aufste-
hen, wo dies bisher nicht üblich war und daraufhin zögernd andere Gläubige dieser liturgischen Geste nach- kommen. Dadurch wird die Andacht erheblich gestört. Sicherlich ist es nicht nötig, während des Gottesdienstes pausenlos körperlich tätig zu sein. Aber vom dauernden geistigen Mitvollzug der Eucharistiefeier bann man die Gläubigen doch wohl nicht dispensieren! Man mache daher auf wirksame Weise bekannt, wie auch der körperliche Mitvollzug der Liturgie beschaffen sein soll.
Die christliche Gemeinde hat einen unveräußerlichen Anspruch auf die Wandlungsworte.
Es ist eine mißverständliche Auslegung. der Liturgiekonstitution, das in Artikel 30 angeführte „heilige Schweigen“ speziell auf den Kanon zu projizieren, die Wandlungsgebete still verrichten zu lassen und so das gläubige Vdlk um das Erhabenste und Wichtigste des gesamten Meßopfers, nämlich um die Einsetzungsworte, zu bringen. Nach dem Sanctus bricht der Kontakt Priester-Volk plötzlich ab. Tatsächlich bildet der Kanon einen „erratischen Block“ in der Messe! Die einzige Möglichkeit des Mitvollzuges wäre heute das Mitlesen im Volksmeßbuch — schon deshalb eine unbefriedigende Lösung, weil sich lateinisch einfach schneller beten läßt, als deutsch. Der Kontakt des Zelebranten mit der Gemeinde wird erst wiederhergestellt durch die Erhebung der konsekrierten Hostie und des Kelches, die der Priester dem Volk zeigt. Auch hier wieder deutliche Zeichen von Unsicherheit und verschiedenste Gebärden der Gläubigen: viele empfinden den Zeigeritus als Konsekrationsakt. Sie werden in dieser Fehlmeinung durch die noch immer üblichen Glockenzeichen bestärkt, die bei lautgesprochenem Wandlungsgebet ja völlig entbehrlich wären. Darum die kategorische Forderung: Christi Einsetzungsworte dem Volk hörbar machen!
Die Gläubigen sollen sich auch bei der Sonntagsmesse mit dem Priester vereint dem individuellen Gebet widmen können.
Ich stimme mit Herrn Prof. Radö durchaus überein in der Feststellung, die Liturgie sei keine Nonstopmusik. Auch im Gemeinschaftsgottesdienst sollte eine gewisse Zeit für das individuelle Gebet reserviert sein. Der dem „höchstpersönlichen“ Gebet gewidmete Zeitraum kann aber nur dann wirksam genutzt werden, wenn er nicht in einer „Ausblendung“ des Volkes bei „Continuo“ des Priesters besteht. Vielmehr hätte der Priester die versammelte Gemeinde durch eine wirklich nutzbare Pause nach einem „oremus“ oder durch eine besondere Aufforderung an anderer Stelle zum Gebet in eigenen Anliegen anzuleiten und dieses Gebet auch selbst mitzuvollziehen! Ein guter Ansatz hierfür sind die Fürbitten, die einen echten Gewinn darstellen. Wären sie noch konkreter igefaßt und würden sie es vermeiden, konsequent Kirche und Hierarchie an erster Stelle zu nennen! Wir Christen sollten viel mehr an die anderen, besonders auch an die Feinde der Kirche, denken und für sie bitten.
Alle Gegebenheiten, die geeignet sind, zwischen Priester und Volk Distanzen zu schaffen, sind abzubauen.
Die Argumente, mit denen Professor Radö die Nichtverwendung des Volksaltares rechtfertigt, sind wenig stichhältig. Erstens das kunsthistorische Argument: ein „Hilfisaltar“ in einer Barockkirche etwa verursache „Schwierigkeiten in einem Kunstdenkmal“. Hat man nicht im Verlauf der Geschichte immer wieder zeitgenössische Ausdrucksformen in vergangene Stile eingefügt? Sind der Barockaltar im Stephansdom zu Wien oder die Kanzel des Gurker Domes tatsächlich störende Fremdkörper? Man muß eben das Herz zu einer großzügigen Lösung im Kirchenraum haben und nicht nur einen „Ersatzaltar“ aufstellen! Sodann das Argument, der Priester sei während des ganzen Wortgottesdienstes dem Volk sichtbar, könne sich also während der Hauptteüe der Messe ohne weiteres von seiner Gemeinde abkehren. Wieviel vom Abendmahlcharakter der Eucharistiefeier bleibt da noch übrig? Wie verträgt sich diese Auffassung mit Artikel 48 der Liturgie- konstitution, wo es heißt: „So rich tet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, daß die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen... Sie sollen die unbefleckte Opfergabe darbringen nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen...“
Um den Altar versammelt, wollen wir als mündige Christen ein Gedächtnismahl feiern, nicht aber mit Worten und Oblaten abgespeist werden!
Die Reform des Volksgesanges ist neben der Einführung der Volkssprache das wichtigste Anliegen der postkonziliären Kirche auf liturgischem Gebiet.
Diese These ist eigentlich keine Entgegnung, sondern eine Ergänzung rnoio; rtniv des Artikels von Prof. Radö. De: Volksgesang ist in doppelter Hinsichl reformbedürftig: .textlich und musikalisch. Wie dies auch, ip den Leserbriefen in der Nr. 31 der „Furche“ zum Ausdruck gekommen ist, is į, es dem Menschen des ausgehender 20. Jahrhunderts (und nicht nur der Jugend!) unzumutbar, vom „süßer Jesus“ und von der „wunderschön prächtigen, hohen und mächtigen, liebreich holdseligen, himmlischen Frau, der ich mich ewiglich weihe herzinniglich“ zu singen. Noch dazu in einer Tonlage, die für geschulte Knabenkehlen des letzten Jahrhunderts gedacht ist und aus Gründen rein biologischer Entwicklung heute nicht mehr anwendbar ist. Die erste Forderung lautet daher: Schaffung von zeitgemäßen Texten zu traditionellen Melodien, ihre tonlagen- und tempomäßige Neubearbeitung. Dann kommt die Forderung nach zeitgenössischen Werken für den Volksgesang, die von vornherein weder süßlich, noch schleppend, noch zu hoch gesetzt sein werden. Erst an dritter Stelle steht das berechtigte Verlangen der Jugend, auch rhythmisch betonte Weisen ihrem Gotteslob zugrunde zu legen.
Zum Schluß noch eine Grundüberlegung: Der Sinn des Konzils war vor allem der, das Christentum vor einer drohenden Stagnation zu bewahren. Denken wir immer daran, daß es nicht unsere Aufgabe ist, den im Glauben gefestigten Brüdern und Schwestern Überraschungen zu ersparen, sondern daß wir vom Geist des Evangeliums her verpflichtet sind, in die Welt hinein zu wirken. Wir werden die Zahl der Besucher unserer Pfarrmeasen nur dann steigern, wenn jeder, der die Kirche betritt, das Gefühl bekommt, zeitgemäßen gottesdienstlichen Formen beizuwohnen, gerne gesehen zu sein, „dabei zu sein“. Dazu könnten unsere Priester viel beitragen, wenn sie etwa die Gemeinde vor dem Gottesdienst begrüßten und zwei, drei Sätze zur Einführung sprächen. Dazu gehörte die Schaffung einer kinderfreundlichen Atmosphäre im Pfarr- bereich — etwa ein Babysitterdienst während der Sonntagsmessen — und ähnliches mehr. Kompromisse mit Formen, die bereits der Vergangenheit angehören, helfen den Christen, die ihr „königliches Priestertum“ ernst nehmen, da nicht weiter. Es wird Aufgabe der kommenden Diözesan- äynoden sein, diese Dinge klar zu sehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!