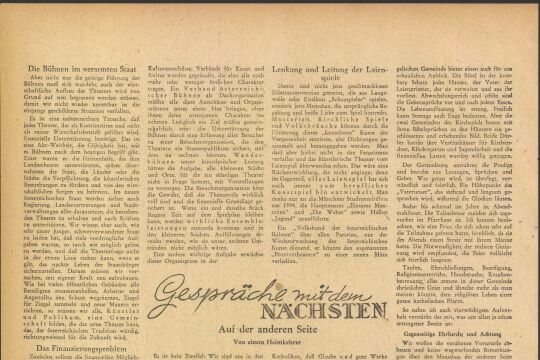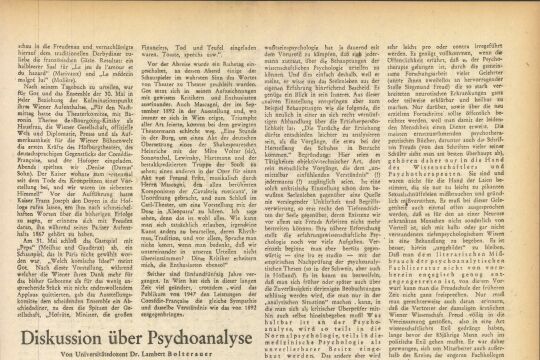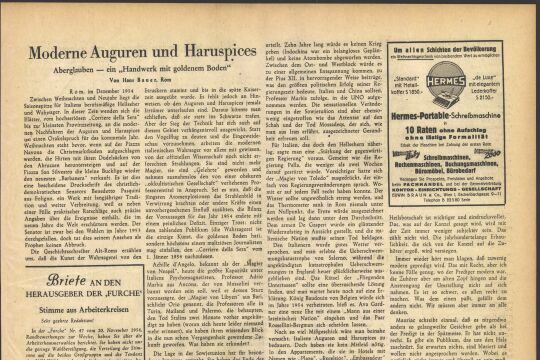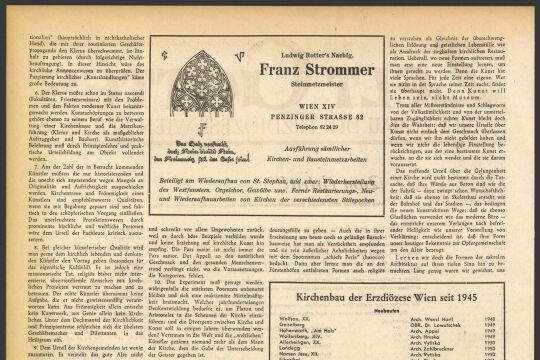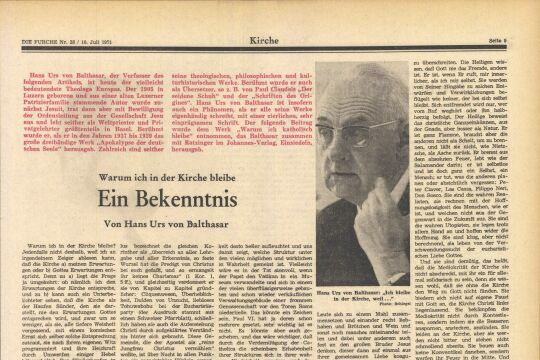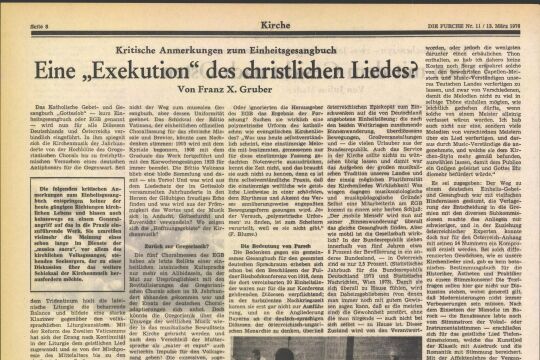Wer viel unterwegs ist, sei es als Tourist, sei es aus beruflichen Gründen, lernt die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils unter einem besonderen Aspekt kennen, sofern er auf Reisen nicht darauf verzichtet, die Sonntagsmesse zu besuchen. Die liturgischen Reformen haben nicht nur der jeweiligen Landessprache zum Durchbruch verhol-fen; sie haben auch zu einer Diversifikation der Riten, Texte und Gewohnheiten geführt, die kaum größer sein könnte, wenn sie beabsichtigt und ausdrücklich angeordnet wäre.
Über Motive und Ursachen dieser Erscheinung soll hier nicht weiter spekuliert werden; wenn die Obrigkeit eine Ordnung, an der sie jahrhundertelang mit rigoroser Strenge festgehalten hat, von sich aus lockert (und damit zu erkennen gibt, daß sie diese Ordnung nicht mehr für unveränderlich hält), öfhet sie eine Schleuse und vermittelt den Eindruck, daß nun auch die neuen Regeln als veränderlich zu gelten haben.
Ebensowenig können die Folgen und Auswirkungen dieser Diversifikation diskutiert werden, weil dies zu weit führen würde; immerhin dürfte gestattet sein, einige Fragen zu stellen, auf die der Verfasser freilich selbst nicht immer eine schlüssige Antwort weiß.
Dies ausdrücklich zu bemerken, erscheint nicht überflüssig. Es kommt immer häufiger vor, daß man von gänzlich Unbekannten (auch Jugendlichen) angesprochen und auf liturgische Besonderheiten hingewiesen wird, sei es auf die Rarität einer Pfarrei mit lateinischem Hochamt, auf eine Abtei mit gregorianischem Choral, auf eine „stille“ (und predigtfreie) Messe, sei es auf„Jazzmes-sen“ oder Eucharistiefeiern in Privatwohnungen. Zumal in Frankreich werden Orts- und Zeitangaben über Sonntagsgottesdienste im vorkonzd-liaren Stil als Geheimtips gehandelt. Es würde nicht verwundern, wenn im Lande des Guide Michelin demnächst ein Führer durch die so unübersichtlich gewordene Liturgie-Landschaft der doulce France erschiene. Eine hohe Anfangsauflage wäre wohl kaum ein Risiko.
Schließlich sollen bei alledem keine Wertungen ausgesprochen, keine Urteile gefällt, sondern Beobachtungen mitgeteilt werden — ob-zwar der Beobachter gewisse Sorgen, die ihn dabei befielen, nicht ganz unausgesprochen lassen kann.
Was im folgenden geschildert wird, ist eine höchst zufällige und ergän-zungsbedürftige Sammlung von Einzelfällen, in keinerlei Hinsicht auf Grund bestimmter Informationen aufgesucht noch vermieden. Es sind Eindrücke vom jeweils „Nächstliegenden“.
Brüssel, Sonntagshochamt in der Kathedrale. Die 40 bis 50 Gbttes-dienstbesucher füllen nicht einmal das Viereck um den freigestellten Altar. Dort ist kein Kreuz zu sehen, wohl aber ein Mikrophon. Keine Kerzen. Im Kirchenschiff keine Kniebänke, kein Gestühil, dafür einige Reihen von Klappsitzen (natürlich ohne Kniebänke), die aus einem aufgelassenen Kino erworben wurden, wie aus kleinen Blechmarken an den Lehnen hervorgeht. Nebenaltäre abgeräumt, der ganze Raum trist und öde.
Brüssel, kleine Kirche in der Nähe der Grand' Place. Singmesse am Sonntag. Nach dem Credo setzt sich der Zelehrant auf einen Stuhl und wartet ab, bis die Kollekte „durch“ ist. Die Opferung entfällt, es geht gleich zur Präfation, dann folgt ein Kanon, der offenbar eigens angefertigt wurde. Bei der Wandlung (natürlich) „Becher“ statt „Kelch“. Die konsekrierten Hostien, die nach der Kommunion übrigbleiben, werden von Laienhand sogleich in die Sakristei weggetragen. Tabernakel oder Ewiges Licht sind nicht zu sehen.
Kirche in einer belgischen Kleinstadt, Jugendmesse am Sonntag. Ein hektographierten Blatt mit den Liedertexten teilt die Eucharistiefeier ein in „Wortliturgie“ und ),Brotlitur-gie“ (Liturgie du Pain).
En nordwalisisches Badestädtchen. Volle Kirche beim Sonn'tagsgottes-dienst. Meßfeier ohne Experimente in englischer (nicht walisischer) Sprache. Viele von den Älteren Rosenkranzbeter. Gemeinde eher passiv während der Feier, wenn auch Laien Lesungen vortragen. Harmonium zu gefühlsbetonten Liedern. Nach dem Gottesdienst gemeinsame Kaffeetafel (plakatiert als Lockmittel für Gäste). Heitere Atmosphäre mit sektenhaf-tem Einschlag. Hochgradige Diaspora.
Wallfahrtsort im östlichen Frankreich. In der großen, erst in den letzten Jahren erbauten Kirche haben sich mehrere hundert Pilger zur Sonntagsmesse versammelt. Statt des Gloria wird ein Lied gesungen, das Credo wird durch eine vom Ze-lebranten vorgetragene verkürzte Paraphrase ersetzt, in der einiges fehlt: die Geburt aus der Jungfrau, die katholische Kirche, die Vergebung der Sünden; dafür wird alles sehr rhythmisch bewegt gewissermaßen im Dreivierteltakt vorgetragen. Im Hochgebet, das im Aufbau und mit den Anfängen der einzelnen Abschnitte dem Modell II folgt, wird an drei Stellen improvisiert — teils in Abänderung, teils in Ergänzung des Textes. Die Extempore-Passagen beziehen sich auf einige Pilgergruppen und auf die aktuelle politische Lage.
In einem südportugiesischen Dorf. Sonn- und feiertags nur eine Messe. Kirche gut gefüllt. Alle Besucher im Sonntagsstaat. Altar und Tabernakel getrennt. Missa versus populum. Gelassenes Zeitmaß (Dauer mit kurzer, sehr rhetorischer Predigt 50 Minuten). Meßformular wie bei uns, Muttersprache, keine Freiheiten. Viele Rosenkranzbeter, auch unter den jüngeren, aber durchwegs altarbezogen, eifriges Singen und Respondie-ren. Gottesdienstbesucher warten am Ende des Gottesdienstes, bis Arme vom Dienst sich zur Entgegennahme einer Gabe am Portal aufgestellt haben. Insgesamt: heitere, naivfromme Atmosphäre. Aktionismus begrenzt auf das Herausjagen der Hunde vor der Predigt und dem Kanon. Davon abgesehen sehr viel Ähnlichkeit mit einer normalen Sonntagsmesse in den zwanziger Jahren bei uns. Keine Diasporasituation.
Kirche in nordspanischer Kleinstadt. Halblaute Messe, weder still noch vernehmbar. Kein Dialog, aber versus populum. Nach der Kommunion zieht sich der Priester auf einen Sessel zurück, der vor dem alten Hochaltar aufgebaut ist, versinkt dn Schweigen. Es dauert ziemlich lange, nach drei, fünf Minuten fangen die Kirchenbesucher an, das Kreuz zu schlagen und hinauszugehen, zunächst einzelne, dann Gruppen. Wenige bleiben zurück. Schließlich steht der Priester auf und spricht Schlußgebet, Segen und Entlassung.
Hauptkirche einer mittelgroßen Stadt in Süditalien, sonntags um zehn Uhr. Wortgottesdienst am reich mit Blumen geschmückten neuen Altartisch. Sehr ausführliche und temperamentvolle Predigt, eine vom sporadischen Pubfliikum offensichtlich gewürdigte rhetorische Leistung. Die Bänke sind höchstens zu einem Sechstel gefüllt. Die heilige Messe zwischen Credo und Segen wird sehr schnell zelebriert, fast möchte man sagen: als lästiges Beiwerk. Nach der Kommunion füllt sich die Kirche plötzlich ganz. Ein Sänger erscheint, die Orgel setzt ein, am alten Hochaltar werden unzählige elektrische Lichter entzündet. Der Priester kommt, im goldenen Weihrauch, viele Kerzen. Gebete zur Muttergottes vom Rosenkranz zu Pompeji, eine gute halbe Stunde. Für die dort Versammelten ist das augenscheinlich der wichtigste Teil des Gottesdienstes.
In einer Großstadt Jugoslawiens. Brechend volle Kirche, freilich hauptsächlich ältere Leute. Kirchenraum eiskalt. Gottesdienst in Landessprache, strenges Ritual. Starke Beteiligung der Gläubigen. Soziale Kontakte fast betont zur Schau gestellt, allerdings nur von den Alten, vor und nach dem Gottesdienst. Volkskirchliche Restgemeinde dn einem atheistischen Staat.
Kirche in einer dörflichen Sommerfrische in Tirol. Die Kirche gesteckt voll, der Besuch muß jedes Seelsorgerherz erfreuen, die Sangesfreudigkeit ist ungebrochen. Es gibt eine längere Predigt über Streitfragen der zeitgenössischen Theologie, wobei der Prediger aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Es ist heiß, die Leute geben es auf, etwas zu verstehen, es zieht sich in die Länge. Dafür entfällt die Opferung. Niemand zeigt Verwunderung, es scheint immer so zu sein.
Kindergottesdienst in deutschschweizerischer Großstadt. Lesungen und Gebetstexte auf Schwyzerdütsch, Responsorien hochdeutsch. Das hier Fremdsprachliche des Hochdeutschen tritt deutlich zutage; die Kinder kleben an den vorgedruckten Blättern, sie lesen fleißig ab, sie könnten nicht holperig-bemühter beten, handelte es sich um das „unverständliche“ Latein. Es hört sich an, wie gesprochenes Papier.
Sonntagsmesse auf französischem Touristenschiff im Mittelmeer. Amerikanischer Geistlicher zelebriert auf englisch, das keiner der sonst Anwesenden versteht, auch nicht der Deckoffizier, der ministriert. „Muttersprache“ als Selbstzweck — wessen?
Pfarrkirche an der Innenstadt von Paris. Ein von der Geistlichkeit unterzeichnetes Plakat an der Ein-gangstür ermahnt die Gottesdienstbesucher streng, kein Gebetbuch zu benutzen, auf keinen Fall während der Eucbaristiefeier matzuleeen, weil dadurch die aktive Teilnahme an der Verwirklichung der Gemeinschaft gestört werde. (Der Verlauf der Meßfeier weckt den Verdacht, daß dieses Verbot deshalb erlassen worden sei, weil es dem „Laien“ erschwert werden soll, Abweichungen von den approbierten Texten festzustellen.)
Kleinstadt in Westdeutschland. Ikebana auf dem Altartisch, aber weder Kreuz noch Kerzen. Fünf Mikrophone: je eines auf dem Altar, auf der Kanzel, auf dem Ambo, seitlich bei den neu eingerichteten Sitzen und am Hochaltar. Kein Ministrant. Ein Erwachsener im Chorrock ist ausschließlich damit beschäftigt, das jeweils benutzte Mikrophon ein-und auszuschalten, herzutragen, wegzubringen, besser zu justieren. Wein und Wasser holt der Zelerant selbst, er gießt auch das Wasser mit der einen Hand über die andere. Schon bei der Begrüßung schrickt jeder zusammen, der Priester ist ein Naturtalent, das sämtlicher Stimmverstärker leicht entraten könnte.
Klosterkirche im Rheinland, Sonntagsmesse für die Pfarrgemeinde. Die Predigt rankt sich um die These: Es kommt weniger darauf an, daß wir uns im Gottesdienst an Geschehenes erinnern, als daß wir Hoffnung auf eine menschlichere Zukunft stiften. Die Einsetzungsworte werden allerdings nicht in dieser Richtung modaflziert. Sie sprechen nicht von Jüngern, sondern von Freunden. Im Credo wird „katholische Kirche“ ausgespart.
Die hier wiedergegebenen Beobachtungen schildern keine „Sensationen“, keine extremen Sachverhalte, sondern alltägliche „mittlere“ Zu-standisbilder. Sie wären beliebig vermehrbar. Zweifellos gibt es aufregendere Versuche, „kreative“ Liturgie hervorzubringen, Experimente anzusetzen und Variationen eines Themas zu erfinden, von dem man annimmt, im Original langweile es die Zuhörer. Aber gerade die „mittlere“ Skala ist beachtenswert, da das, was sich auf ihr abspielt, kein Aufsehen mehr erregt, sondern stillschweigend hingenommen oder zumindest ertragen wird. Die Extreme nutzen sich um so eher ab, je extremer sie sind. Sie erscheinen daher auf die Dauer weniger gefährlich.
Folgende Fragen müßten überlegt werden:
Welchen Nutzen für die „actuosa partieipatio“ der Gläubigen am Gottesdienst kann man sich von einer Liturgie versprechen, deren durchgängiges Merkmal darin besteht, daß sie von Land zu Land, von Bistum zu Bistum, von Pfarrei zu Pfarrei, ja von Zelebrant zu Zelebrant verschieden ist? Lehrt nicht die moderne „Lerntheorie“ so gut (wenn auch auf andere Weise) wie die alte Pädagogik, daß Einübung notwendig ist, damit Sicherheit des Umgangs erreicht wird? Ist Ritus nicht in besonderem Maße darauf angewiesen, daß alle Beteiligten wissen (oder ahnen) können, um was es in jedem Augenblick geht, was sich da vor ihren Augen und Ohren, in ihrer Gegenwart, für sie und in ihrem Namen vollzieht? Ist es mit dem Sinn von Ritus vereinbar, wenn ständiges Verändern UnfclaTkeit erzeugt, wenn aus Angst vor gedankenloser Routine des Gleichen eine ebenso gedankenlose Routiniertheit des Verän-dems einzieht? Wenn schließlich die Gottesdienstbesucher, statt über bekannte Texte meditieren zu können, in ständiger Erwartungshaltung sind, bangend oder hoffend, was nun heute wieder neu, anders und überraschend auf sie zukommen werde?
Wie steht es mit den psychologischen Voraussetzungen für den Zugang zu einem Mysterium, das vom ersten bis zum letzten Augenblick durch laut gesprochene Worte begleitet, zitiert und gedeutet wird? Woher kommt die eigentümliche Angst vor einem Moment der Stille dm sakralen Vollzug? Glaubt man, die Kirchgänger kämen auf gedankliehe Abwege, wenn man sie eine Minute sich salbst, ihren eigenen Erwägungen, Sorgen und Bitten überließe? Ist die heutige Liturgiepraxis überhaupt noch aus ihrer authentischen Tradition bestimmt, wird sie nicht viel stärker von äußeren Faktoren beeinflußt: von der Dauerbe-rieselungswirkung der Radio- und Fernsehprogramme, von der Angst, daß ein „toter Punkt“ entstehen könnte, wenn das „Programm“ nicht nahtlos-atemlos weiterläuft?
Welche Hinfühirung zum Unsagbaren des Sakraments erfahren diese wohldressierten Gemeinden, die, durch laute, oft unwirsche Aufforderungen erinnert, durch einen Dirigenten angeleitet, kollektiv aufstehen, hinsetzen, niederknien, dm Sprechrohr beten oder singen?
Welches Verständnis von Ökumene gibt eine Kirche kund, die das einzige sprachliche Bindeglied, das an die tausendjährige Gemeinschaft mit den Kirchen des Ostens erinnert, aus ihrer Liturgie streicht — im Zeitalter der Ökumene? Ohne Not außerdem; denn was das Kyrie sagen will, hat jeder Kirchgänger gewußt, zumal das „Kyrieleis“ in viele deutschsprachigen Kirchenlieder eingegangen Ist und dort (hoffentlich) überleben wird?
Welche Vorstellungen von „Weltkirche“ und „Überwindung nationaler Schranken“ lassen sich vereinbaren mit der nahezu ausschließlichen Verwendung der Muttersprache dn der Eucharistie? Noch nie haben so viele (überwiegend katholische) Ausländer uniter Deutschsprachigen gelebt wie heute — .ist es da nicht paradox, daß gerade jetzt die katholische Liturgie exklusiv deutsch wird? Alles spricht davon, daß die ausländischen Arbeiter „integriert“ werden sollen; wäre es nicht richtig, zuerst zu fragen, wie man sie am Gottesdienst teilnehmen lassen kann, bevor man sich den Kopf über ihre Beteiligung an „Räten“ zerbricht (was keineswegs ein Argument gegen diese Beteiligung sein soll)?
Wie sollen Kinder und Erwachsene zu einem Minimum an Höflichkeit gegenüber Gott erzogen werden, wenn die äußeren Zeichen der Anwesenheit Gottes am Kirchenraum immer unmerklicher gemacht oder ganz beseitigt werden? Wenn man beim Betreten der Kirche weder ein Tabernakel noch ein Ewiges Licht erkennen kann? Wenn die konsekrierten Hostien auch gar nicht mehr in der Kirche aufbewahrt, sondern „die Reste des Mahls“ abgeräumt und im Pfarrhaus oder in der Sakristei aufgehoben werden? Der Verfall der Formen vollzieht sich izwar auch in der weltlichen Sphäre in erschreckendem Tempo, aber muß das auch in der Kirche so sein? Wer einmal beobachtet, wie so viele Kirchgänger, junge wie alte, das „Haus des Herrn“ betreten, in die Bänke stolpern, sich ohne Gruß, ohne eine Sekunde Anbetung, ohne Kniebeugen oder Kopfneigen niederlassen, der kann sich nur fragen, wie die gleichen, gewiß gutwilligen Leute sich wohl benehmen, wenn sie das Haus minder wichtiger Chefs betreten. Aber kann solches Verhalten getadelt werden, wenn die kirchlichen Reformer Kniebeugen vorwiegend unter dem Gesichtspunkt ihrer Abschaffbarkeit betrachten und die sichtbaren Hinweise auf die Realpräsenz Gottes dn seinem Hause möglichst verstecken?