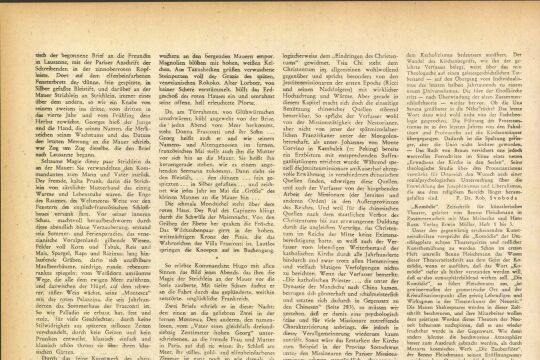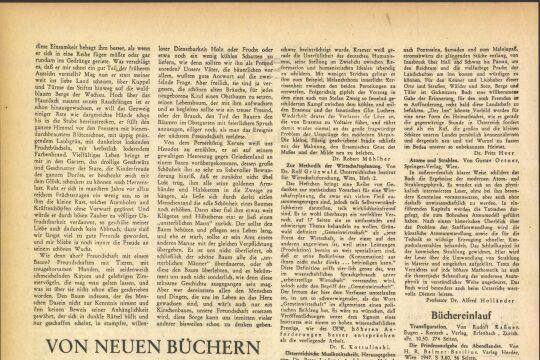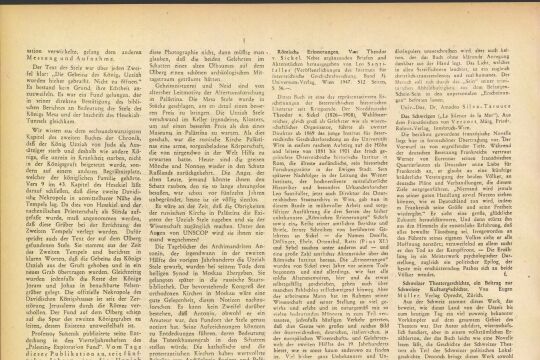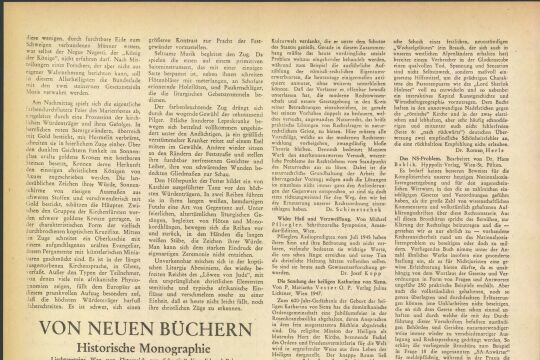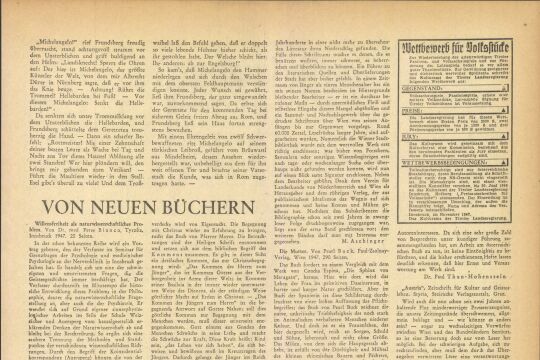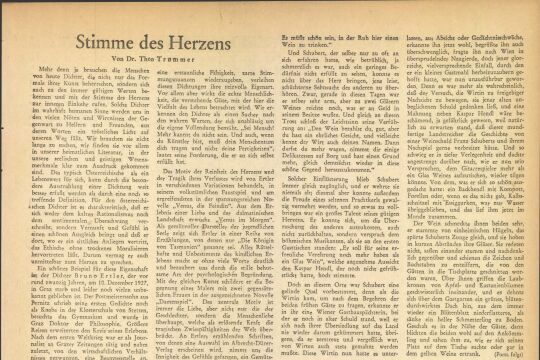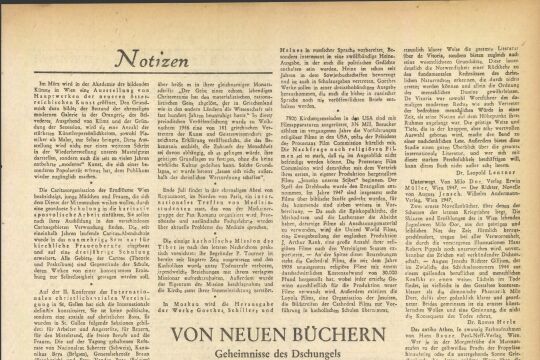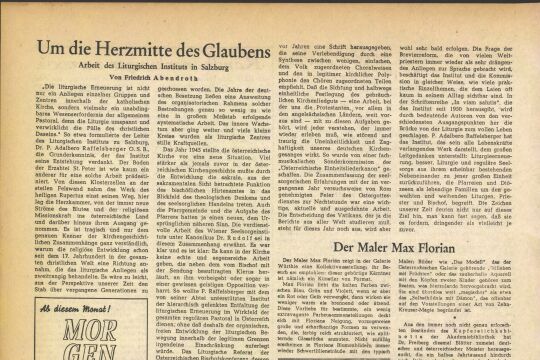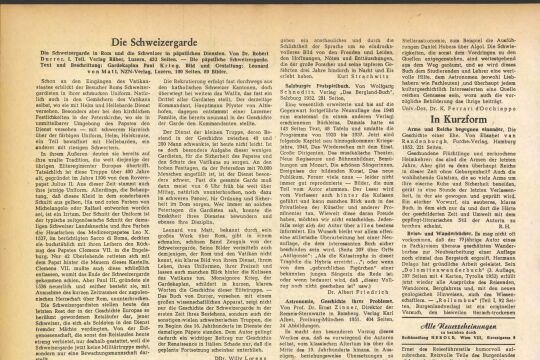„Während es einem Fremden, der etwa in Korinth zu der Eucharistiefeier der christlichen Gemeinde hinzugekommen wäre, sogleich klar gewesen wäre, daß hier ein Mahl gehalten wird, würde es einem Uneingeweihten, welcher der heutigen Liturgie des eucharistischen Opfersakraments beiwohnt, ohne nähere Erklärung nicht verständlich sein, daß hier ein Mahlopfec gehalten wird.” Mit diesen Worten kennzeichnet Michael Schmaus in seiner Dogmatik die Aufgabe, die jedem gestellt ist, der die heutige Form der Meßfeier erklären und ihre Identität mit der Feier des letzten Abendmahles auf- zeigen möchte. Wie kam es dazu, daß die ursprüngliche Form des Mahles mehr und mehr durch symbolisch-kultische Formen abgelöst wurde? Verschiedene Antworten auf diese Frage sind schon versucht worden. Die bisher umfassendste und gründlichste legt J. A. Jungmann in seinem zweibändigen Werk „Missarum solemnia” vor. Er überschaut das „Werden und Wogen” liturgischer Formen, um dann das Fernrohr mit einem Mikroskop zu vertauschen, in dem er die kleinsten und feinsten Lebensvorgänge beobachtet. Er weiß wohl, daß er zu beidem nicht imstande wäre, wenn nicht in den vorausgehenden Jahrhunderten aus der vereinigten Lebensarbeit vieler jene liturgie- gesdiiditlichen Erkenntnisse gewonnen worden wären, die erst heute sowohl den Überblick über das Ganze als die Untersuchung der feinsten Einzelheiten ermöglichen. Persönlich hat er keine Mühe gescheut, um sich durch jahrelange Vorarbeiten dazu zu befähigen, allen ein sicherer Führer zu sein auf dem Wege durch das „tausendjährige Schloß, das mit seinen hohen Türmen und weiten Sälen den, der es betritt, zunächst fremdartig anmutet”. Gerne folgt man seiner Führung, mit von Schritt zu Schritt wachsender Spannung, bis wir schließlich vor dem Eingang zum Heiligtum, dem Beginn der Opfermesse, angelangt sind, in die uns der zweite Band des Werkes einführen wird.
Am Ende dv- Führung fühlen wir ähnlich wie Jungmann, der, bei der nachtridentimschen Liturgiereform angekommen, schreibt: „Das Missale Pius V. bedeutet nach den anderthalb Jahrtausenden ununterbrochener Entwicklung des Ritus der römischen Messe, nach dem Rauschen und Strömen von allen Höhen und aus allen Tälern, einen gewaltigen Staudamm, von dem an die angesammelten Wassermassen nur mehr in festen Leitungen und in wohlgebauten Kanälen ihren Weg fortsetzen dürfen. Mit einem Schlag sind alle eigenwilligen Um- und Seitenwege abgeschnitten, ist allen Überschwemmungen und Übermurungen gewehrt und ist ein regelmäßiger und nutzbarer Fongang gesichert. Aber es ist damit auch in Kauf genommen, daß das blühende Flußtal nun öde liegt und daß die Eigenkräfte der weiteren Entwicklung nur mehr in den bescheidenen Rinnsalen eines oft dürftigen Andachtswesens abseits des großen Laufes sich sammeln und zu neuen Audrucksformen gelangen können.” Mit diesem, der Bergwelt entnommenen Vergleich schildert Jungmann, selbst ein Sohn der Berge, aus Täufers im Pustertal, den geistigen Ertrag seiner liturgiegeschichtlichen Wanderung durch zwei Jahrtausende.
Endgültig ist mit der evolutionistischen Liturgiebetrachrang aus dem Ende des ver- vergangenen Jahrhunderts gebrochen. Das vor Jahren von 3aumstark formulierte Gesetz der Liturgiegeschichte, daß spätere Neubildungen gewöhnlich die früheren Formen überwuchern, ist vollauf bestätigt. So kann der Verfasser von „Schrumpfungen” und „SdirumpfungserscheL nungen” sprechen, die auf dem Gebiete des liturgischen Gesanges, besonders bei der Zurück- drängung der responsorialen Solopsalmodie durch das Überwuchern der antiphonischen Chorpsalmodie zutage treten. Zeichnet sich der Blick auf die liturgische Frühzeit durch die geniale Zusammenschau der großen Entwicklungslinien aus, so erschließt die Behandlung der Neuzeit, angefangen vom Spätmittelalter über Barock, Aufklärung und Restauration zur Gegenwart, vielfach neue Gesichtspunkte, die bisher nicht oder kaum beachtet wurden. Im Vordergrund des Interesses steht dabei immer die Teilnahme der Gemeinde am liturgischen Tun des Priesters und der in verschiedenen Formen stets immer wieder erneute Versuch, die durch die Verschiedenheit von Liturgie und Landessprache bedingte Spannung zwischen Altar und Gemeinde zu lösen.
Mancher wird die von Jungmann gedeuteten Erscheinungen der verschiedenen Liturgieformen anders sehen und anders deuten. So kommt die Arbeit Odo Casels zur Erschließung des liturgischen „Mysteriums” nur sehr ungenügend zur Geltung, so gerne wir auch den Ausführungen über die Bedeutung des „Selbstopfers der Kirche” folgen, in dem Jungmann die eigentliche Bestimmung sieht, der das eucharistische Geheimnis dienen soll. Freudig begrüßen wir die Auffassung: „Das Meßopfer ist nicht nur die Darstellung des erlösenden Leidens und damit die Zusammenfassung der ganzen christlichen Heildehre, es ist auch der Inbegriff christlicher Lebensauffassung und Lebensführung. Von hier aus tritt auch die Kommunion in eine neue Beleuchtung. Auch sie ist geprägt vom Kreuz und vom Tod des Herrn.”
Mit besonderer Sorgfalt und feinem Verständnis werden durch alle Jahrhunderte hindurch die innigen wechselseitigen Beziehungen zwischen Liturgie und Kirchenmusik untersucht, natürlich in erster Linie die Bedeutung des absolut einstimmigen, jeder Instrumentalbegleitung fremden gregorianischen Gesanges, der über ein Jahrtausend die einzige bekannte und zugelassene Musik der Kirche bildete und dessen sorgfältige Pflege in der Kirche schließlich die Grundlage zu jener Vollendung der abendländischen Musik wurde, welche die Musik in den Ländern ohne Choralpflege niemals auch nur annähernd erreichte. In der Liturgie kam es dabei nicht darauf an, daß man singt, sondern vor allem darauf, wer und zu welchem Teile der Liturgie er singt. Hier hat sich der große Formenreichtum der schlichten Einstimmigkeit entwickelt, je nachdem in einer bestimmten liturgischen Funktion Priester, Volk, Sängerchor und Solist- den liturgischen Text vortrugen. Heute sind diese im ganzen Mittelalter in Europa heimischen und getreu überlieferten Melodien seit Pius X in ihrer Reinheit wiederhergestellt. Das 1868 dem Neudruck der Medizäa erteilte Druckprivilegium Pius IX. konnte dem Ansturm džs Choralkongresses von Arezzo 1882 trotz des ihn ablehnenden Dekrets der Ritenkongregation vom 10. April 1883 nicht widerstehen, obwohl dieses Dekret die Medizäa als die authentische und gesetzmäßige Form des Chorals erklärte. Abt Gufranger und in seinem Auftrag die Abtei von Solesmes haben in der Wiederherstellung dieser Melodien keine Mühen gescheut. Den Schatten, den der Verfasser über Gufranger zu sehen meint, wird wohl nicht jeder wahrnehmen können. Liegt über ihm ein Schatten, so ist es eher seine ungenügende, wenn auch zeitbedingte Stellung zur bildenden Kunst.
Weil Jungmann mit besonderer Sorgfalt auf die Teilnahme des Volkes an der heiligen Messe achtet, so erscheinen ihm sehr treffend die allegorische Meßdeutung des Mittelalters und die glänzende Kirchenmusik der Barockzeit als Versuche,, das Verständnis des unverstandenen liturgischen Wortes dem Volk durch eine Art Übersetzung in eine jedem Auge und Ohr verständliche Sprache.
Dabei konnte es freilich nicht ausblehen, daß manches unübersetzbar blieb, und so kam es, daß im Lauf der Jahrhunderte nicht nur die Form, sondern auch die Erfassung des tieferen Sinnes der Messe manchen Schwankungen unterworfen war. Der großen Menge fiel es wesentlich leichter, an der Außenseite und Oberfläche haften zu bleiben, statt zum Kern der Sache vorzustoßen. Zuerst nahm die Teilnahme am Meßopfer durch den immer seltener werdenden Kommunionempfang ab, während die Darbringung von Opfergaben noch lange anhielt. Schließlich verschwand auch diese. Das Volk wurde im Gottesdienst stumm und blieb es fast bis heute. Klerus und Volk waren voneinander getrennt. Man fragte sich höchstens, was das Volk tun solle, während der Priester für sich leine schließlich geheimgehaltenen Lesungen und Gebete sprach. Die barocke Berauschung durch Licht, Farbenreichtum und prunkvolle Musik konnte darüber nicht hinwegtäuschen, daß zwischen dem Geschehen am Altar und im Kirchenschiff nicht nur ein trennendes Gitter war, sondern eine tiefe Kluft gähnte. Für ein genetisches Verständnis des Meßritus war die Zeit noch nicht gekommen. „Die scholastische Theologie ist für Meßliturgi und Meßverständnis ohne Ertrag geblieben.”
Ähnliches gilt auch von der Theologie der Barockzeit. „So kam es insbesondere im Jesuitenorden, dessen Theologen in der geistigen Bewegung dieser Periode eine gewisse Führung innehatten, nicht zu einer inneren Begegnung mit der Liturgie oder gar zu einem pastoralen Ausschöpfen liturgischer Möglichkeiten.” Ja Papst Alexander VII. verurteilte sogar eine französische Übersetzung des Meßbuches und verbot weitere Übersetzungen unter Strafe der Exkommunikation. Hat doch auch die Entwicklung der Kasel „zu immer reicherem Schmuck, aber auch, da man dafür starre Flächen nötig hatte, zur späteren Mißgestalt der Kasel geführt”. Vorangegangen waren andere viel ernstere Mißstände: „Eine unnatürliche Häufigkeit der Meßfeier und im Zusammenhang damit ein unnatürliches Anwachsen des Klerus.” „Das Heiligste, was die Kirche besaß, hörte zwar nicht auf, der Mittelpunkt echter Frömmigkeit zu sein, aber die Nebel und Schatten, die sich um diesen Mittelpunkt legten, brachten es, zusammen mit anderen Umständen, so weit, daß die Stiftung Jesu, der Lebensquell, aus dem die Kirche durch anderthalb Jahrtausende geschöpft, zum Gespött werden und als greulicher Götzendienst dem leidenschaftlichen Verwerfungsurteil ganzer Völker verfallen konnte.” Diesen Verhältnissen gegenüber war die Wirkung der Reformation so stark, daß wir aus dem Munde des Bischofs Berthold von Ciemsee schon 1528 die Versicherung hören, in der Kirche von Salzburg hätten sich „früher hundert Gratianpriester (die von Stipendien lebten) über die Frage zu verschaffen wer die „unsterbliche Geliebte” Beethovens gewesen sei. Denn bei den drei Briefen, die an einem 6. und 7. Juli geschrieben wurden, handelt es sich um Dokumente von einer solchen Sittlichkeit und Reinheit des Gefühls, daß ihnen nicht viele Briefe aus der gesamten Weltliteratur an die Seite gestellt werden können. Die Klärung der Frage könnte übrigens auch unsere Erkenntnisse von der wechselseitigen Einwirkung von künstlerischem Schaffen und Seelenleben des Künstlers bereichern. In seiner gedrängten, mit philologischer Genauigkeit geführten Studie kommt Smolle zu folgendem Resultat: Beethovens Liebesbriefe können nur im Sommer 1812 von Karlsbad nach Teplitz geschrieben worden sein. Keine der von der bisherigen Beethoven- Forschung ins Auge gefaßten Frauen — weder Magdalena Willmann, Christine Gerhardt, Giu- lietta Guicardi, Josephine oder Therese Brunswik, Therese Malfatti, Bettina Brentano oder Amalie Sebald — kommt als Adressatin in Betracht. So bleibt das Rätsel um die „unsterbliche Geliebre”‘ auch weiterhin ungelöst, und es bestehen auch sehr geringe Aussichten, daß die Frage eines Tages eindeutig geklärt werden wird.
österreichische Kirchenmusik. Publikationen für den praktischen Gebrauch. Band IV: Franz Schubert, Geistliche Arien, Zwei Hefte. Klavierauszug von Prof. Louis D i 11. Verlag Döblinger, Wien.
Die beiden Heftchen bilden eine sinnige und dankenswerte Gabe. Die künstlerische und stilistische Entwicklung Schuberts, sein Bemühen um den sakralen Ausdruck der im letzten „Salve Regina” überzeugende Innigkeit erreicht, spiegeln sich in der Sammlung ebenso als das Auf und Ab verschiedener Strömungen im Wiener Musikleben der Biedermeierzeit. Gesanglich bietet das Opus fü geschulte Stimmen sehr lohnende Aufgaben im Sinne des geistlichen Konzertes, nicht aber für den liturgischen Gottesdienst. Prof.
Jung-fu wird Kupferschmied. Von Elisabeth Forman-Lewis, Verlag A. Pustet, Salzburg.
Ein interessantes, gediegenes Jugendbuch! Jung-fu, ein armer Chinesenjunge, kommt mit seiner verwitweten Mutter aus dem heimatlichen Bergland in die Stadt Chungking und tritt bei einem Kupferschmied in die Lehre. Was er in der Werkstatt unter guten und weniger guten Arbeitsleuten, und außerhalb des Betriebes auf Botengängen, sieht, hört oder erlebt, wird hier fesselnd erzählt. Das Leben des modernen
China mit seinen Sitten und Bräuchen, seinem Räuberunwesen und einer verwilderten Soldateska rollt anschaulich vor dem Leser ab. Jung-fu wächst an den Widerständen, die ihm entgegentreten. Er wird durch eigene Erfahrungen gescheiter, sittlich reifer und lebenstüchtig. Gerade darin liegt der hohe erzieherische und literarische Wert des Buches. Nichts ist darin gekünstelt, alles entspringt echtem Leben. Für 13- bis 18jährige sehr geeignet.
Es ist eigentümlich, wie sehr manchmal filmische Vorstellungen den Romanschriftsteller beherrschen und wie weitgehend die „Phantasiemaschine” den Acker der Wirklichkeit, überrollt. Resi Flierl, deren Buch „M ein Mann Maximilian” (Kaiser-Verlag, KLagenfurt) beinahe an eine Drehbuchvorlage gemahnt, dehnt eine recht leichte Handlung, die vielleicht für eine Novelle gereicht hätte, bis zur 176. Seite aus. Nach weiteren fünf Seiten Abgesang’ winkt endlich die schon geahnte Lösung. — Ähnlidies muß von deradn den zwanziger Jahren spielenden Roman „Der flammende Weinberg” (Kaiser-Verlag, Klagenfurt), den Grete F e 1 s i n g schrieb, gesagt werden. Wir erhofften uns nach dem Eingang viel mehr als eine erotisch überhitzte Atmosphäre und konventionelle Typen. Beiden Romanen, besonders dem letzten mit dem Hintergründe der südsteirischen Landschaft, ist Kraft der Naturversinnlichung nachzurühmen. — Gleichfalls in diesem sonnendurchfluteten Garten, mit ausgreifenden Kreisen bis übers Unterland und die Windischen Bühel nach Krain, blühen die Kindheitserinnerungen Paul Anton Kellers. Er faßt sie zusammen in dem Band „Jahre, die gleich Wolken wandern” (Verlag A. Pustet, Graz). An der Frage, wie weit Persönliches in Ailgemeingülti- ges erweitert ist, scheiden sich alle Kindheitsdarstellungen. Manches, das individuell für den Lebensgang vielleicht von Gewicht ist, verblaßt unter dem Lichte der Öffentlichkeit. Das mag der Grund für die ungleiche Wirkung der zusammengefaßten Erzählungen des steirischen Lyrikers und Novellisten sein. Am gewinnendsten ist die Melodie der Stille, des Verhaltenen, des Nichtganzgesagten. Das Buch ist verlagstechnisch gut ausgestattet. Von den Textzeichnungen passen jedoch die Menschendarstellungen in ihrer expressionistischen Note nicht zu den zarten Schwingen vieler Wortbilder.
Auf dem Gebiet der Tiererzählungen liegt eine Überfülle vor Große Vorbilder drücken. Auch Ditha H o 1 e s c h mit ihrer Geschichte einer Wölfin, „M o n d 1 i c h t” benannt (Ullstein-Verlag, Wien), befindet sich in der Nachbarschaft eines Olai Aslagson, Ernest Seton Tompson und wohl auch Jack London („White Fang”). Abseits von jenen Werken, die teils das Menschenmiterleben im allgemeinen oder das Jägerische in den Vordergrund stellen, bringt die Verfasserin eine eigene Linie des realistisch leichter erhalten können als jetzt ein einziger”.
Mannigfach verschlungen sind die Beziehungen und gegenseitigen Beeinflussungen von Pontifikalamt und Hochamt, Presbytermesse und einfachem Amt, häuslicher Eucharistiefeter und Privatmesse. Jungmann sieht dabei zu Zeiten eine gewisse liturgische Ermüdung und Hilflosigkeit gegenüber der lateinischen Sprache, die zum Verzicht auf den lateinischen Gesang und zur Lesemesse als neuer Grundform führt, „der Gemeinschaftsmesse, die die einfache Schönheit der Missa cantata zum großen Teil zurückholt und mit ihr die Vorteile der Volkssprache verbindet”.
Während der ganzen Führung durch das heilige Bauwerk der Messe spürt man die Sehnsucht des Verfassers, ihre liturgische Feier möge nicht erstarren oder erstarrt bleiben, sondern wieder zu frischem Leben erwachen. Durch das Meßbuch Pius V. „ist die römische Messe in einen gewissen Zustand der Starre eingetreten, ohne daß damit freilich eine Erstarrung auf immer festgelegt sein müßte”. Wie immer die weitere Entwicklung verlaufen wird, niemand, der daran ernstlich Anteil nimmt, wird an den Forschungsergebnissen dieses großangelegten Werkes vorübergehen können. Jeder Unterricht in Liturgik auf allen Stufen von der Volksschule bis zur Hochschule wird sich in Zukunft auf der hier gebotenen sicheren Grundlage aufbauen müssen und allen das rechte Verständnis für die Liturgie zuteil werden lassen.
Einführung in das Verständnis der Geschichte. Von Joseph C h a m b o n. Gotthelf-Verlag, Zürich, Oktav, 182 Seiten.
Das Buch Chambons will nicht mit den systematischen Einführungen in die Geschichtswissenschaft, wie wir sie vor allem Wilhelm Bauer und Ernst Bernheim verdanken, in Wettbewerb treten. Seine Zwecksetzung ist bescheidener und anspruchsvoller zugleich. Es geht hier um die Deutung einiger wesentlicher, geschickt herausgegriffener, historischer und geschichtsphilosophischer Probleme, von denen der Verfasser zu einer abschließenden Stellungnahme zu Kategorien wie Raum und Zeit, Qualität und Quantität, Analyse und Synthese, Schuld und Hoffnung vorstößt. Sein geistiger Standort ist der des gläubigen Christen, im besonderen eines durch die traditionsreiche Genfer Schule gegangenen weltoffenen Kalvinisten aus althugenottischer Familie. Der so oft in seelenlosem Mechanismus endlnde Versuch, einen Einklang zwischen historischem und naturwissenschaftlichem Weltbild zu schaffen, gibt — in vornehmer Zurückhaltung glücklich begrenzt — dem Werk seine besondere Note. Die eindringliche Klarheit des Stils kann als vorbildlich gelten. Univ.-Doz. Dr. Erich Zöllner,
Beethovens unsterbliche Geliebte. Von Kurt Smolle. Beiträge zur Literatur, Kunst und
Musik. Europa-Verlag, Wien.